 Gleich in der Einleitung des Buches von Sascha Lobo steht fettgedruckt dieser Satz: „Realitätsschock in einem Satz: Plötzlich müssen wir erkennen, dass die Welt anders ist als gedacht oder erhofft.“
Gleich in der Einleitung des Buches von Sascha Lobo steht fettgedruckt dieser Satz: „Realitätsschock in einem Satz: Plötzlich müssen wir erkennen, dass die Welt anders ist als gedacht oder erhofft.“
Die Welt scheint aus den Fugen geraten, und ist mit unserem geistigen Vermögen schwer zu erfassen. Wir werden „der Hoffnung beraubt, Politik, Wirtschaft und Eliten hätten eine gewisse Kontrolle über den Lauf der Dinge.“
Die These des Buches lautet: Digitalisierung und Globalisierung bedingen sich gegenseitig, sodass die eine Entwicklung ohne die andere nicht möglich und deswegen nicht zu verstehen wäre. Dieser Gedanke wird auf bald vierhundert Seiten in zehn (wie wir später sehen werden, eigentlich elf!) Kapiteln durch dekliniert.
Gleich eingangs entschuldigt er sich, dass er einen weiteren Entwicklungsstrang auslassen musste: die zunehmenden und für Viele überraschenden Rollen, die Frauen nun einnehmen. Dies müsse er seiner Frau, Meike Lobo, überlassen, die ein Buch darüber vorbereite, und er möchte nicht vorgreifen. Schade! Ein wenig old School, aber nicht unsympathisch für einen Ehegatten …
Er bezieht sich auf das Buch „Die Metamorphose der Welt“ von Ulrich Beck 2016 geschrieben, in dem es heißt, die Welt in der wir leben, verändert sich nicht bloß, sie befindet sich in einer Metamorphose. „… Die ewigen Gewissheiten moderner Gesellschaften brechen weg.“ Später zitiert er Beck: „Die laufende Metamorphose hängt zutiefst mit dem Konzept des Nichtwissens zusammen. Dieses Nichtwissen kann uns nicht mehr schützen, wenn wir alles Wissen, das uns zugänglich ist, aufnehmen und bedenken.“
Ich hatte beim Lesen mit den Bereichen angefangen, über die ich schon viel wusste und nachgedacht hatte. Als dabei Lobos Konzept nachvollziehbar und immer auch erfrischend war, konnte ich vertrauensvoll die mir unbekannten Bereiche lesen und staunen. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle schon anmerken, dass er das Alter meiner Kinder hat.
Beim Lesen genoss ich seine große Sachkenntnis und Erfahrung im Netz: Wer kann schon von sich im Klappentext schreiben, dass er „in Berlin und im Internet lebt“? Als Gesundheitswissenschaftlerin fand ich das Kapitel zur Gesundheit realitätsfern, es sollte überarbeitet werden.
Klima (Kapitel 1)
Klimakollaps, Plastikpanik, vegane Visionen
Das Kapitel beginnt in einem sibirischen Dorf am Barentssee, in dem hungrige Eisbären die Menschen bedrohen. Der Klimawandel, der 2018 beginnt, führt zu Verschiebungen: während die USA Temperaturen bis zu minus 50°C haben, im nahe am Pol gelegenen Russland wird es dagegen zu warm. Dadurch schwimmen für die Eisbären keine Robben mehr auf Eisschollen heran und sie müssen sich ihre Nahrung anderswo suchen, etwa in der Nähe menschlicher Behausungen. Woher wissen wir diese Zusammenhänge? Von Satellitenaufnahmen.
Das Zeitalter des Holozän mit klimatischer Stabilität ist beendet, wir leben im Anthropozän, dem Zeitalter des Menschen. Der Klimaforscher Schellnhuber sagt 2019: „Wir Forscher haben gewarnt vor den Folgen des Klimawandels … und Keiner hört zu.“ Erst als die Jugendlichen der Klimabewegung das Wissen ernst nehmen, wird der Begriff „Kippelemente der Erdsysteme“ in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Als nächstes wird ausführlich die „Plastikpanik“ behandelt, wie die Plastik produzierende Industrie schon in den siebziger Jahren Stimmung für ihr Produkt machen (kann man immer wiederverwenden!) und die Schuld für den Plastikmüll auf die Verbraucher schiebt. Oder man soll recyceln, was aber faktisch nur in 5,6 % der Fälle geschieht.
Zeitgleich entwickeln sich digitale Medien und die Bilder von Plastik verseuchten Meeren erreichen uns. Sie zeigen, wie Produkte, die in reichen Ländern hergestellt und genutzt wurden, als Müll in die Verantwortung armer Staaten kommen, die die Probleme nicht besser lösen können. Es folgt eine Übersicht, wann einzelne Länder beispielsweise Plastiktüten verboten haben.
Seit Anfang der Zehnerjahre werden mehr Menschen „plötzlich pflanzlich.“ In Deutschland sind 2016 1,3 Millionen Menschen vegan, knapp 9 % vegetarisch. Ein Grund sind die Leiden der Tiere, aber angesichts des durch Viehzucht entstehenden Kohlendioxidüberschusses (70 % der Agrarflächen werden für die Tierproduktion verwendet!) wird zunehmend pflanzliche Ernährung als bester Ausweg gesehen.
Israel gilt als Hochburg des Veganismus, schon 2015 mit rund 5 % der Bevölkerung, die sich vegan ernährt. Beim anstehenden Wechsel der Ernährungsgewohnheiten spielen Kinder und Jugendliche eine große Rolle, auch als Mediennutzer, die ihre Eltern beeinflussen. In ihnen sieht Lobo die entscheidenden Akteure, um den Kapitalismus „ökologischer und bedingungslos nachhaltig“ zu machen.
Migration (Kapitel 2)
Massenwanderungen: Warum Migration heute ein höchst digitales Problem ist
Die UN hat ein „Predictive Analytics“ Projekt aufgebaut, das mit Daten wie Konflikteinschätzungen eine Wiederholung des „Realitätsschock von 2015“ künftig vermeiden soll. Die damalige Migration von mehr als einer Millionen Syrern wird als „Zeitenwende“ bezeichnet. Alle Parteien in der BRD fordern, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen, manche eher human, andere eher inhuman – hilflos sind sie alle.
Große Wanderungsbewegungen gab es immer: 90 % innerhalb von Afrika. Die Migrationsvermeidungsstrategien der Europäer denken eurozentrisch nur an die, die nach Europa wollen, in besonders erwählte Länder, zu denen Deutschland gehört.
„Wasser, Smartphone, Essen, in dieser Reihenfolge“, so beschreibt eine britische Migrationssoziologin die Prioritäten der Migranten. Sie schätzen die Möglichkeit, Kontakt zu Freunden und Familie aufrecht zu erhalten, darüber ihre Flucht zu organisieren, und Kontakte am geplanten Zielort zu finden.
Die afrikanische Migration ist eine Spätfolge des Kolonialismus; viele der europäischen Staaten hatten Kolonien in Afrika. In einem längeren Zitat eines togolesischen Kulturhistorikers schreibt er: „Kolonisierung (war) eine gewalttätige Einführung von Systemen“ … mit dem Ziel, die Länder auszubeuten. „Eine Elite führt diese Systeme weiter. In den meisten afrikanischen Ländern wird eine große Masse der Bevölkerung (von dieser Elite) im Stich gelassen … Migration und Entwicklung gehören zusammen, aber mit einer Sensibilität für die hinterlassenen Systeme der Kolonialzeit.“
Nach der Unabhängigkeit der meisten afrikanischen Nationen ging es auf neue Weise weiter. Die Ermordungen afrikanischer Führer wurden, wie wir aus inzwischen freigegebenen Geheimdienstunterlagen wissen, durch die europäischen Mächte und die USA inszeniert.
Handelsbeziehungen sollen die alte Einteilung, ihr liefert die Rohstoffe und wir die Produkte, erhalten. 2014 wollte Kenia ein europäisches Freihandelsabkommen mit der Ostafrikanischen Staatengemeinschaft nicht unterzeichnen, weil es befürchtete, die heimischen Produkte hätten gegen Subventioniertes keine Chance. Darauf erhöhte die EU die Zölle für kenianische Waren (Blumen, Kaffee, Obst) um 30 %. Der Export drohte zu versiegen, und Kenia unterschrieb. Ein kenianischer Wirtschaftsexperte schätzt, dass das Land aus den durch das Handelsabkommen resultierenden EU-Importen jährlich rund 100 Millionen Euro verliert.
„Sie kommen so oder so“ und hinterlassen, gerade in Westafrika, in manchen Gegenden praktisch keine Jugendlichen mehr, die für die heimische Landwirtschaft nötig sind.
Integration (Kapitel 3) und Rechtsruck (Kapitel 4)
sind ebenfalls kenntnisreich und lesenswert. Zur Integration habe ich mir gemerkt, dass Helmut Kohl 1982 (in einem inzwischen veröffentlichtem Dokument) Frau Thatcher in London erklärte, dass es notwendig wäre, die Anzahl der in Deutschland lebenden Türken um 50 % zu reduzieren. Wir sehen dann die langsame Entwicklung auch bei der CDU, Integration steuern zu wollen, die Phasen des Multikulti, der Leitkultur, und wie der Versuch scheitert, die muslimischen Kirchenverbände mit der Integration zu betrauen. Statt der Leitkultur gälte es, Leitwerte zu vermitteln, eine Art Multikulti 2.0. „Es handelt sich um die basalen Regeln der liberalen Demokratie, die allerdings in Europa auch von lange heimischen Einwohnern nicht ausreichend ernst genommen werden.“ Diesen widmet sich das vierte Kapitel.
China (Kapitel 5)
Die chinesische Weltmaschine—Wie Chinas Gegenwart auch unsere Zukunft verändert
Das Kapitel beginnt mit der Beschreibung eines Fünfjährigen, dessen „Tigereltern“ das Einzelkind auf das Leben in einer „gesellschaftlichen Effizienzradikalität“ vorbereiten. Die meisten unter Vierzigjährigen in der wachsenden Mittelschicht glauben an das „meritokratische Wohlstandsversprechen“ und „konsumieren sich reich.“
Die Digitalisierung der Gesellschaft ist unglaublich weit fortgeschritten, finanzielle Transaktionen werden meist digital erledigt. Dieses Jahrhundert wird zum chinesischen, weil auch die westlichen Firmen ihre Produkte danach entwickeln, ob sie auf dem chinesischen Markt bestehen. Übrigens richtet auch Hollywood seine Filme danach aus. Und der Vorsprung wird in China weiter ausgebaut durch gezielte Förderung gerade der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI).
Wenn früher galt: Demokratie plus Marktwirtschaft gleich Wohlstand, scheint das chinesische Gegenmodell: Autoritäre Herrschaft plus Digitalkapitalismus gleich Wohlstand für manche überzeugender.
Im Mai 2020 liest sich der folgende Satz des 2019 erschienenen Buches prophetisch: „Ab und zu wird eine kommende chinesische Krise beschworen, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gering. …wird eine chinesische Krise, so merkwürdig das klingt, den Rest der Welt härter treffen, als China selbst.“
Künstliche Intelligenz (Kapitel 6)
Wir nannten es Arbeit
Wie künstliche Intelligenz und Plattformen verändern, was wir unter Arbeit verstehen.
In einigen Chefetagen ist schon der Begriff der Decision making Strategie angekommen. Problem dabei, je mehr KI angewandt wird, „umso schwieriger wird es, den Sinn dahinter zu erkennen.“ Wer etwa Facebook fragt, warum ein „Inhalt im Nachrichtenstrom angezeigt wird und der andere nicht, dann ist deren einzige ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht, das hat die KI so anhand von Nutzungsdaten entschieden.“ Ein bisschen anders als in China ist es bei uns also doch …
Gesundheit (Kapitel 7)
Digitale Körperlichkeit
Dies ist das Kapitel, welches mich zu einem zweiwöchigen Realitätsschock Detox veranlasste. Der Tenor ist: mit der Digitalisierung wird bestimmt auch in Deutschland endlich die Gesundheit besser. Die in den anderen Kapiteln durchschimmernde Systemskepsis vermisse ich hier. Bei „Wir nannten es Arbeit“ wird über die ungerechte Bezahlung verschiedener Tätigkeiten gesprochen, seit Jahrzehnten wissen wir, dass Pflegekräfte unterbezahlt sind, viele nach wenigen Jahren den Beruf aufgeben, und viele Stationen, schon lange vor Corona, unterbesetzt sind. Das in anderen Kapiteln Bearbeitete wird nicht auf das Gesundheitswesen bezogen.
Lobo stellt Erkenntnisse medizinischer Forschung dar, vor allem im Bereich der genetischen Forschung, die eine aufs Individuum angepasste Medizin erlauben. Deutschland hat sich dieser Entwicklung bisher eher verweigert. „Wir wohnen der Entstehung unseres zweiten Körpers bei.“ Und der ist digital. Die Vermessung des Körpers läuft inzwischen bei „hunderte(n) Millionen Menschen“ und Lobo begrüßt, dass einige davon sinnvoll verknüpft werden können. Er hofft: „Eine digitale Kultur der Offenheit (gegenüber etwa psychischen Erkrankungen) ist im Netz entstanden, und sie betrifft auch das Körperliche.“ Wie soll die mögliche Diskriminierung von Menschen, deren Genom sie für Erkrankungen (etwa psychische) prädestiniert, verhindert werden? „Wir brauchen gesellschaftliche, regulatorische, politische und auch technische Antworten auf die Fragen, die sich daraus ergeben.“
Nicht nur Gesundheitswissenschaftler wissen, dass es in Deutschland eine Unterversorgung bei der sprechenden Medizin gibt, eine Überversorgung bei operativen Eingriffen, weil diese besser bezahlt werden. Da geht es um Macht und viel Geld. Wessen Interessen werden „Antworten auf die Fragen“ entsprechen. Stattdessen wünscht er: „Irgendwann werden physischer und digitaler Körper wieder eins.“ Und wo bleibt die Seele?
Noch bedenklicher sein Schluss: Die Kosten-Nutzen-Rechnung des deutschen Gesundheitswesens ist mies. Warum? Wegen der mangelhaften Digitalisierung. Erst wenn die kommt, wäre das deutsche Gesundheitswesen „ausreichend effizient.“
Soziale Medien (Kapitel 8)
Fun und ein Stahlbad
Wir erfahren, wie ein junger Mann, mit Spitznamen „Drachenlord“ von der Medienmeute fertig gemacht wurde. An einem Augusttag kamen in sein kleines fränkisches Dorf 800 Menschen, um ihn zu belagern, traten die Türen ein und legten einen Brand, sodass er mit Hilfe von Polizei und Feuerwehr geschützt werden musste. Was hatte er verbrochen? Im Netz seine eigenwilligen Meinungen vertreten. Dazu wurde er provoziert. Ein Beispiel: Er wurde von einer Frau dazu verführt, dass er ihr seine Liebe gestand, worauf sie dies Hunderten Interessierten mitteilte. Ihr Freund, auch ein Youtuber, hat alles aufgenommen und ins Netz gestellt.
Nachbarn rieten ihm, mit dem Posten aufzuhören, aber er sieht es als sein Recht an, weiterzumachen. An diesem Punkt wurde mir als alter weißer Frau etwas klar: Sascha Lobo hat ein Verständnis für dessen Weitermachen entwickelt, das mir fehlt. Als wenn es ein Recht gäbe, auf Provokationen hereinzufallen! Sein Zitat dazu: „Solche Ratschläge beruhen auf der Selbstverständlichkeit einer Zeit, in der man noch die Wahl hatte, ob man ins Netz geht oder nicht. Diese Zeit ist für die meisten jüngeren Menschen vorbei.“ Der Drachenlord lebt auch von den Werbeeinnahmen, die er, wie viele Youtuber auch, ausgezahlt bekommt.
Wir lernen viel über Cybermobbing: In den USA gab es Selbstmorde von überlebenden Schülern nach Schulschießereien, oder auch von Eltern getöteter Schüler. Es war verbreitet worden, die Massaker hätten gar nicht stattgefunden, sondern seien vom „tiefen Staat“, also den Behörden, selbst inszeniert. Die rechtsgerichteten Provokateure, die auch der Waffenindustrie nahestehen, unterstellten, die Trauernden seien Krisenschauspieler, die vom Staat bezahlt und von der „Lügenpresse“ über nicht stattgefundene Schießereien interviewt worden waren.
Gamegater sind Gruppen, die gerne ihre Spiele austauschen und einen Hass auf Frauen pflegen, und gespielt verfolgen, indem sie Intimes, auch Erfundenes, verbreiten.
In diesem Zusammenhang lernen wir die Besonderheiten von Twitter kennen. “Twitter ist ein großartiger Ort, um der Welt mitzuteilen, was man denkt, noch bevor man darüber nachgedacht hat.“ Wie funktioniert ein Hashtag, wie werde ich als Twitterin Teil eines Shitstorms, ohne es zu wissen?
Die enge Beziehung zwischen Fake News und Verschwörungstheorien (Traumpaar) wird an harmlosen Beispielen (der Mond ist aus Käse, oder die Erde ist eine Scheibe) gezeigt. Mit welchem Algorithmus („lernender Empfehlungsalgorithmus“) wird beim Autoplay bei Google der nächste Film ausgewählt, der mich als Nutzerin mit weiteren Beweisen für die angesprochene Theorie überzeugen soll. „Bei frisch zur Verschwörungstheorie Konvertierten handelt es sich um das absolute Traumpublikum von Youtube.“
Gefährlicher ist die Verwendung zur Rekrutierung von Islamisten, oder die Verbrechen der Militärs in Myanmar gegenüber den Rohingyas. Erst vier Jahre nach Vorwürfen, dass über Facebook die herrschende (buddhistische) Elite Greueltaten der (muslimischen) Rohingyas vorgetäuscht hatten, reagiert Facebook: Für die siebenstellige Zahl der Nutzer in Myanmar wird eine Task Force für die Überprüfung von Hassreden in der Landessprache gebildet: „Die Zahl der Mitarbeiter der Task Force: eins.“ Das Unternehmen Facebook hat im Jahr 2018 übrigens 55 Milliarden Dollar mit Werbung eingenommen.
Zukunft (10.) Kapitel
Die Weisheit der Jugend
Warum die Älteren von den Jungen lernen müssen, um den Realitätsschock zu bewältigen
Ein schönes Kapitel: Es werden die bekannten Aktivitäten dargestellt, mit der Zuversicht, dass sie dem Erhalt der Erde dienen, mit einem Schlusswort von Greta.
Zum elften Kapitel, das auch lesenswert ist, kommen wir über einen QR Code, im Anhang des Buches. Der soll aber nicht im Netz verbreitet werden, darüber wird Buchfluch ausgesprochen. „Ihnen möge für den Rest der Tage stets im unpassenden Moment der Handyakku leer sein.“ Ein Tipp für diejenigen, die länger auf die € 22 sparen müssten: Man kann das Buch auch in der Stadtbücherei ausleihen! Es lohnt sich!
Fazit: Schockierend realistisch, das Gesundheitskapitel noch mal überarbeiten!
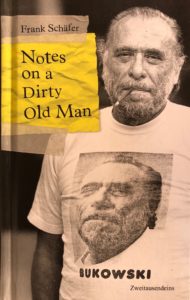

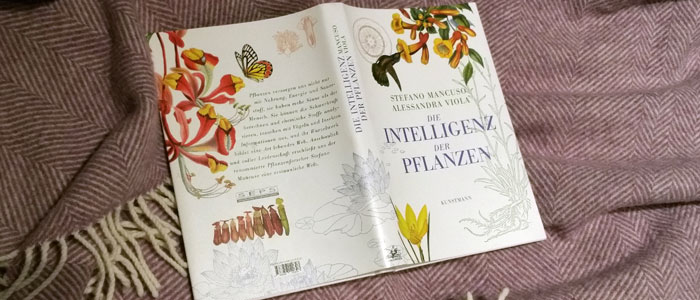
 Gleich in der Einleitung des Buches von Sascha Lobo steht fettgedruckt dieser Satz: „
Gleich in der Einleitung des Buches von Sascha Lobo steht fettgedruckt dieser Satz: „
 Vom Faszinosum der Literatur
Vom Faszinosum der Literatur Geschmälerte Lesefrüchte
Geschmälerte Lesefrüchte Club der toten Dichter
Club der toten Dichter Expertise eines Insiders
Expertise eines Insiders




 Eine Expedition in die Heimat des Hawai-Toasts
Eine Expedition in die Heimat des Hawai-Toasts