 Advocatus Diaboli einer städtischen Kultur
Advocatus Diaboli einer städtischen Kultur
Als sechstes Thema einer München gewidmeten Buch- und Ausstellungsreihe unter dem Namen «Erkundungen» hat die Bayerische Rück 1987 ein lesenswertes Buch über Thomas Manns Münchner Jahre herausgegeben, die Zeit von 1894 bis 1933 behandelnd. Mit profundem literarischen Sachverstand werden jene knapp vierzig Jahre beschrieben, die der Nobelpreisträger in seiner bayerischen Wahlheimat zugebracht hat, die Hälfte seines Lebens immerhin. Wobei der Autor Jürgen Kolbe kritisch und distanziert zur Auseinandersetzung mit seinem Thema herausfordert, indem er alle Stimmen zu Worte kommen lässt, dadurch liebgewonnene Vorurteile über Thomas Mann und Klischees über München in Frage stellend und nicht selten auch entlarvend. Bei der Lektüre dieses informativen Buches wird einem schnell klar, dass der berühmte Schriftsteller als Nordlicht, in Lübeck geboren und aufgewachsen, in einer ausgesprochenen Hassliebe mit der bayerischen Metropole verbunden war, von der er sich am Ende jedoch nur unter dem Druck der politischen Umwälzungen, in letzter Minute gewissermaßen, loslösen konnte und musste.
Auf 425 Seiten werden in diesem großformatigen Sachbuch alle Aspekte der Münchner Jahre von Thomas Mann beleuchtet. Außerdem ergänzen hunderte von prächtigen Fotos, sowohl aus dem Umfeld des Dichters und vieler seiner Zeitgenossen als auch von München, ferner diverse Reproduktionen von Dokumenten aus dieser Zeit, in idealer Weise den Text. Sehr häufig lässt Jürgen Kolbe den Schriftsteller der berühmtesten deutschen Romane persönlich zu Wort kommen, zitiert häufig aus den reichlich vorhandenen Quellen dieses wie kaum ein Zweiter seiner Zunft in allen seinen Äußerungen und Schriften archivarisch verewigten Literaten. Durch wahrlich glückliche Umstände war es Thomas Mann nämlich gelungen, Tagebücher, Werknotizen, Entwürfe und anderes mehr noch aus München herauszuholen, als ihm die Rückkehr aus dem Ausland praktisch schon verwehrt war, ihm drohte damals, politisch nicht opportun wie er war, als erklärter Gegner der Nazis ganz konkret das Konzentrationslager Dachau.
Bei allen Verdiensten hatte dieser Mensch auch seine dunklen Seiten, war ein Sonderling in der Münchner Kulturszene, ein «Bürgerprinzchen» mit bourgeoisem Habitus, früh zu Ruhm gekommen durch die «Buddenbrooks», die Boheme Münchens vehement ablehnend, er hatte kaum richtige Freunde. Und so verbarg er, seine homosexuellen Neigungen strikt verleugnend, unter der Camouflage einer bürgerlichen Existenz mit Familie und sechs Kindern sein wahres Ich, dem er verschämt im «Tonio Kröger» und im «Tod in Venedig» dann literarisch eine Stimme gab. Ein vom deutschen Zoll abgefangenes Paket mit Tagebüchern und anderen intimen Notizen wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden, hätten die Nazis es in die Hände bekommen. Er war in heller Aufregung deswegen und hat diese brisanten Unterlagen später im amerikanischen Exil höchstpersönlich verbrannt. Fontanes Protagonistin «Effi Briest» hatte dies nicht getan, die Folgen sind bekannt!
Es wird noch vieles beleuchtet in diesem gelungenen Werk über Thomas Mann, seine politische Wandelung, sein Konflikt mit dem so ganz anders gearteten Bruder Heinrich, seine oft ins Penetrante gehende Lebensweise als Familienvater ebenso wie als Literat. Berthold Brecht hat ihn hämisch als Großschriftsteller tituliert, Bruder Heinrich sagte, er sei ein «Genie nur innerhalb der Geschäftszeiten», damit auf seine unumstößliche, büromäßig ablaufende, pedantische Arbeitsweise anspielend, die in der Literatenszene, jedenfalls soweit mir bekannt, ohne Beispiel ist. Aber sei’s drum, was dieser Autor geschaffen hat als Werk, ist allenfalls mit dem Goethes zu vergleichen, und so hat er sich auch selbst gesehen, auf Augenhöhe mit dem Dichtergenie. Für kleine Münze wird dieses prächtige Buch heute antiquarisch angeboten, der Gewinn für den aufnahmefähigen Leser ist demgegenüber nur als immens zu bezeichnen.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
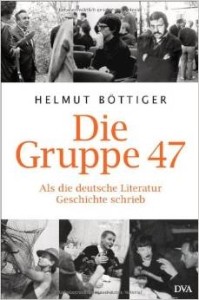 Von literarischem Kannibalismus
Von literarischem Kannibalismus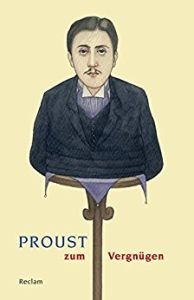 Amüsantes aus dem literarischen Olymp
Amüsantes aus dem literarischen Olymp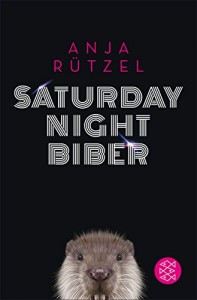 Sie lässt sich in Österreichs Bergen schockfrosten beim Hirsch-Watching, reist alternden Ameisenbären durch halb Europa hinterher und domestiziert eine Kakerlaken-Gang samt des berüchtigten Anführers Schabi Alonso: Anja Rützel ist die geborene Tierflüsterin (auch wenn man sich bisweilen nur schwer des Eindrucks erwehren kann, dass einige ihrer Patienten kurzerhand den Spieß umdrehen um ihrerseits als Rützel-Flüsterer zu reüssieren).
Sie lässt sich in Österreichs Bergen schockfrosten beim Hirsch-Watching, reist alternden Ameisenbären durch halb Europa hinterher und domestiziert eine Kakerlaken-Gang samt des berüchtigten Anführers Schabi Alonso: Anja Rützel ist die geborene Tierflüsterin (auch wenn man sich bisweilen nur schwer des Eindrucks erwehren kann, dass einige ihrer Patienten kurzerhand den Spieß umdrehen um ihrerseits als Rützel-Flüsterer zu reüssieren). Ein Buch für Querdenker
Ein Buch für Querdenker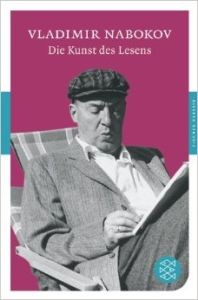 Wer sucht, der findet
Wer sucht, der findet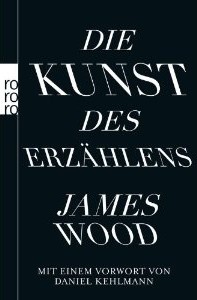 Ein Marketing-Trick des deutschen Verlegers
Ein Marketing-Trick des deutschen Verlegers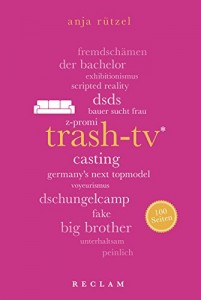 »Man darf als Kulturwissenschaftler nicht vor scheinbar niederen Themen und Phänomenen zurückschrecken, weil sich ein Müllmann auch nicht vor dem Müll fürchten darf.«
»Man darf als Kulturwissenschaftler nicht vor scheinbar niederen Themen und Phänomenen zurückschrecken, weil sich ein Müllmann auch nicht vor dem Müll fürchten darf.«

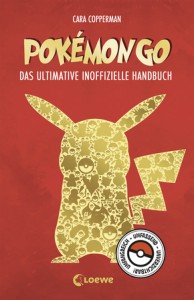 Pokémon Go ist statistisch betrachtet das erfolgreichste Handy-Spiel aller Zeiten. Um die Millionen deutscher Kids, die mit ihren Smartphones Pokémons jagen, mit erforderlichem Basiswissen auszustatten, legt der Loewe Verlag nun ein ansprechendes Handbuch vor. Damit können sich Anfänger die Grundlagen des Spiels aneignen und Fortgeschrittene erhalten nützliche Anregungen.
Pokémon Go ist statistisch betrachtet das erfolgreichste Handy-Spiel aller Zeiten. Um die Millionen deutscher Kids, die mit ihren Smartphones Pokémons jagen, mit erforderlichem Basiswissen auszustatten, legt der Loewe Verlag nun ein ansprechendes Handbuch vor. Damit können sich Anfänger die Grundlagen des Spiels aneignen und Fortgeschrittene erhalten nützliche Anregungen. 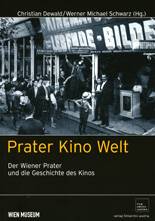
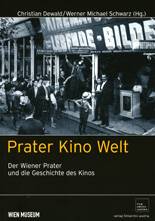 2016 feierte der Wiener Prater sein 250-jähriges Jubiläum, nachdem Kaiser Joseph II. die ehemals kaiserlichen Jagdgründe öffentlich zugänglich gemacht hatte. 2005 – zum fünfzigjährigen Bestehen des Filmarchivs Austria – erschien die vorliegende Publikation mit dem Titel “Prater Kino Welt”, die sich mit dem Prater als Mythos und Heimat von Illusionen beschäftigt. Eine DVD, die auch heute noch erhältlich ist, sowie eine Ausstellung und ein Festival beim Riesenrad begleiteten das Jubiläum und feierten u.a. auch die ersten Filmvorführungen überhaupt die in eben diesem Prater erstmals Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Der Prater ist seit damals ein Raum zur Assimilierung der Moderne in dem Hochschau- oder Achterbahnen, Schiffs- und Aeroplankarusselle oder das Prater Hochhaus Hotel Mysteriös und Kaiserpanoramen ausgestellt wurden. Auch Reisen in fremde Welten wurden dort angeboten, etwa nach Venedig, Japan oder Afrika. Aber auch die literarische Repräsentation des Praters von Stifter, Salten und Zweig wird in vorliegender Publikation Rechnung getragen, sowohl in visueller als auch klanglich-auditiver aber sexueller Konnotation und Dimension.
2016 feierte der Wiener Prater sein 250-jähriges Jubiläum, nachdem Kaiser Joseph II. die ehemals kaiserlichen Jagdgründe öffentlich zugänglich gemacht hatte. 2005 – zum fünfzigjährigen Bestehen des Filmarchivs Austria – erschien die vorliegende Publikation mit dem Titel “Prater Kino Welt”, die sich mit dem Prater als Mythos und Heimat von Illusionen beschäftigt. Eine DVD, die auch heute noch erhältlich ist, sowie eine Ausstellung und ein Festival beim Riesenrad begleiteten das Jubiläum und feierten u.a. auch die ersten Filmvorführungen überhaupt die in eben diesem Prater erstmals Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Der Prater ist seit damals ein Raum zur Assimilierung der Moderne in dem Hochschau- oder Achterbahnen, Schiffs- und Aeroplankarusselle oder das Prater Hochhaus Hotel Mysteriös und Kaiserpanoramen ausgestellt wurden. Auch Reisen in fremde Welten wurden dort angeboten, etwa nach Venedig, Japan oder Afrika. Aber auch die literarische Repräsentation des Praters von Stifter, Salten und Zweig wird in vorliegender Publikation Rechnung getragen, sowohl in visueller als auch klanglich-auditiver aber sexueller Konnotation und Dimension.
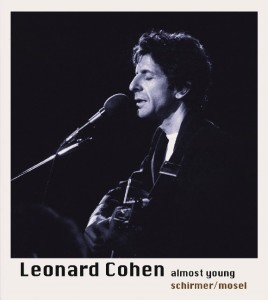 Zwischen 2008 und 2010 war Leonard Cohen nochmals auf Tournee, darunter auch Auftritte in Europa und vielleicht beschlich schon damals einige Zuschauer das mulmige Gefühl, dass es ja die letzte sein könnte. Im selben Jahr war er auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Im Herbst 2016 trat der „bibelfeste Jude aus Westmount/Montreal“ wie ihn zuletzt ein Kollege nannte seine letzte Reise und viele mögen dabei in das von ihm oft gespielte „Hallelujah“ eingestimmt haben, leise, zum Abschied eines Sängers, der eigentlich Schriftsteller werden wollte: „I did my best, it wasn’t much/I couldn’t feel, so I tried to touch/I’ve told the truth/I didn’t come to fool you/And even though it all went wrong/I’ll stand before the lord of song/With nothing on my tongue but hallelujah“. Leonard Cohen starb mit 82 Jahren und hinterließ einen „Tower of Songs“, also viel mehr als in dem Song Hallelujah anklingt: it was really much and it it still is.
Zwischen 2008 und 2010 war Leonard Cohen nochmals auf Tournee, darunter auch Auftritte in Europa und vielleicht beschlich schon damals einige Zuschauer das mulmige Gefühl, dass es ja die letzte sein könnte. Im selben Jahr war er auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Im Herbst 2016 trat der „bibelfeste Jude aus Westmount/Montreal“ wie ihn zuletzt ein Kollege nannte seine letzte Reise und viele mögen dabei in das von ihm oft gespielte „Hallelujah“ eingestimmt haben, leise, zum Abschied eines Sängers, der eigentlich Schriftsteller werden wollte: „I did my best, it wasn’t much/I couldn’t feel, so I tried to touch/I’ve told the truth/I didn’t come to fool you/And even though it all went wrong/I’ll stand before the lord of song/With nothing on my tongue but hallelujah“. Leonard Cohen starb mit 82 Jahren und hinterließ einen „Tower of Songs“, also viel mehr als in dem Song Hallelujah anklingt: it was really much and it it still is.
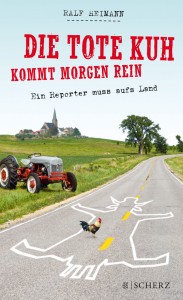
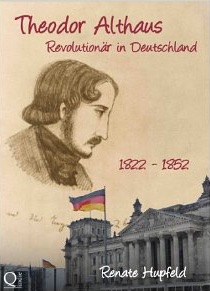 Theodor Althaus wurde zwar nur 30 Jahre alt, aber seine Rolle in Deutschlands bürgerlich-demokratischer Revolution 1848 ist es wert, näher beleuchtet zu werden. Renate Hupfeld erfüllt diese Aufgabe mit gewissenhafter Recherche und bildhafter Sprache.
Theodor Althaus wurde zwar nur 30 Jahre alt, aber seine Rolle in Deutschlands bürgerlich-demokratischer Revolution 1848 ist es wert, näher beleuchtet zu werden. Renate Hupfeld erfüllt diese Aufgabe mit gewissenhafter Recherche und bildhafter Sprache.