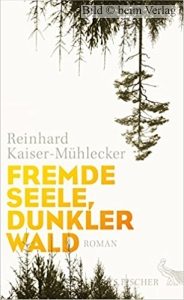 Triumph der Langsamkeit
Triumph der Langsamkeit
Seine dörfliche Herkunft bildet auch in «Fremde Seele, dunkler Wald», dem sechsten Roman des österreichischen Schriftstellers Reinhard Kaiser-Mühlecker, den Erzählkosmos. Der Titel basiert auf einem Zitat Turgenjews: «Du weißt ja, eine fremde Seele ist wie ein dunkler Wald». Womit die Thematik des Romans bereits treffend angedeutet ist: Eine zerrissene bäuerliche Familie in einer drögen Dorfgemeinschaft als Fatum zweier junger Männer, die ihr Leben als Gefängnis empfinden und unbeholfen eine Weltflucht versuchen. Dem üblichen «Heile Welt»-Mythos des Heimatromans setzt der Autor hier seelische Ödnis in idyllischer Landschaft entgegen.
Ankerpunkt der düsteren Geschichte ist ein Bauernhof, in einem abseitigen Tal Oberösterreichs gelegen, über das in großer Höhe eine Autobahnbrücke gespannt ist, deren nicht abreißender Verkehrsstrom den permanenten Kontrast bildet zur dörflichen Ereignislosigkeit. Alexander und Jakob sehen für sich keine Zukunft auf dem im Niedergang befindlichen Hof der Eltern. Der Vater phantasiert von Geschäften, die sich als reine Luftnummern erweisen, vernachlässigt den Hof und verkauft heimlich nach und nach alles Land, am Ende auch das Vieh. Während der dreißigjährige Alexander nach einem religiösen Umweg schließlich Soldat wird und bei einem Blauhelmeinsatz im Kosovo mitwirkt, kann sich der halb so alte Jakob nach der Schule für keinen Beruf entscheiden und führt teilnahmslos den Hof weiter. Beide Brüder haben ein seltsam gestörtes Verhältnis zu Frauen. Alexander hat für einige Zeit eine Affäre mit der Frau seines Chefs, die seiner jedoch irgendwann überdrüssig wird. Seine verpasste große Liebe, wie er im Nachhinein schmerzhaft erkennt. Jakob gerät an Nina, die sehr bald schwanger wird, sie entfremden sich aber schnell und trennen sich ebenfalls. Das Figurenensemble wird ergänzt um einen fragwürdigen Freund Jakobs, der erst seine Nähe sucht und sich dann von ihm abwendet, am Ende sogar Suizid begeht. Der rückwärtsgewandte Großvater ist als Nazi zu Reichtum gekommen und ist finanziell unabhängig vom Hof. Er überrascht die Familie nach seinem Tod, weil er den Nachlass seiner geizigen Frau allein überlässt, die ihn einer rechten Partei vermachen will, womit die Familie endgültig leer ausgeht. Der latente Eskapismus schließlich wird durch die urchristliche Sektenführerin Elvira personifiziert, mit der Alexander früher ein Verhältnis hatte.
Die lähmende Sprachlosigkeit innerhalb der Familie, aber auch der wortkarge Umgang aller anderen Figuren miteinander ist ein typisches Merkmal dieser in Episoden aufgeteilten Erzählung. Über allem Geschehen lastet ein düsterer Schatten, komplementär dazu dominiert in den häufig eingestreuten Naturschilderungen Kälte, Schnee, Nebel, Regen, scharfer Wind. Erzählerisch ist dieser Roman ein Triumph der Langsamkeit, geradezu altväterlich in der Sprache und quasi in Zeitlupe wird hier die Geschichte der missglückten Seelenfluchten als beinahe schon psychopathisches Lehrstück vor dem Leser ausgebreitet. Zu lachen gibt es da rein gar nichts!
«Mir geht’s ja so schlecht!» «Warum geht’s dir so schlecht?» «Weil ich sauf.» «Und warum säufst du?» «Weil’s mir schlecht geht!» Die Lektüre hat mich unwillkürlich an diesen abgedroschenen Scherz erinnert. Beide Brüder sind keinesfalls lebensuntüchtig, sie scheitern nur immer wieder auf wundersame Weise an sich selbst, sie scheinen aus der Zeit gefallen. Weite Teile des Romans werden in Form des Bewusstseinsstroms erzählt, mit Fragezeichen an den Satzenden, und auch Dialoge der blutleeren, wenig sympathischen Figuren finden sich eher selten, es mangelt ihnen zudem entschieden an Empathie. Der auktoriale Erzähler lässt vieles ungesagt in seinem erzählerischen Labyrinth, und auch Plausibilität ist kein narratives Kriterium dieses trübsinnigen Plots. Dass verklausulierte Happy End aber beweist, dass dem Autor seine Geschichte selbst zu elegisch erschien, er hätte diesen Fauxpas sonst sicherlich vermieden.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Ich denke selbst
Ich denke selbst
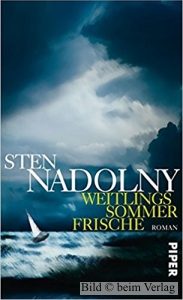 Multiple Identität
Multiple Identität

 Unwiederbringlich
Unwiederbringlich Symptom der Schwellenzeit
Symptom der Schwellenzeit
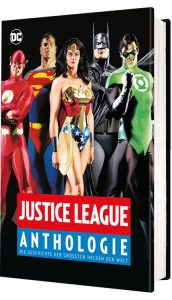

 Warum nicht?
Warum nicht? Lug und Trug
Lug und Trug