 Das Buch wirkt klein und schlank und ist doch mehr als eine Biografie. Schon der Untertitel verrät: “Mit einer kurzen Geschichte des Landschaftsgartens von seinen englischen Vorbildern bis zum Volkspark.“ Und wir lernen nicht nur über Landschaftsgärten, wir sehen auch Lennés Rolle darin: „Durch ihn wird die Gartenrevolution zur Gartenevolution. Bei ihm beginnt der Übergang in die Moderne mit allen ihren Licht- und Schattenseiten.“ Die Entwicklungsepochen der Landschaftsplanungen werden mit denen der Literatur verglichen, da wird Lenné zum romantischen Gartenpoet, ist mal der Spätromantiker, meist einfach der Landschaftspoet.
Das Buch wirkt klein und schlank und ist doch mehr als eine Biografie. Schon der Untertitel verrät: “Mit einer kurzen Geschichte des Landschaftsgartens von seinen englischen Vorbildern bis zum Volkspark.“ Und wir lernen nicht nur über Landschaftsgärten, wir sehen auch Lennés Rolle darin: „Durch ihn wird die Gartenrevolution zur Gartenevolution. Bei ihm beginnt der Übergang in die Moderne mit allen ihren Licht- und Schattenseiten.“ Die Entwicklungsepochen der Landschaftsplanungen werden mit denen der Literatur verglichen, da wird Lenné zum romantischen Gartenpoet, ist mal der Spätromantiker, meist einfach der Landschaftspoet.
Ohff berichtet von der Kindheit als Sohn des Hofgärtners von Brühl, seinen Ausbildungsstätten, etwa in München, der Arbeit in Wien und Paris, die Reisen. Von Hardenberg gelingt es 1816, den jungen Gärtnergesellen an den Preußischen Hof zu rufen.
Als Neuling muss er neben den Altvorderen bestehen, die barocke Schlossgärten für gottgegeben hielten, und da wollte ein Jüngling gerundete statt grader Wege planen, sogar Bäume fällen, wegen der besseren Aussicht! (Dit ham wa ja noch nie jemacht! Höre ich in Erinnerung eigener Tätigkeiten im Öffentlichen Dienst.)
Ohff glänzt nicht nur mit seinem Wissen über Garten- und Landschaftsplanung, er beschreibt Lennés Tricks im Umgang mit seinen Königen und auch mit seinen Kollegen. Lenné muss sich, über die Jahrzehnte, mehrmals auf neue Regenten einstellen. Er hat klare „Verschönerungspläne“ und will deren Umsetzung erreichen.
Er gestaltet die Landschaft, wissend, dass sie auf das menschliche Gemüt eine große Wirkung ausübt. Angestellt ist er als Beamter der preußischen Könige, aber er beginnt früh, über die Grenzen deren Schlossgärten hinaus, die Folgen der Verstädterung gerade für die nicht-adligen Menschen zu sehen, und er versucht, dem gegenzuwirken: Schon 1840 legt er seine „Projectirten Schmuck- und Grenzzüge von Berlin und seiner Umgebung“ vor. Tiergarten, Zoo, Humboldthain werden nach und nach, teils nach seinem Tode von seinen Schülern, umgesetzt. In Magdeburg, Köln und Dresden, um nur einige zu nennen, entstehen öffentlich zugängliche Gärten. Ein Kapitel des Buches heißt: Der Volkspark. Die Idee des Volksparks kommt aus England, später auch die Ballspiele, für die in den Parks Plätze geschaffen wurden.
Bei besonderen Gartenvorhaben kennt Ohff jedes Detail, als Beispiel mag das Projekt von Schloss und Park Babelsberg dienen, wo die übliche Rivalität zu Pückler auch mal zu dessen Obsiegen führte (was ich beim Besuch der Ausstellung vor einigen Jahren nicht verstanden hatte). Augusta, die Gattin des Hausherrn hatte viele, oft wechselnde Vorstellungen, mit denen Pückler, als „Homme de femme par exellence“ besser umgehen konnte als Lenné. Pückler, der selbstbewusste Aristokrat, machte sich zeitlebens gern über Lenné lustig. Schon der Name! Er kommt eigentlich, wie dessen Vorfahren, aus dem französisch sprachigen Belgien: Le nain, (der Zwerg) daraus macht Pückler „laine“ (Wolle).
Zwischendurch wird er als Mensch beschrieben, seine Treue zu „Fritzchen,“ seiner Ehefrau, zu seinen Gefährten, von denen einige zu Duzfreunden werden. Außerdem war er „Frühaufsteher, Weintrinker, mit einer Vorliebe zu Mosel und Rhein, Hundeliebhaber“ insgesamt ein geselliger Mensch, der dazu auch noch gerne sang. Und er unterstützte Arbeitervereinigungen, manche der späteren Tätigkeiten in Berlin, wo er „Buddelpeter“ genannt wurde, werden von Ohff als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beschrieben.
Nachdem der Prinzregent Wilhelm 1861 zum König gekrönt wurde, spielten Lennés Verschönerungspläne für die Entwicklung Berlin keine Rolle mehr, Berlin wurde immer mehr zur Steinwüste. Nach seinem Tod wurde Lenné auf dem Bornstedter Friedhof im Bereich des privaten Sello-Friedhofs mit anderen Gärtnern des preußischen Hofes begraben.
Für Lenné begannen die Ehrungen: Ehrendoktor in Breslau und viele andere. Und doch stecken in vielen seiner Werke noch seine „Verschönerungspläne“. „Als Schwärmer ein Praktikus und als Praktikus ein Schwärmer, vollendet er den klassischen Landschaftsgarten, zumindest auf dem Kontinent, und verwandelt ihn gleichzeitig zur Grün-Oase für den luft- und baumhungrigen Menschen der großen Städte.“ Das Buch endet mit einem Gedicht eines ehemaligen Gartendirektors, das Michael Seiler gewidmet ist. Hier die letzten Strophen:
„Laut Stadtplan läuft die Friedrich-Ebert-Straße
Exakt in Flucht der alten Hauptallee;
(hier stand vielleicht einmal die Marmorvase).
Auf Luftaufnahmen kurz nach dem ersten Schnee,
beziehungsweise in der Wachstumsphase,
erkennt man noch die Wege von Lenné.“
Abgerundet wird das Büchlein durch eine Auflistung der Jahreszahlen zur Entwicklung von Landschaftsgärten, denen seiner Biografie, einer Literaturliste und einem Personenregister.
 Das Buch war mein letzter Versuch, mich mit Dahlien zu versöhnen, und es hat funktioniert! Die Autorin hat in diesem kleinen Büchlein auf gut hundert Seiten nicht nur ihre Lieblingsdahlien vorgestellt, sondern auch Pflegeanleitungen gegeben, mit denen ich etwas anfangen kann.
Das Buch war mein letzter Versuch, mich mit Dahlien zu versöhnen, und es hat funktioniert! Die Autorin hat in diesem kleinen Büchlein auf gut hundert Seiten nicht nur ihre Lieblingsdahlien vorgestellt, sondern auch Pflegeanleitungen gegeben, mit denen ich etwas anfangen kann.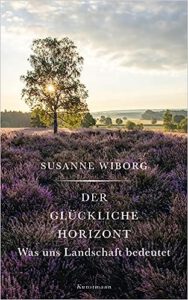 Dieses Buch Der glückliche Horizont: Was uns Landschaft bedeutet lese ich seit vielen Monaten mit wachsender Begeisterung: Es kommt mit einem breiten Wissen daher, mit vielschichtigen Beobachtungen und Reflexionen, immer neuen Aspekten, es ist kein Buch zum Auslesen. Die Kolumnen der Autorin über ihren Garten mit seinen vielen Gästen mag ich seit Langem. Nun kommt die Bewunderung für ihre Kenntnisse der Literatur zu Landschaften, in allen Epochen der Literatur, aber auch das naturwissenschaftliche und geschichtliche Wissen.
Dieses Buch Der glückliche Horizont: Was uns Landschaft bedeutet lese ich seit vielen Monaten mit wachsender Begeisterung: Es kommt mit einem breiten Wissen daher, mit vielschichtigen Beobachtungen und Reflexionen, immer neuen Aspekten, es ist kein Buch zum Auslesen. Die Kolumnen der Autorin über ihren Garten mit seinen vielen Gästen mag ich seit Langem. Nun kommt die Bewunderung für ihre Kenntnisse der Literatur zu Landschaften, in allen Epochen der Literatur, aber auch das naturwissenschaftliche und geschichtliche Wissen. Das Buch Gärten des Jahres 2023 ist das Ergebnis des jährlichen Wettbewerbes, fünfzig Gärten werden vorgestellt: der des Preisträgers, vier Gärten mit Anerkennungen und die restlichen 45 als Projekte. Die Texte sind von Frau Neubauer geschrieben, das Vorwort von
Das Buch Gärten des Jahres 2023 ist das Ergebnis des jährlichen Wettbewerbes, fünfzig Gärten werden vorgestellt: der des Preisträgers, vier Gärten mit Anerkennungen und die restlichen 45 als Projekte. Die Texte sind von Frau Neubauer geschrieben, das Vorwort von 





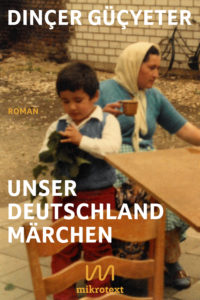 Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.
Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.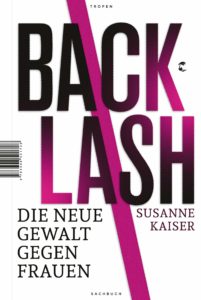 Das Buch Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen beschreibt Gewalt gegen Frauen als eine neue Qualität, es sei keine Pendelbewegung, in dem Sinne, dass es nach Fortschritten auch immer Rückschritte gibt, sondern ein Paradox: Je mehr Rechte Frauen haben, umso mehr Hass und Gewalt entwickeln Männer ihnen gegenüber.
Das Buch Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen beschreibt Gewalt gegen Frauen als eine neue Qualität, es sei keine Pendelbewegung, in dem Sinne, dass es nach Fortschritten auch immer Rückschritte gibt, sondern ein Paradox: Je mehr Rechte Frauen haben, umso mehr Hass und Gewalt entwickeln Männer ihnen gegenüber. Nachdem ich verstanden hatte, dass wir gerade hier, im Nordosten Deutschlands, mit immer weniger Wasser auskommen müssen, recherchierte ich in dieser Richtung und hörte immer öfter Beth Chattos Namen: auf der Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung der
Nachdem ich verstanden hatte, dass wir gerade hier, im Nordosten Deutschlands, mit immer weniger Wasser auskommen müssen, recherchierte ich in dieser Richtung und hörte immer öfter Beth Chattos Namen: auf der Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung der 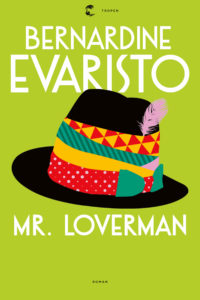 Es ist das dritte Buch von Bernhardine Evaristo, das ich las. Hier stellt sie einen kleineren Kreis eng verflochtener Menschen vor, die in der westindischen Community in London leben. Jeder/m lässt sie ihre/seine Würde und Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Neben den hier näher beschriebenen Protagonisten gilt das auch für die Töchter des Paares und den Geliebten Morris.
Es ist das dritte Buch von Bernhardine Evaristo, das ich las. Hier stellt sie einen kleineren Kreis eng verflochtener Menschen vor, die in der westindischen Community in London leben. Jeder/m lässt sie ihre/seine Würde und Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Neben den hier näher beschriebenen Protagonisten gilt das auch für die Töchter des Paares und den Geliebten Morris.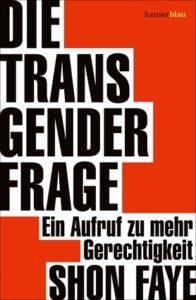 Nach Lektüre (und Rezension bei Literaturzeitschrift.de) des Buches
Nach Lektüre (und Rezension bei Literaturzeitschrift.de) des Buches  Dieses kleine Büchlein von knapp 150 Seiten hat es in sich: Géza von Cziffra hielt sich von 1923 bis 1933 regelmäßig im Romanischen Café auf, traf Gott und die Welt und sammelte Anekdoten. Das Namensregister umfasst bald 300 Einträge und die Seitenzahlen sind aufgelistet, wann die Personen auftraten, oder auch nur zitiert wurden: Shakespeare und Goethe sind dabei. Es erschien 1981, als der Autor über achtzig war und die Geschichte über diese Zeit hinweggegangen war, unter dem Titel „Die Kuh im Kaffeehaus“. So kann er Vergleiche mit der damaligen Jetztzeit anstellen, als es schon Groupies und Hippies gab.
Dieses kleine Büchlein von knapp 150 Seiten hat es in sich: Géza von Cziffra hielt sich von 1923 bis 1933 regelmäßig im Romanischen Café auf, traf Gott und die Welt und sammelte Anekdoten. Das Namensregister umfasst bald 300 Einträge und die Seitenzahlen sind aufgelistet, wann die Personen auftraten, oder auch nur zitiert wurden: Shakespeare und Goethe sind dabei. Es erschien 1981, als der Autor über achtzig war und die Geschichte über diese Zeit hinweggegangen war, unter dem Titel „Die Kuh im Kaffeehaus“. So kann er Vergleiche mit der damaligen Jetztzeit anstellen, als es schon Groupies und Hippies gab.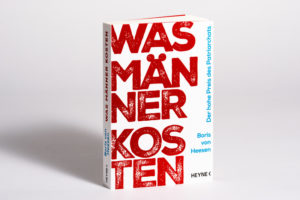 Schon immer waren Ihnen Männer lieb und teuer? Aber wie viel sie unsere Gesellschaft wirklich kosten, ahnt niemand und man staunt beim Lesen des Buches. Der Autor ist Volkswirt und hat seit Jahrzehnten in der Jugendarbeit Erfahrungen gesammelt, zunehmend berät er Männer, die ihre Rolle in der Gesellschaft nicht gefunden haben.
Schon immer waren Ihnen Männer lieb und teuer? Aber wie viel sie unsere Gesellschaft wirklich kosten, ahnt niemand und man staunt beim Lesen des Buches. Der Autor ist Volkswirt und hat seit Jahrzehnten in der Jugendarbeit Erfahrungen gesammelt, zunehmend berät er Männer, die ihre Rolle in der Gesellschaft nicht gefunden haben.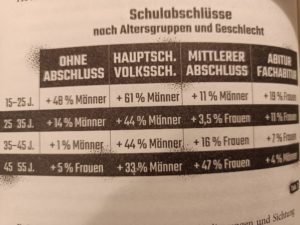
 Im Vorwort verteilt Luisas Oma selbst gestaltete Postkarten vor dem Eingang des Hamburger Botanischen Gartens: „Niemand macht einen größeren Fehler, als derjenige, der gar nichts macht, weil er nicht alles machen kann.“ Auf der Vorderseite ein Foto von einem übergewichtigen Adam, der in einen Apfel beißt: „Adam plündert sein Paradies“ heißt die Statue, die dort, am Eingangstor, steht. Hinten sind der Spruch des Philosophen Burke und ein Link zu einer Webseite, die über Ökostromanbieter informiert. Und das im ersten Jahr der Pandemie, sie ist Mitte Achtzig.
Im Vorwort verteilt Luisas Oma selbst gestaltete Postkarten vor dem Eingang des Hamburger Botanischen Gartens: „Niemand macht einen größeren Fehler, als derjenige, der gar nichts macht, weil er nicht alles machen kann.“ Auf der Vorderseite ein Foto von einem übergewichtigen Adam, der in einen Apfel beißt: „Adam plündert sein Paradies“ heißt die Statue, die dort, am Eingangstor, steht. Hinten sind der Spruch des Philosophen Burke und ein Link zu einer Webseite, die über Ökostromanbieter informiert. Und das im ersten Jahr der Pandemie, sie ist Mitte Achtzig.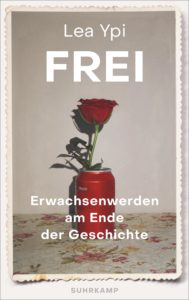 Es geht um Freiheiten und wie sie sich beim Erwachsenwerden ändern. Das Buch gefiel anfangs, weil es die Gedanken und Gefühle eines kleinen Mädchens beschreibt, das im stalinistischen Albanien aufwuchs. Sie liebte ihre Lehrerin, die so schöne Geschichte von Stalin erzählte, und auch den Onkel Hoxha. Und die Lehrerin konnte so gut erklären, dass es im Sozialismus noch Klassenkämpfe geben muss, aber im Kommunismus wären dann alle absolut frei. Ihre Eltern und die Großmutter waren auch Sozialisten, jeder hatte eine Lieblingsrevolution, der Vater liebte die, die noch kommen sollte. Aber, warum wollten die Eltern kein Bild vom Präsidenten Enver Hoxha im Wohnzimmer haben?
Es geht um Freiheiten und wie sie sich beim Erwachsenwerden ändern. Das Buch gefiel anfangs, weil es die Gedanken und Gefühle eines kleinen Mädchens beschreibt, das im stalinistischen Albanien aufwuchs. Sie liebte ihre Lehrerin, die so schöne Geschichte von Stalin erzählte, und auch den Onkel Hoxha. Und die Lehrerin konnte so gut erklären, dass es im Sozialismus noch Klassenkämpfe geben muss, aber im Kommunismus wären dann alle absolut frei. Ihre Eltern und die Großmutter waren auch Sozialisten, jeder hatte eine Lieblingsrevolution, der Vater liebte die, die noch kommen sollte. Aber, warum wollten die Eltern kein Bild vom Präsidenten Enver Hoxha im Wohnzimmer haben?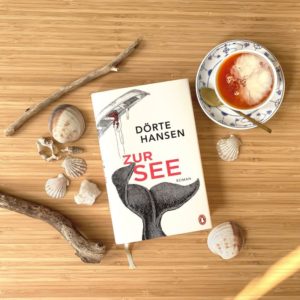 In ihren anderen Büchern ging es um das Landleben und, wie Menschen sich ändern müssen, um dort zu leben: Im Alten Land suchen Vertriebene eine neue Heimat und bleiben fremd, in der Mittagsstunde flieht ein Einheimischer in die Stadt, aber kommt immer wieder zurück und beobachtet, wer und was sich ändert. (link Landlust und Landfrust) In Zur See bleiben die Inselbewohner der Heimat treu und erleben, wie das Meer auch andere in seinen Bann zieht. Aber auch, was sich hier alles ändert. Da sind alte Geschichten zu erzählen, von Männern, die zur See gingen und von großen Fluten. Wir leben mit den Menschen auch in der Winterzeit, sehen wie die Gewerke der Fischer und Bauern sich ändern und lernen, wie der Zeitplan der Fähre das Leben bestimmen kann.
In ihren anderen Büchern ging es um das Landleben und, wie Menschen sich ändern müssen, um dort zu leben: Im Alten Land suchen Vertriebene eine neue Heimat und bleiben fremd, in der Mittagsstunde flieht ein Einheimischer in die Stadt, aber kommt immer wieder zurück und beobachtet, wer und was sich ändert. (link Landlust und Landfrust) In Zur See bleiben die Inselbewohner der Heimat treu und erleben, wie das Meer auch andere in seinen Bann zieht. Aber auch, was sich hier alles ändert. Da sind alte Geschichten zu erzählen, von Männern, die zur See gingen und von großen Fluten. Wir leben mit den Menschen auch in der Winterzeit, sehen wie die Gewerke der Fischer und Bauern sich ändern und lernen, wie der Zeitplan der Fähre das Leben bestimmen kann. Für diese Rezension von Lebendige Gärten im Winter habe ich lange gebraucht, und sie ist sehr persönlich geworden: Während der ersten Jahrzehnte meines Gärtnerinnenlebens galt für mich Klaus Foersters Spruch: „Es wird durchgeblüht!” als Leitmotto. Darum geht es auch in meinem Buch „Blütenfreuden“. Ich habe noch einmal die beiden Kapitel zum
Für diese Rezension von Lebendige Gärten im Winter habe ich lange gebraucht, und sie ist sehr persönlich geworden: Während der ersten Jahrzehnte meines Gärtnerinnenlebens galt für mich Klaus Foersters Spruch: „Es wird durchgeblüht!” als Leitmotto. Darum geht es auch in meinem Buch „Blütenfreuden“. Ich habe noch einmal die beiden Kapitel zum