 Als Fan von Bernhardine Evaristo hatte ich die Erwartung, in diesem Buch etwas zu lesen, was originell und witzig ist, aber auch geprägt von der Lebenserfahrung einer Frau an der Schwelle zum Rentenalter. Vielleicht in Richtung Altersmilde?
Als Fan von Bernhardine Evaristo hatte ich die Erwartung, in diesem Buch etwas zu lesen, was originell und witzig ist, aber auch geprägt von der Lebenserfahrung einer Frau an der Schwelle zum Rentenalter. Vielleicht in Richtung Altersmilde?
Stattdessen lese ich von Zuleika, auf Arabisch: die Verführerin, einer strahlenden Schönheit mit den Gedanken eines meinungsstarken Teenagers. Sie macht sich über alle Erwachsenen lustig, die Eltern, aber vor allem über den reichen Römer, alt und fett, der sie, die Schwarze geheiratet hatte, als sie noch nicht einmal ein Teenager war. Und dann ist Alles noch in Versform geschrieben!
Sie lebt in Londinum, als die Stadt von den Römern besetzt war, ihre Eltern sind Migranten aus dem Sudan; der Vater ist ein inzwischen arrivierter Kaufmann, der stolz ist, seine Tochter so gut verheiratet zu haben.
Felix, der Gatte, ist meist geschäftlich unterwegs, sie langweilt sich in ihrem Palazzo, mit diesen ganzen Dienstboten. Sie lernt Latein, liest die Klassiker, die es 200 Jahre vor Christus gab—und macht gerne lateinische Einschiebsel in ihren Texten. Das Buch ist in Kapiteln geschrieben, die einzelne Gedanken ausführen, manchmal nur in der Länge eines Gedichtes. Den roten Faden muss die Leserin sich erspinnen.
In ihrem Netzwerk ist vor allem die Busenfreundin Alba, verheiratet und Mutter, und immer bereit zu Seitensprüngen, deren Schilderungen von Eroberungen sie gerne zuhört. Die findet:
„Ehrlich, kaum hat so‘n Mädchen bisschen Bildung,
wird gleich, das ganze Leben rasend kompliziert.
Du schürfst dermaßen tief, dabei ist die Lösung
ganz einfach: DU GEHÖRST MAL GUT GEFICKT!“
Das überzeugt Zuleika und sie sucht. Als sie sich in den Kaiser verliebt, der sie im Guildhall Theater lange und begehrend angeguckt hatte, wird darüber im „Dum vivimus, vivamus
(Solang wir leben, lasst uns leben)
ODER: GIRLS TALK
gesprochen, auch mit einer anderen Freundin, mit der älteren Venus, die sich gerne in Kneipen aufhält, in der „die Unterwelt“ verkehrt.
Derweil schickt der Kaiser ihr Blumen, die Tanio, der Diener, diskret überreicht. Sie hat bei Tanio etwas gut, hatte sie ihm doch die Frau vermittelt und ausgesucht, nach einer „Shortlist. meine Kriterien willkürlich angeordnet: Schönheit, Alter, Dispositio.“ Ein weiterer Vorzug von Mucia, der ausgesuchten Frau: „sie war schon so reif,
um die erkennbaren faschistischen Tendenzen
unseres versklavten Kleindiktators einzudämmen.“
Bei der Verliebten wird der Kaiser zum:
„Mein Legionarius: ich will dich auf zwei Weisen, leg den Lorbeerkranz ab, lass die lila Roben zu Boden und komm nackt zu mir als Mann…“
Sie lebt auf, gibt sich der Lust hin, in einem Gedicht gibt sie die Domina, die ihn fesselt und verlangt, dass er sie seine Herrscherin nennt, das bringt sie zum Höhepunkt.
Dabei weiß sie, dass Felix sie nun vergiften wird. Schon nach der Hochzeitsnacht spricht sie von Todessehnsucht. Und so kommt es, Tanio verabreicht ihr Arsen, und als Alba sie noch einmal besucht, ergibt sie sich dem Schicksal, als wäre sie eine griechische Tragödin. Und dann gibt es einen Epilog: Vivat Zuleika.
Obwohl ich nicht zur Zielgruppe zähle, fand ich es immer wieder, wie erwartet, originell und witzig.
Das Lesen in Versform bin ich nicht gewöhnt. Hat die Übersetzerin Tanja Handels es gut gelöst? Zufällig war ich in England und wollte das Buch „Zuleika“ einsehen, im gut sortierten Buchladen war es nicht bekannt.
Der Grund: Es ist 2001 unter dem Titel „The Emperor’s Babe“ erschienen und nicht mehr bekannt. Nun grübele ich über die Frage, was Frau Evaristo mit Vierzig dazu brachte, so einen Backfischroman mit Sehnsucht nach Männern zu schreiben, nachdem sie selbst viele Jahre lang weibliche Sexpartner hatte. Wie ein recycelter Teenager? Aber inzwischen weiß ich: die Übersetzung von Frau Handels ist wieder sehr gut!
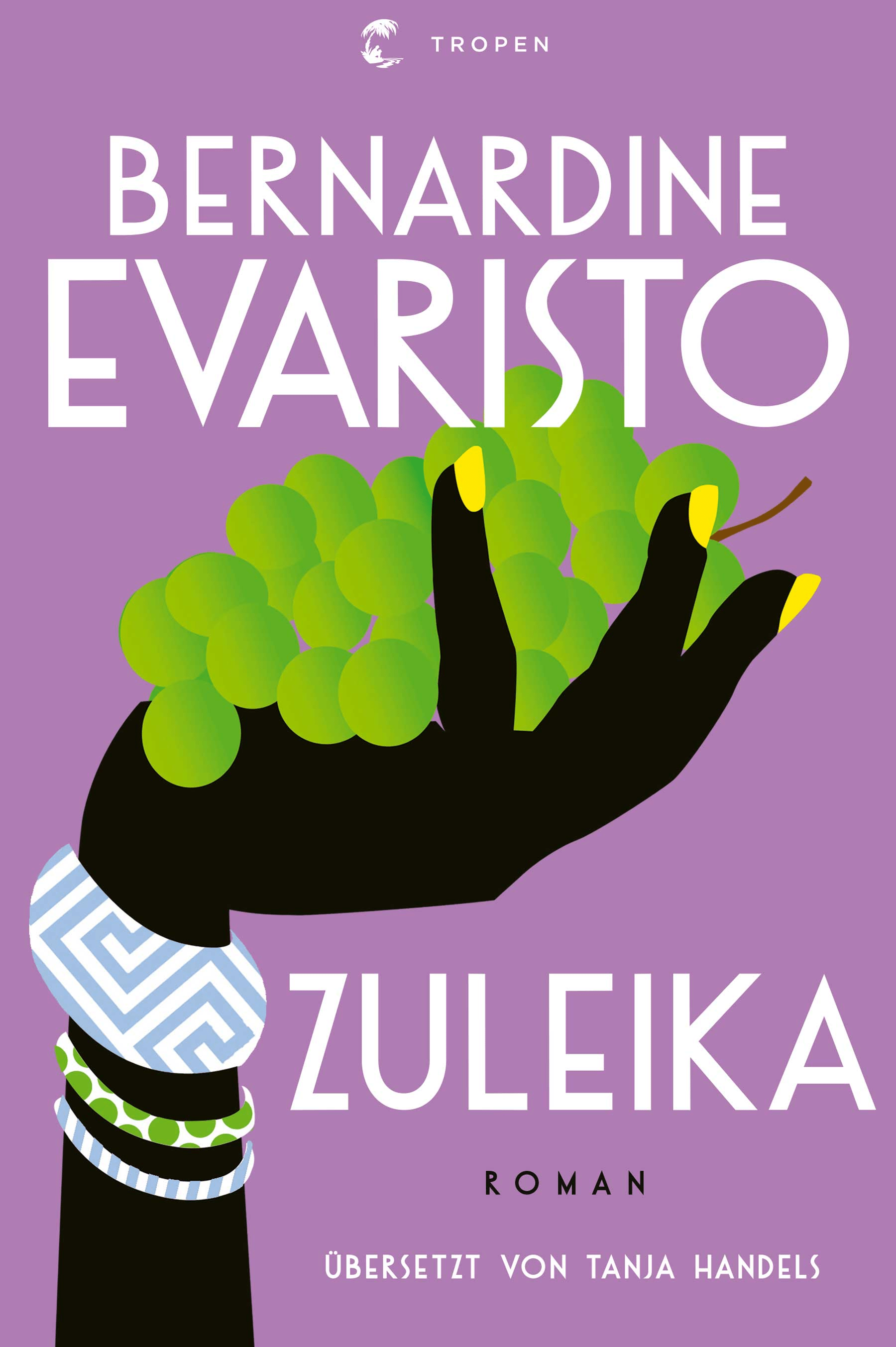
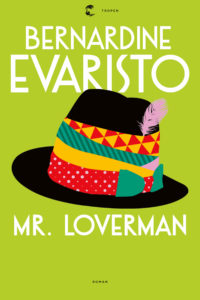 Es ist das dritte Buch von Bernhardine Evaristo, das ich las. Hier stellt sie einen kleineren Kreis eng verflochtener Menschen vor, die in der westindischen Community in London leben. Jeder/m lässt sie ihre/seine Würde und Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Neben den hier näher beschriebenen Protagonisten gilt das auch für die Töchter des Paares und den Geliebten Morris.
Es ist das dritte Buch von Bernhardine Evaristo, das ich las. Hier stellt sie einen kleineren Kreis eng verflochtener Menschen vor, die in der westindischen Community in London leben. Jeder/m lässt sie ihre/seine Würde und Eigenheiten, Stärken und Schwächen. Neben den hier näher beschriebenen Protagonisten gilt das auch für die Töchter des Paares und den Geliebten Morris.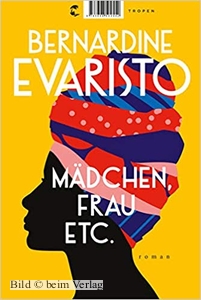 Dreadlocks etc.
Dreadlocks etc.