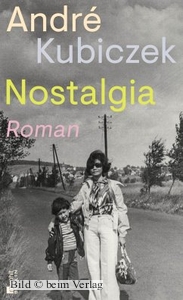 Hier also bin ich
Hier also bin ich
Der stark autografisch inspirierte Roman «Nostalgia» des Schriftstellers André Kubiczek, dessen Mutter aus Laos stammte, beginnt wie eine Coming-of-Age-Geschichte, um dann aus laotischer Perspektive ein Frauenschicksal zu schildern, wie es beklemmender kaum vorstellbar ist. Ohne aber, trotz des Titels, nostalgisch verklärt zu sein. Die ersten zwei Teile der vierteiligen Erzählung schildern aus der Sicht Andrés dessen Schulalltag in der Spätphase der DDR. Mit seinem asiatischen Aussehen ist er in Potsdam Hänseleien der Mitschüler ausgesetzt, aber auch Schikanen einer böswilligen Lehrerin. Der jüngere Bruder des Dreizehnjährigen ist geistig behindert. Nur nicht auffallen ist die Devise von André angesichts des Alltagsrassismus, dem er ausgesetzt ist, und deshalb achtet er strikt darauf, dass ja niemand etwas von der Behinderung seines Bruders erfährt, auch seine Freundin nicht. Es ist eine Geschichte, die einem unter die Haut geht, deren Tragik aber von einem wohltuend lockeren Erzählton angenehm kontrastiert wird.
Der in der DDR geborene André ist sehr zufrieden mit seinem Leben, er kommt in der Schule gut voran, hat viele Freunde, ist gerne auch bei den Großeltern zu Besuch und erlebt all jene für einen Heranwachsenden prägenden Ereignisse. Der Autor versteht es, diese Jugend derart authentisch zu schildern, dass man häufig auch an eigenes Erleben erinnert wird. Das klingt dann auch sprachlich nicht nur so unglaublich real, dass man die Gedankengänge des Jugendlichen, seine Wünsche und Träume, aber auch seine Ängste geradezu mitzuspüren glaubt, alles scheint außerdem auch dokumentarisch echt zu sein. Für die Wessis unter den Lesern wird die sozialistische Idylle mit ihren subtilen Gängelungen und dem gehirnwäsche-artigen, politischen Weltbild äußerst stimmig beschrieben. Insoweit ist dieses Buch nicht nur ein Entwicklungs-Roman, sondern auch ein DDR-Roman.
Das kommt dann auch im dritten Teil der Geschichte zum Tragen, wenn im Rückblick Teo, die laotischen Mutter, in den Fokus rückt. Sie stammt aus einer prominenten Familie, ihr Vater war bis zum kommunistischen Putsch 1975 Außenminister von Laos und wurde dann von der eigenen Leibgarde ermordet. Während ihres Studiums in Moskau hatte Teo ihren aus der DDR stammenden Mann kennen gelernt und ist ihm in seine Heimat gefolgt, wo sie geheiratet haben und wo schon bald auch ihre zwei Söhne geboren wurden. Andrés Vater strebt eine wissenschaftliche Karriere an und schreibt an seiner Doktorarbeit, die Mutter arbeitet, deutlich unterqualifiziert, als Dolmetscherin, bis ihr Vorgesetzter auch ihr den Weg zur Promotion öffnet. Sie erkrankt aber unheilbar an Krebs, und eines Tages erhält André, der inzwischen selbst studiert, ein Telegramm mit der Todesnachricht. Über seinen Kommilitonen, der ihm kondoliert, heiß es im Buch: «Jens weiß, wie es ist, keine Mutter zu haben. Er hat seine eigene vor Jahren an einen Mann verloren, der nicht sein Vater ist».
Derartig stimmige, lockere Formulierungen finden sich viele in diesem Roman, der die Chronologie virtuos negiert und dann am Schluss eben damit endet, dass die junge Teo mit ihrem Samsonite-Koffer, «der T34 unter den Koffern der Welt», wie ihr Mann meint, am Bahnhof ankommt. Sie war nach Moskau geflogen und mit dem Nachtzug nach Berlin weiter gefahren, wo sie der Vater ihres Mannes abholt. Sie tritt auf den Bahnhofs-Vorplatz und denkt: «Hier also bin ich». Mit ihrem ersten Schritt ins Unbekannte, in ein neues Leben für die junge Loatin, endet diese Geschichte schließlich, so paradox es scheint. Alle Figuren werden so lebensecht geschildert und sind durchweg so sympathisch, dass man sich nur schwer von ihnen trennen kann. Der Roman wurde für den Deutschen Buchpreis 2024 nominiert, man kann dem in Anbetracht seiner literarischen Qualitäten nur zustimmen!
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de
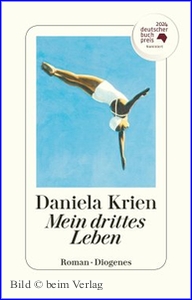 Trauer ohne Larmoyanz
Trauer ohne Larmoyanz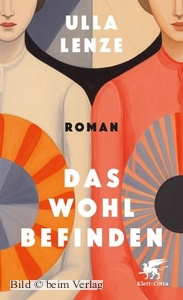
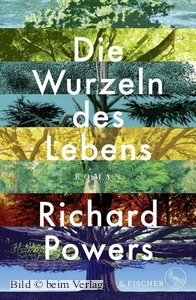 Staunend am Mammutbaum
Staunend am Mammutbaum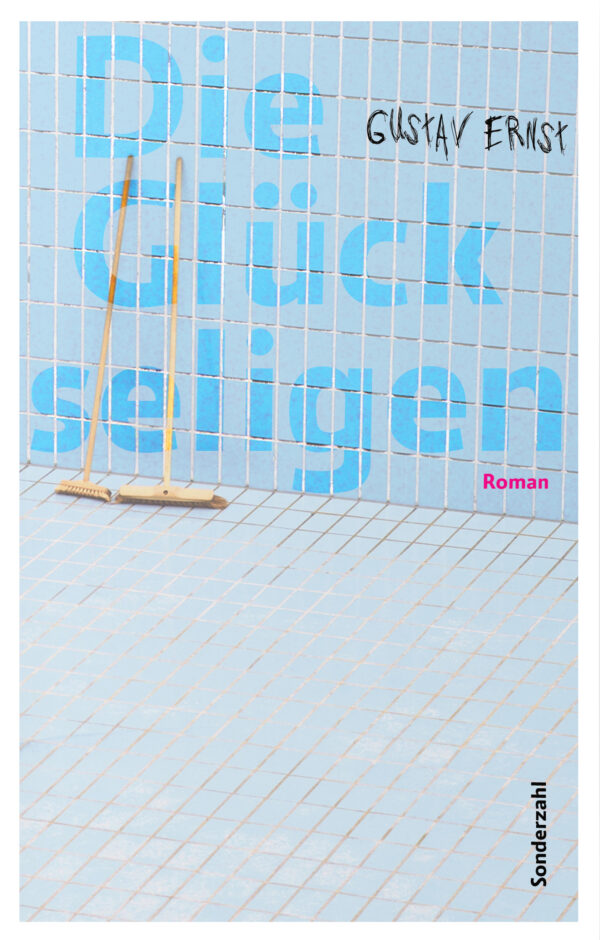
 Die Glückseligen. In insgesamt vier in ungleiche Längen unterteilte Kapitel erzählt Gustav Ernst die Geschichte von Ulrich und Rosanna, wobei letztere vielleicht gar nicht so heißt. Eine Satire voll bittersüßer Ironie, die die menschlichen Abgründe wie in Platons Höhlengleichnis hell ausleuchtet.
Die Glückseligen. In insgesamt vier in ungleiche Längen unterteilte Kapitel erzählt Gustav Ernst die Geschichte von Ulrich und Rosanna, wobei letztere vielleicht gar nicht so heißt. Eine Satire voll bittersüßer Ironie, die die menschlichen Abgründe wie in Platons Höhlengleichnis hell ausleuchtet. Unbegrenzte Gewalttätigkeit
Unbegrenzte Gewalttätigkeit No risk, no fun
No risk, no fun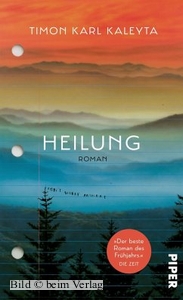 Vom Sinnsucher zum Bauernknecht
Vom Sinnsucher zum Bauernknecht
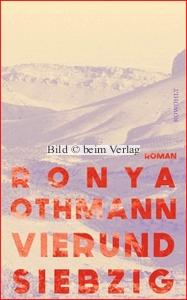 Nervige Arabesken
Nervige Arabesken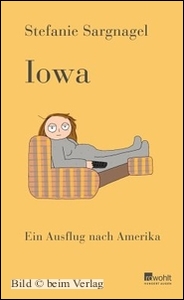 Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten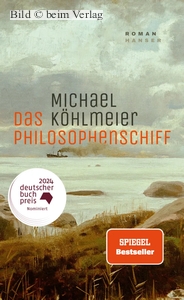 Falsch erzählt, aber gut erfunden
Falsch erzählt, aber gut erfunden Da capo
Da capo Glückliches Polen
Glückliches Polen Bei der Wahrheit Gottes
Bei der Wahrheit Gottes