SMRT HEISST DER TOD
Sarajevo 1995: Persönliche Anmerkungen zu einem wichtigen Buch
Vor mir liegt ein Buch, eine Romantrilogie, umfangreich, fast 500 Seiten dick, gewichtig und wichtig. ein Denk- und Literaturwerk. Jeder sollte es lesen, vor allem jene, die über ,,Jugoslawien“ reden und nichts wissen, nichts begreifen. Die Politiker sowieso; aber die lesen keine Bücher, jedenfalls nicht solche. Seinen Autor kenne ich nicht. jedenfalls ist mir eine Begegnung mit ihm nicht in Erinnerung. Oder sind wir uns doch einmal begegnet, im ehemaligen Jugoslawien, als es Jugoslawien noch gab? Haben sich unsere Wege doch vielleicht irgendwann einmal gekreuzt, ohne daß wir es wußten?
,,Der Balkan ist ein Wahnsinn“, sagte ich damals auf die Frage, wie es war, nachdem ich, vor jetzt mehr als dreißig Jahren, von einer wochenlangen Reise kreuz und quer per Autostopp durch dieses damalige Jugoslawien, ebenso durch Bulgarien und Griechenland. zurückgekommen war; mit Ausgangspunkt Paris. Und ich meinte damit: Die Länder und die Menschen dort sind etwas Großartiges, etwas voller Gegensätze, etwas Unbegreifliches, etwas Schwieriges etwas Abenteuerliches, etwas Wunderbares, etwas Unberechenbares, etwas Nicht-Normales, etwas Wahnsinniges auch, wie ich es formulierte. Aber in dem Sinne, wie es Alexis Sorbas im gleichnamigen Film meinte, als er seine Lebensformel ausdrückte mit dem wunderbaren Satz: ,,Weißt Du. Boß. ein bißchen Wahnsinn gehört einfach zum Leben dazu!“
Heute hat sich der Wahnsinn, ein anderer Wahnsinn, auf dem Balkan, in Ex-Jugoslawien, vor allem in Bosnien-Herzegowina, politisch, militärisch, in einer unbegreifbaren Täter- und Opferbilanz, in unbeschreiblichen, millionenfachen menschlichen, besser gesagt. in unmenschlichen Tragödien konkretisiert und manifestiert. Der Wahnsinn durch völlige Verblendung und den Verlust aller Maßstäbe und der Menschlichkeit. Der grenzenlose Fanatismus ist sichtbar, ist wirksam, ist zur schrecklichen Wirklichkeit geworden. Von diesem Wahnsinn spricht der Autor in diesem Buch.
DER SCHNAPS
„Ich sehe den kotigen Bauernhof beleuchtet vom Feuer. das in seiner Mitte brennt, dort, wo einst, so scheint es, ein kleiner Garten mit Blumen war. Im Hintergrund steht ein niedriger Stall mit dunklen Fenstern und einem Tor, unbeschädigt. Das Feuer flimmert in der windlosen Luft, dunkle Schatten bewegen sich drohend überall ringsum. Vor dem Feuer, uns den Rücken zugewandt, sitzen drei Männer in Tarnuniformen. zurückgelehnt auf zerbrochenen, knirschenden Stühlen. Sie sind nur Umrisse ohne Gesichter, dunkle Massen vor dem Licht. Der vierte liegt vor ihren Füßen im Schlamm ausgestreckt und schläft. Er schnarcht, wie jeder Säufer. Und der fünfte hockt neben dem Feuer und schürt es mit einem angebrannten Holzstück. Von der Seite gesehen ist sein Gesicht stumpf, länglich. grimassierend und sein Schädel kahl. Um das Feuer herum haben sie geteerte Pfähle gestellt. Sie stützen ein Metallgitter. das das Feuer von unten beleckt. Hört es auf, legt der, der davorhockt, ein Scheit zu und schürt es. Und auf dem Metallgitter, festgebunden oder hilflos, liegt ein Mädchen, es ist klein, vielleicht nicht einmal zehn Jahre alt. Die eine seiner Hände kreist, als verteidige es sich, und sein Bein zuckt. Sein Fleisch riechen wir die ganze Zeit über, wie es brennt, wie es langsam gebraten wird. Aus seinem Mund kommt dieses langgezogene Jammern, das langsam schwächer wird. Sein Mund ist unbeweglich. offen, und das Winseln bricht hervor wie ein besonderer und unsichtbarer Schmerz, breitet sich aus und umfaßt uns alle. „Langsam geht das bei dir, Bruce Lee“, sagt einer von den Sitzenden. „Mensch. der Schnaps wird alle.“
Was sind das für Menschen, die so etwas tun? Sind das überhaupt noch Menschen? Wie konnten sie zu solchen Monstern werden? Sind sie alle mitsamt Abartige. Perverse, grenzenlose Sadisten, Ungeheuer’? Waren sie das schonimmer, haben sich da nur Gleichgesinnte zusammengetan zu einer infaernalischen Todesschwadron? Oder waren sie früher „normale Menschen“, zwar zum und zur Gewalt veranlagt, aber in den Schranken einer zivilisierten Gesellschaft gezwungenerweise diszipliniert, wie Raubtiere im Käfig? Und dann hat man die Gitter weggenommen. Und die Menschen-Raubtiere leben ihre Instinkte aus. Aber warum gegen ein wehrloses Mädchen, das man auf dem Feuer röstet und schmort, wie wie ein Schwein; das lebendig ist, das noch lebt!
So einfach diese Fragen gestellt sind, so einfach sind jedoch die Antworten darauf nicht. Und e i n e Antwort darauf gibt überhaupt nicht. Die Wirklichkeit ist vielschichtiger. Die Wahrheit liegt nicht im Entweder-Oder, entweder gut oder böse. So einfach ist es nicht mit dem mit Menschen, mit der Wirklichkeit des Menschen, mit seiner Wahrheit, und dem, was wir oft so schlichtweg als „Wahrheit“ bezeichnen und benennen.
Denn auch diese Monster waren einmal ganz normale Menschen, sie waren einmal Kinder; vielleicht mit einer gewissen Disposition zu dem oder jenem, aufgrund von Wesens- und Charaktereigenschaften. Vielleicht hat jeder von Ihnen irgendein Kindheitstrauma, hatte Erlebnisse, die ihn geprägt, vielleicht traumatisiert und stigmatisiert haben. Jeder hatte ein anderes Lebensschicksal in seinem Vorleben. Aber irgendwann muß es etwas gegeben, haben, das entscheidend war dafür, daß ihr Weg in diesen Abgrund geführt hat. Was war das, was kann das gewesen sein? War das bei allen etwas Verschiedenes oder bei allen das Gleiche? Oder etwas von diesem und einem anderen? Oder gibt es ein Prinzip Gut und ein Prinzip Böse, das sich wahllos, aber bestimmend festsetzt in der Seele des Menschen, so seine Personifizierung vollzieht? Was ist dann mit der Freiheit des Menschen, mit seiner Verantwortlichkeit?
Oder ist alles anders? Ist alles Manipulation, Ergebnis einer ungeheheuerlichen Manipulation, die mit den Menschen, mit Einzelnen sowie mit der Masse geschieht? Wieweit ist der Mensch manipulierbar, über seine – angenommenen – Grenzen hinsud, und wodurch, womit. und wann, und wie; und unter welchen Bedingungen, mit welchen Lügen, mit welcher Propaganda; für welche Ziele?
Die Menschheitsgeschichte und dieses Buch geben die Antwort: Es gibt keinerlei Bescgränkung. Der Mensch ist zu allem fähig. Und er glaubt die Lüge eher als die Wahrheit. Und er ist begeisterungsfähig in seinem Wahnwitz bis zum Irrsinn. Und er ist zu allem bereit. Nicht jeder, nicht jeder Einzelne, aber doch auch so ungeheuer viele Einzelne, wenn es die Masse gibt. Und einen Führer. ,,Führer. wir folgen Dir!“ – egal. wie der Führer heißt. Und es gibt sie immer, es gibt sie immer wieder: diese Führer! Und ein Volk. das sie vergöttert. und das sie belügen. Und das sie in den Abgrund reißen. Aber das Volk, das ihnen und ihrer ihrer Propaganda glaubt. Das Volk liebt seine Führer, immer!
DER WAHNSINN
Die Führer in diesem Land und in diesem Buch heißen: der Präsident, der Kommandant, der Hauptmann, Duc; auf der einen Seite. Auf der anderen Seite: der Meister, der den Gottesstaat predigt. Was für die einen die Masse, das Volk, die Brüder sind, das sind für den anderen die Glaubensanhänger, die Rechtgläubigen. Wie bei den einen ein völlig irrationaler, ja pathologischer, aber gezielt eingesetzter und mit allen Mitteln der Propaganda verbreiteter Blut-Boden-Heimat-Volk-Mythos voll bekannter rassistischer Ideologie zur Grundlage ihrer Denkstruktur und ihres Handlungsprinzips wird, aus dem sie alles weitere ableiten, so wird bei den anderen, dem Meister und seinen Anhängern des islamischen Fundamentalismus. die Struktur eines ebenso irrationalen Dogmatismus. hier jedoch noch mit göttlicher, überirdischer Dimension. sichtbar und wirksam. In beiden Fällen. beim völkisch-rassistischen Mythos ebenso wie beim politischen Religionsfundamentalismus, handelt es sich um das gleiche, kommt es auf das eine hinaus: Auf die Installierung einer absolut gesetzten oder sich selbst absolut setzenden Macht und Instanz über den Menschen, über den einzelnen Menschen, über das Individuum; auf die Schaffung eines Über-Ich. Das bedeutet den Kampf und die Zerstörung der Souveränität des Individuums mit allen Mitteln durch die Führer und Machthaber. Das bedeutet die zum Ziel gesetzte Vernichtung jeder individuellen Freiheit. Das bedeutet aber auch, daß der Einzelne keinerlei Verantwortung mehr in ethischer oder moralischer Hinsicht zu tragen hat. Die wird ihm abgenommen, von den Führern, von der Ideologie, von Gott; auf der Ebene dieser Dogmatik.
Aber es gibt auch Widerstand; und das bedeutet Hoffnung, jedenfalls einen Lichtblick. Der kommt von jenen, die frei sind, die innerlich frei sind, weil sie sich freigemacht haben von jeder Unterdrückung; weil sie die alles beherrschende Propaganda als ein Instrument der Vereinnahmung und Versklavung, der systematischen Verdummung, als das, was sie ist: eine einzige große absurde Lüge, erkannt haben und ihr nicht auf dem Leim gegangen sind; weil ihre Individualität, ihre selbst-gebildete Persönlichkeit stärker war als die Doktrin, als jede Demagogie. Eine dieser Individualisten ist in diesem Buch jene selbstbewußte junge Intellektuelle, die Geliebte eines islamischen Gotteskämpfers. der dieser hörig ist, von der er sagt: ,,Meine Geliebte – oder meine Freundin, wie sie selbst sagte – gehörte durch ihre Geburt nicht zu unserem Volk. Ihr Vater war seiner Herkunft nach ein Orthodoxer, ihre Mutter hatte katholische Vorfahren; beide Eltern waren, wie ich erfuhr, Ungläubige, Atheisten, wie einst ich auch. Meine Geliebte fühlte sich keinem Glauben zugehörig, sie wollte einfach nirgendwo dazugehören; sie hielt sich für eine Person ohne Volk, ohne Partei. sie kam aus einer bürgerlichen Welt.“ Und diese junge Frau sagt ihm ganz unverblümt und scharf das Richtige, die Wahrheit, die sie aus ihrer Wirklichkeit erkennt und ableitet: „Ich habe nie mit dem Volk Kaffee getrunken … Und ich habe mich nie von ihm ficken lassen. Es war immer ein einzelner eine Person, mein Lieber. Wir sind entweder Individuen oder nichts. Ich bin ich, du bist du. Warum willst du etwas Drittes sein, etwas Unpersönliches, Leeres?“ – Das also ist es, die Individualität allein, jedenfalls als ein souveränes Ich verstanden, die uns als Person, als Persönlichkeit ausmacht, die der Gegenpol zu Masse und Macht ist, die den menschlichen Grundwert individuelle Freiheit gegen jede Bevormundung, Entmündigung und Versklavung, sei es durch Ideologie oder religiösen Fundamentalismus und Fanatismus, gegen Führer. Volk und sogenannte Gottesmänner verteidigt. Sie ist die einzige Hoffnung, der einzige Lichtblick, die einzige Chance, vielleicht die einzige Möglichkeit zur Freiheit, zur Befreiung von und aus diesem Wahnsinn. Und das wissen die Führer und ihre Komplizen. Deshalb gilt ihr fanatischer und rücksichtsloser Kampf solchen Individualisten, die das Getriebe der Macht stören oder stören könnten. und die es auszuschalten gilt, um jeden Preis, mit allen Mitteln. Denn sie sind der einzige, wirkliche Feind, den sie nicht brauchen können, den sie nicht brauchen können im Krieg gegen den Menschen.
Die im Buch skizzierten Führerfiguren sind in ihrer Porträtähnlichkeit unschwer als historische bzw. als wirkliche Personen zu erkennen. Wir kennen sie aus der Geschichte, aus Zeitungen und vom Femsehbildschirm her, aus den Medienberichten. Wir kennen ihre Namen oder jene, die sie anstatt ihrer wirklichen von früher dann angenommen haben. Josip Broz Tito – als historische Legendenfigur. Slobodan Milosević – der Ministerpräsident. Radovan Karadžiž – der Dichter und Psychiater als Volksführer und Volkspolitiker. General Mladić – als Kommandant. Und Vojislav Šeššelj -der Ultranationalist, der aus dem Ausland kam. Und die Kriegsverbrecher als Kommandanten berüchtigter Sonderkommandos, autonomer Militäreinheiten; richtiger genannt: Mörderbanden. Ihre ruhmreichen (angenommenen) Namen kennt jedermann, kennt dort jedes Kind: Arkan und Dragan. Sogar ein früherer echter Staatspräsident kommt vor, als Zwischenszenespiel in diesem Buch sowie im wirklichen politischen Geschehen damals auch: Dobrica ČČosic, der „verborgene“ Präsident im Buch genannt, der große Schriftsteller seiner Nation. Dieser Präsident aus dem Buch sitzt allein in den Palastgemächern in seiner Residenz und brabbelt senil vor sich hin, aber formuliert wahnwitzige und somit verfühererische und gefährliche Denkinhalte, wenn er ,,unvölkische Elemente“ ausmacht und bekennt: ,,Das Volk hat immer recht.“ Und wenn er von den ,,Strahlen des Patriotismus“ faselt, ,,die jeden Menschen sofort zu neuem Leben erwecken und ihn mit seinen Ahnen verbinden.“ Und natürlich sieht er vor seinen geistigen Augen ,,die Wiedergeburt der Nation“ und den nahenden .,Endsieg“. Das alles erscheint uns sehr bekannt. Weniger bekannt zu sein scheinen die Studien des Nationaldichters und Zwischenpräsidenten, die dieser wirkliche Dobrica Čosić schon lange vor dem sogenannten ,,Krieg“ – welches Wort ja immer nur als Metapher, als Verschleierungsvokabel für staatlich sanktionierten Massenmord und Genozid verwendet wird – bei einer der sogenannten Kommissionen der Akademie der Wissenschaften und Künste in Belgrad eingereicht und damit große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Naja, solche „geistigen Wegbereiter“ gab es schon immer. Und fühlen sich auch nie mitschuldig und werden auch nie schuldiggesprochen.
Das sei gesagt, damit niemand glaubt, daß dieser Wahnsinn nur ein Wahnsinn von Dummen ist. Da ist große Intelligenz mit im Spiel. Aber diese schließt Verblendung eben nicht aus, den Verlust des normalen Verstandes, der eigenen kritischen Vernunft.
DER MORD
Da ist dieser Duc schon ein anderer, ein ganz anderer. Der braucht keine pseudophilosophische Absurddialektik, kein Geschwätz von Völkischem. Heroischem, von sogenannten historischen Rechten (,,Wo die Gräber der Unsrigen sind, dort sind unsere Grenzen.“). Der braucht keine Scheinargumentation für das, was er erreichen, besitzen, ausüben und behalten will, nämlich die absolute, ungeteilte Macht in seiner Hand. in seiner Person. Der meldet seinen Anspruch ohne Umwege und Verschleierung. ohne langes Herumgerede an. ,,Mein einziges Ziel ist die Macht’, bekennt er. Er spuckt auf ,,diese Hohlköpfe, die das Volk ausmachen.“ Denn, so sieht er es, und vielleicht sieht er es richtig: daß das, ,,was Volk genannt wird, eigentlich aber nur ein schreiender Haufen ist. der etwas fordert und nimmt, was du ihm gibst, und schweigt und nichts sonst.“ Er scheint ein Zyniker zu sein in diesem Szenario, aber er ist der einzig ,,Normale“, ein Realist. Ein Machtmensch, vom Machtrausch und vom Machtstreben getrieben. aber er hat dieses unter Kontrolle, er ist zielbewußt, er hat seine ziel-führende Strategie, weil er nicht über die Macht philosophiert. sondern einen Instinkt für sie hat.
,,Wir schicken ein paar von unseren gut ausgebildeten Kerlen in feindliches Territorium, in die Dörfer oder kleinen Städte. Und dort werden sie offen, so, daß es alle sehen und hören können, möglichst viele Kinder, Frauen und Greise massakrieren. Bald danach werden feindliche Burschen sich in unsere Dörfer, unsere kleinen Städte schleichen und dasselbe tun, und wir werden das publik machen, im Femsehen zeigen und in den Zeitungen veröffentlichen. Und schon sind einige tausend Menschen auf beiden Seiten in den unzerstörbaren Kreis des Hasses, der Rache und des Blutes, das vergossen werden muß, hineingezogen. Man wiederhole das zehnmal und hundertmal, und schon haben wir einen prächtigen großen Krieg, der nie zu Ende gehen wird, weil ihn nicht nur Staaten und Völker und Heere führen, sondern einzelne, die stille Mehrheit … ,, – Das also ist die neue Strategie. Und sie ist wirksam. Die Wirklichkeit bestätigt es. Nicht Armeen gegen Armeen, die kämpfen. sondern Menschen gegen Menschen. Nachbar gegen Nachbar. Infernalisch! Aber gut für den Krieg. Und da gibt es dann noch den Hauptmann, den Kommandanten der Sondereinheit ,,Seven Up“, einer Mörder- und Killertruppe, mit einer besonderen Spezialität.
Sie schlachten nicht nur Menschen mit ihren Messern ab, sondem nehmen sie auch aus. wie Tiere: sie entnehmen die unverletzten inneren Organe zurWiederverwertung, für ein geheimes Syndikat, für eine Firma, die mit menschlichen Organen für Transplantationen handelt, ganz legal, versteht sich; eben eine der vielen Exportfirmen, wie andere auch. Nur das exportierte Produkt ist halt ein wenig etwas Besonderes, manche meinen Abartiges. Aber die Nachfrage ist groß und der Profit auch. Für alle. Ist es Fiktion oder Wirklichkeit’? Jedenfalls wäre es eine Möglichkeit, dem ganzen Wahnsinn noch eine weitere Facette menschlicher Tollheit hinzuzufügen. Doch zuletzt gibt es vor allem die Opfer. Die Opfer eines von solchen Führern und Führerfiguren und ihren Komplizen und Helfershelfem entfesselten und praktizierten Wahnsinns des ,,Krieges“, des gegenseitigen Abschlachtens, vor allem auch der Zivilbevölkerung. ,,Freiwillig hatte ich das alles getan, was ich nie glaubte, tun zu können. Vielleicht weil ich mir das immer gewünscht und nur vor mir selber und anderen verborgen hatte“, bekennt einer von der Schlächtertruppe ,,Seven up“. Ist das eine schlüssige Antwort, nur für ihn, oder überhaupt’? – ,,Er verachtete die ganze Welt. alles, worauf sein Totenblick fiel. Vögel und Bäume. genauso wie Kinder. Er liebte Motorräder.“ So charakterisiert dieGeliebte ihren Hauptmann. Und trotzdem, oder gerade deswegen, wegen der Brutalität und völligen Gefühllosiekeit, mit der er das junge Mädchen nimmt und entjungfert, wird und bleibt sie seine Geliebte. Die Geliebte eines Kommandanten einer Schlächter- und Mörderbande, der alles befiehlt. Vielleicht fasziniert sie gerade deshalb ,,diese weiße gepflegte Hand, die so geschickt mit dem Messer umgeht, als gehöre sie einem Zirkusartisten“, weil sie die Hand eines Mörders ist. Etwas ganz Gegenteiliges von ihr.
Vielleicht ist es gerade das Andere, das Gegenteilige, das. was wir nicht sind, das in uns den Wunsch erzeugt, das Andere, das Gegenteilige, wenigstens für einen Augenblick, zu werden, um uns loszulösen von unserem eigenen Ich. Vielleicht ist jedes Ich ein Gefängnis. Und es kommt der Augenblick wo es uns verhaßt ist. Vielleicht ist der Grund für den Haß unser Selbsthaß, ganz tief in uns, verborgen, verdrängt. aber fest in uns verwurzelt. Und wir wollen uns von unserem Selbsthaß befreien: durch Haß, durch Mord und Totschlag, durch Krieg und Gewalt. -Wer könnte auf diese Fragen eine Antwort geben’? Wer kennt die Wirklichkeit des Menschen’? Nur Gott’? Warum läßt er diesen Wahnsinn, dieses Leiden zu? Oder müssen wir ihn heraushalten aus diesen Fragen? Ich weiß es nicht.
Vidosav Stevanović: „Schnee und schwarze Hunde“, Roman.
Aus dem Serbischen übersetzt von Ivan Ivanji. Europaverlag, Wien, 1995
Peter Paul Wiplinger
Wien, 29.3.1995
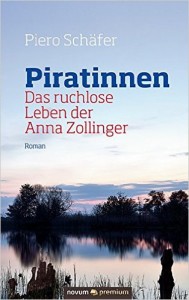 Anna Zollinger wächst zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Tochter eines Seidenhändlers am Zürichsee auf. Sie ist rebellisch und unbeugsam. Ihre Stiefmutter schickt sie ins Kloster nach Rüti, wo sie abscheuliche Dinge erlebt und den Glauben verliert. Sie brennt mit einem deutschen Pilger durch, der aus Eifersucht einen Reisläufer erschlägt und fliehen muss. Anna trifft auf die attraktive Dirne Brida, mit der sie zusammen lebt und erste Diebeszüge unternimmt. Die beiden begegnen einer Fischerstochter, mit deren Boot sie auf dem Zürichsee Handelsschiffe überfallen. Eines Tages entern sie ein Boot, das sie bereits einmal überfallen hatten. Dessen Besatzung erkennt die Frauen, und es kommt zu einem tödlichen Handgemenge. Es sollte nicht das letzte gewesen sein.
Anna Zollinger wächst zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Tochter eines Seidenhändlers am Zürichsee auf. Sie ist rebellisch und unbeugsam. Ihre Stiefmutter schickt sie ins Kloster nach Rüti, wo sie abscheuliche Dinge erlebt und den Glauben verliert. Sie brennt mit einem deutschen Pilger durch, der aus Eifersucht einen Reisläufer erschlägt und fliehen muss. Anna trifft auf die attraktive Dirne Brida, mit der sie zusammen lebt und erste Diebeszüge unternimmt. Die beiden begegnen einer Fischerstochter, mit deren Boot sie auf dem Zürichsee Handelsschiffe überfallen. Eines Tages entern sie ein Boot, das sie bereits einmal überfallen hatten. Dessen Besatzung erkennt die Frauen, und es kommt zu einem tödlichen Handgemenge. Es sollte nicht das letzte gewesen sein.








