 Lynn lebt in einer Welt, in der nichts mehr selbstverständlich ist. Auf einer einsamen Farm kämpft sie mit ihrer Mutter ums Überleben. Der einzige Luxus, der ihnen nach dem Zusammenbruch der Zivilisation geblieben ist ein Teich hinter dem Haus und damit der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch als ihre Mutter verletzt wird, ahnt Lynn, dass sie den Teich allein nicht vor Eindringlingen schützen kann. Sie muss das Undenkbare tun: die sichere Farm verlassen und Hilfe holen.
Lynn lebt in einer Welt, in der nichts mehr selbstverständlich ist. Auf einer einsamen Farm kämpft sie mit ihrer Mutter ums Überleben. Der einzige Luxus, der ihnen nach dem Zusammenbruch der Zivilisation geblieben ist ein Teich hinter dem Haus und damit der Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch als ihre Mutter verletzt wird, ahnt Lynn, dass sie den Teich allein nicht vor Eindringlingen schützen kann. Sie muss das Undenkbare tun: die sichere Farm verlassen und Hilfe holen.
Mal wieder ein Buch, bei dem der Klappentext doch ziemlich vom tatsächlichen Inhalt abweicht.
Lynn ist 16 Jahre alt und in einer Welt geboren und aufgewachsen, die schon vor längerer Zeit aus den Fugen geraten ist. Wann genau die Geschichte spielt, wird nicht erwähnt, aber ich vermute, um das Jahr 2050, jedenfalls in einer nicht allzu fernen Zukunft. Zuerst wurde das Öl knapp, es gab deshalb zwei Kriege, und dann fehlte das Trinkwasser.
Lynn hat im verlassenen Ohio nie etwas anderes kennengelernt als die alte Farm und hatte, bis auf ihre Mutter, nie Kontakt zu anderen Menschen. Ihre Mutter hat ihr alles Überlebensnotwendige, wie z.b Feuer machen, Gemüse anbauen und einkochen, Wasser reinigen und vor allem das Schießen beigebracht. Menschliche Werte, Mitgefühl oder Anteilnahme hat sie ihr allerdings nicht vermittelt.
Freizeit oder Spaß kennt das Mädchen nicht, denn das Leben ist hart und wenn sie nicht Feuerholz sammelt, Wasser reinigt oder sich um das Gemüse kümmert, dann hockt Lynn stundenlang mit dem Gewehr auf dem Dach, um den Teich vor durchreisenden Fremden zu verteidigen, die sie ohne zu zögern schon aus der Ferne erschießt.
Direkt am Anfang der Geschichte wird Lynns Mutter aber schwer verletzt und stirbt an ihren Verletzungen, so dass Lynn ganz alleine ist. Eher ungewollt kommt sie mit ihrem einzigen, entfernt wohnenden Nachbarn in Kontakt, freundet sich ganz langsam und vorsichtig ein wenig mit ihm an. Die beiden müssen feststellen, dass sich auch in ihrer unmittelbaren Umgebung ein paar andere Leute niedergelassen haben die eventuell zur Bedrohung werden könnten …
Im Gegensatz zum Klappentext verlässt Lynn die Farm nicht, fast die komplette Geschichte spielt sich eigentlich auf der Farm ab. Es geht in diesem Buch auch nicht um große Abenteuer oder Kämpfe, sondern eher um die kleinen Dinge. Es geht um ein isoliert aufgewachsenes Mädchen in einer zerfallenen Welt, das lernt, was Zusammenhalt, Mitgefühl und Freundschaft bedeuten. Eigentlich passiert in der kompletten Geschichte nicht allzu viel und ich denke, dass das Buch vielen deshalb auch langweilig sein könnte. Mir hat es aber sehr gut gefallen, man muss aber schon ein richtiger Endzeitfan sein, um es zu mögen. Die Geschichte ist mit Liebe und Herzblut geschrieben und man bekommt schnell eine enge Bindung zu den Figuren.
Gegen Ende nimmt die Geschichte dann zwar doch noch an Fahrt auf und es gibt ein bisschen Aktion, allerdings ist diese Aktion dann auch wieder recht schnell (etwas zu schnell) vorbei.
Gut fand ich dass es kein „Friede-Freude-Bratkartoffel“-Ende gibt, sondern dass die Geschichte schon ziemlich realistisch und nicht abgehoben endet.
Ein gutes Buch, das ich Endzeitfans auf jeden Fall empfehlen kann.
Mindy McGinnis lebt in Ohio und arbeitet in einer Bibliothek. Neben dem Schreiben sind ihre anderen Leidenschaften das Überleben in der Wildnis und das Einkochen von Konserven.
 Liaison von Philosophie und Belletristik
Liaison von Philosophie und Belletristik Clash of Civilizations
Clash of Civilizations

 Melancholische Erzählwelt
Melancholische Erzählwelt Die Gedichte Lieselotte Stieglers sind tatsächlich in dem Sinn Ge“dichte“, dass sie zu allermeist sehr knapp angelegt wurden. Auf überflüssiges ist verzichtet, dennoch nicht die Lyrik geschmäht, weil Stieglers Metaphern schön sind, das Spiel mit den Worten gekonnt und ihre Dichtkunst ausgereift ist. Wir sehen vor uns einzelne kleine Meisterwerke, wie Blüten auf einer Wiese: violette, gelbe, ziegelrote, doch ihre kurzen Gedichte hängen irgendwie auch alle zusammen. In „Andalusien“ etwa wachsen Dornen und Jasmin auf Ziegeldächern, das nächste Gedicht heißt: Dornen. Zuvor bereits besingt sie Lorca, erklingen die Jondos in Granada. Also bilden die einzelnen Blüten im exquisitesten Sinn eine Blumenwiese, an deren Ende zum Stadtrand hin sie jedoch vertrocknet und dürr daliegt – die politischen Gedichte gegen Schluss des Bandes.
Die Gedichte Lieselotte Stieglers sind tatsächlich in dem Sinn Ge“dichte“, dass sie zu allermeist sehr knapp angelegt wurden. Auf überflüssiges ist verzichtet, dennoch nicht die Lyrik geschmäht, weil Stieglers Metaphern schön sind, das Spiel mit den Worten gekonnt und ihre Dichtkunst ausgereift ist. Wir sehen vor uns einzelne kleine Meisterwerke, wie Blüten auf einer Wiese: violette, gelbe, ziegelrote, doch ihre kurzen Gedichte hängen irgendwie auch alle zusammen. In „Andalusien“ etwa wachsen Dornen und Jasmin auf Ziegeldächern, das nächste Gedicht heißt: Dornen. Zuvor bereits besingt sie Lorca, erklingen die Jondos in Granada. Also bilden die einzelnen Blüten im exquisitesten Sinn eine Blumenwiese, an deren Ende zum Stadtrand hin sie jedoch vertrocknet und dürr daliegt – die politischen Gedichte gegen Schluss des Bandes. Eine Rezension über Tagebücher zu schreiben mutet heute höchst bizarr an. Ich verfasse seit 3o Jahren Rezensionen, und noch niemals kamen mir Tagebücher unter. Welcher Verleger würde das Risiko eingehen, Gedanken, Spinnereien, Schwärmereien eines Autors zu veröffentlichen, wo die Romanform die Mindestanforderung an den jungen Dichter ist, jemals publiziert zu werden. (Besser wäre natürlich gleich ein Krimi). Und Wald? Ha – dass wir nicht lachen. Der eignet sich bestenfalls als Fundstätte für eine Leiche…
Eine Rezension über Tagebücher zu schreiben mutet heute höchst bizarr an. Ich verfasse seit 3o Jahren Rezensionen, und noch niemals kamen mir Tagebücher unter. Welcher Verleger würde das Risiko eingehen, Gedanken, Spinnereien, Schwärmereien eines Autors zu veröffentlichen, wo die Romanform die Mindestanforderung an den jungen Dichter ist, jemals publiziert zu werden. (Besser wäre natürlich gleich ein Krimi). Und Wald? Ha – dass wir nicht lachen. Der eignet sich bestenfalls als Fundstätte für eine Leiche…
 Ljubljana: 5 Routen durch die Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana, die „Geliebte“, bietet dieser Falter Reiseführer aus der Reihe City Walks. Neben den gut durchdachten Spaziergängen durch die Geschichte Ljubljanas wird aber auch eine Menge an praktischen Tipps geboten: Kultur, Sightseeing, Shoppingtipps und Öffnungszeiten von Museen sowie Nightlife.
Ljubljana: 5 Routen durch die Hauptstadt Sloweniens, Ljubljana, die „Geliebte“, bietet dieser Falter Reiseführer aus der Reihe City Walks. Neben den gut durchdachten Spaziergängen durch die Geschichte Ljubljanas wird aber auch eine Menge an praktischen Tipps geboten: Kultur, Sightseeing, Shoppingtipps und Öffnungszeiten von Museen sowie Nightlife.



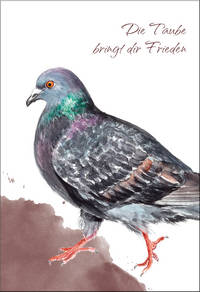 mit 60 Seiten, 49 Karten im Format 95 x 140 mm und vielen Informationen zu den Krafttieren, darunter Eule, Fuchs, Adler und 46 weitere, insgesamt also 49. Das ausführliche Booklet mit 60 Seiten erklärt, wie man mit die Karten benutzt und beschreibt jedes Tier mit seinen besonderen Eigenschaften. Man kann es dem Zufall überlassen, oder selbst wählen, das jeweils eigene Krafttier wird in jedem Fall helfen, das Neue Jahr gut beginnen zu lassen.
mit 60 Seiten, 49 Karten im Format 95 x 140 mm und vielen Informationen zu den Krafttieren, darunter Eule, Fuchs, Adler und 46 weitere, insgesamt also 49. Das ausführliche Booklet mit 60 Seiten erklärt, wie man mit die Karten benutzt und beschreibt jedes Tier mit seinen besonderen Eigenschaften. Man kann es dem Zufall überlassen, oder selbst wählen, das jeweils eigene Krafttier wird in jedem Fall helfen, das Neue Jahr gut beginnen zu lassen. Inspiration“, denn Kartenlegen dient ja hauptsächlich dazu, sich neuen Gedanken auszusetzen und sie für sich selbst zu adaptieren. Das kann oft zu Lösungen führen – oder noch mehr Problemen. Aber die Helfertiere haben ja die Aufgabe, Sie über diese Stromschnellen hinwegzuführen. Nach dem Mischen und Ziehen der Karten, sollte man sich den Text im Booklet dazu gut durchlesen und sich zu neuen Gedankengängen verführen lassen. „die Fragen müssen immer an die Realität angebunden sein“, schreiben die Herausgeber, „egal ob sie in die Vergangenheit oder Zukunft führt“.
Inspiration“, denn Kartenlegen dient ja hauptsächlich dazu, sich neuen Gedanken auszusetzen und sie für sich selbst zu adaptieren. Das kann oft zu Lösungen führen – oder noch mehr Problemen. Aber die Helfertiere haben ja die Aufgabe, Sie über diese Stromschnellen hinwegzuführen. Nach dem Mischen und Ziehen der Karten, sollte man sich den Text im Booklet dazu gut durchlesen und sich zu neuen Gedankengängen verführen lassen. „die Fragen müssen immer an die Realität angebunden sein“, schreiben die Herausgeber, „egal ob sie in die Vergangenheit oder Zukunft führt“.



 Vom steinernen Zölibatär
Vom steinernen Zölibatär