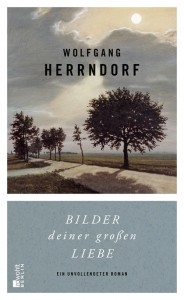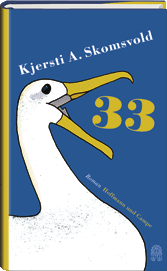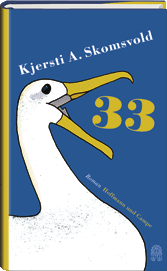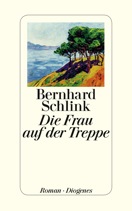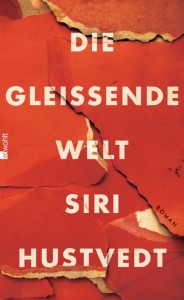Die Magical Mystery Tour! In der Rockmusiker-Szene so etwas wie eine globalgalaktische Sehnsuchtsbestimmung. Bei den Beatles 1967 ging es mehr oder weniger schief, der Funke sprang nicht so recht über. Besser läuft es damit hingegen bei einer bekannten PunkrockCombo aus dem Dorf an der Düssel, die mit ihren Magical-Mystery-Wohnzimmer-Konzerten dem beschworenen Ideal von love and peace noch am nächsten kommen. Der Musiker und Schriftsteller Sven Regener nun verlegt dieses Sehnsuchtsding kurzerhand in die Elektromusik/ Raverszene, denn “Raver machen dies, Rocker machen das, das ist doch alles nur vorgeschobener Scheiss!” Und zur Freude seiner Fans hat Regener Karl Schmidt an’s Steuer des Tourbus gesetzt.
Die Magical Mystery Tour! In der Rockmusiker-Szene so etwas wie eine globalgalaktische Sehnsuchtsbestimmung. Bei den Beatles 1967 ging es mehr oder weniger schief, der Funke sprang nicht so recht über. Besser läuft es damit hingegen bei einer bekannten PunkrockCombo aus dem Dorf an der Düssel, die mit ihren Magical-Mystery-Wohnzimmer-Konzerten dem beschworenen Ideal von love and peace noch am nächsten kommen. Der Musiker und Schriftsteller Sven Regener nun verlegt dieses Sehnsuchtsding kurzerhand in die Elektromusik/ Raverszene, denn “Raver machen dies, Rocker machen das, das ist doch alles nur vorgeschobener Scheiss!” Und zur Freude seiner Fans hat Regener Karl Schmidt an’s Steuer des Tourbus gesetzt.
Karl Schmidt? Wer war das noch gleich? Karl Schmidt mit dt, genannt Charlie. Richtig. Der Charlie! Der nicht zu Ruhm und Ehre gekommene Installationskünstler, bester Freund von Herrn Lehmann, DEM Regener-Helden. Charlie, der eifrige Konsument diversester bewusstseinsverändernder Drogen, der großherzige Charlie, der es fertig brachte, just am Tag der Maueröffnung mit einer Psychose in der Klapse zu landen, dieser Charlie sitzt nun am Steuer eines Sprinters auf Magical Mystery Tour oder wie die eigentlich geschäftstüchtigen Raver sagen: “Dieses Ding mit der Liebe“. Denn “das ist das, was die Sachen sexy macht, dass man zugleich jung ist und doof und trotzdem schlauer als alles anderen”
Doch bevor die Tour losgeht, erfährt der geneigte Leser zunächst, was dem guten Charlie nach seiner Einlieferung in die Klapse geschah. Wir treffen Charlie wieder in einer wolkigen Parallelwelt namens “Clean Cut”, einer drogentherapeutischen Einrichtung in Hamburg. wo er sich in alter Gutmütigkeit und bewusster Unauffälligkeit übt. Sogar in das ganz normale Berufsleben hat er sich integriert und gibt als Hilfshausmeister und Streichelzoowärter eines Kinderkurheimes alles. Bis er eines Tages zum einen erfährt, dass er einen neuen Haupt-Hausmeister vor die Nase gesetzt bekommt und zum anderen in einer Altonaer Eisdiele eine Begegnung mit seiner Vergangenheit hat. Er trifft Raimund. einen der alten Raver-Kumpels, der es doch erstaunlicherweise in der Zwischenzeit als Mitinhaber des Labels “BummBumm” zu etwas gebracht hat, vor allem zu Geld.
Dieser Raimund plant gemeinsam mit seinem Partner Ferdi just jene Magical-Mystery-Tour, die den Gummistiefel Techno und den Rave der 90er mit der Love-and-Peace Sehnsucht vereinen soll. Charlie, der sich nur noch einen kleinen Schritt entfernt von einem selbstbestimmten Leben fühlt, kommt ihm gerade recht. Denn sie brauchen noch einen Steuermann, der nicht nur den Bus, sondern auch die Geschicke der Tour lenken soll. Dave, der es eigentlich machen sollte, hat für den Geschmack der idealistisch Beseelten zu sehr das Gemüt eines Erbsenzählers. Man braucht einen, der nüchtern bleiben muss und im Gegensatz zu den Mitreisenden halbwegs klar denken kann, zugleich aber auch an die von “BummBumm” ausgerufenen Ideale glaubt. Kurz, Charlie soll es machen. Und Charlie macht. Wenn man ihn schon nicht zum “richtigen” Hausmeister befördert.
Denn dadurch, dass man ihn bei der längst fälligen Beförderung in der kleinen Spießerwelt übergeht, mit der er sich gerade so mühsam versucht zu arrangieren, bekommt der nach Zugehörigkeit und Anerkennung suchende Charlie einmal mehr die Bestätigung, dass er in dieser Welt wohl auf immer der “Psycho-Dödel” bleiben wird. Genau in diesem Moment tritt die Magical-Mystery-Nummer in sein Leben. Das muss doch ein Zeichen sein. (Dass er auch diesen Job nur angeboten bekommt, weil einigen die Nase des eigentlich vorgesehen Dave nicht passt, blendet er dabei geschickt aus) Er sieht es als Chance, in die von ihm nie vergessene und immer geliebte Welt durchgeknallter Künstler zurückzukehren.
Eine Welt, in der man sich Hosti Bros nennt, Saxophon-Stücke als Lied mit der Flöte hypet und in der manchmal auch nur ein Arschwackeln reicht, um zu reüssieren. Eine Welt, die alles nicht ganz so ernst nimmt, aber mittlerweile auch zu Charlies großem Erstaunen eine Welt geworden ist, die Riesendinger a la Mayday Dortmund (im Buch Springtime in Essen) mit Erfolg auf die Beine zu stellen vermag. Wenn auch noch nicht mit dem mega Erfolg, den ElektroMusic, Djs und Rave heutzutage haben. Regeners Buch spielt eher in der Zeit, als German dance noch so etwas wie der ganz heisse Scheiss war und Ideale noch salonfähig. Wenn man auch mitunter den Eindruck hat, dass Charlie der letzte echte Idealist in der Bummbummtruppe ist.
Glücklicherweise hilft diesem seine pragmatische Art, mit der er den Aushilfs-Hausmeister im Kinderkurheim gegeben hat, nun auch prima das Magical-Mystery-Getingel einigermaßen zu wuppen. Und wer weiß, vielleicht findet er ja einen Weg, nach der Tour ein neues Leben in einer alten Welt gut auf die Reihe zu kriegen. Denn seine Künstlervergangenheit ist ihm lange noch nicht egal, wie sich zeigt, als er in einem Antiquariat zum ersten Mal den Katalog für seine eigene, dareinst in den 80ern geplante und dann geplatzte Ausstellung findet.
Charlie ist ein großartiger Held, ein sympathischer noch dazu. Letzten Endes sogar einer, mit dem man schneller warm wird, als mit Herrn Lehmann. Von dem im übrigen im Buch auch immer mal wieder mehr oder weniger wehmütig die Rede ist. “Frankie, die alte Socke… wir hätten ihn nicht dauernd Herrn Lehmann nennen dürfen” Soviel sei gespoilert: Ja, der Leser wird erfahren, was aus Herrn Lehmann geworden ist. Aber – nein, es wird kein Wiedersehen mit Herrn Lehmann geben. So billig macht es ein Sven Regener glücklicherweise nicht. Hat auch eine gewisse Logik: Die Geschichte von Herrn Lehmann war weitestgehend auserzählt, er war ja auch nicht wirklich ein Typ, um den man sich hätte Sorgen machen müssen. Das war einer, der immer wieder auf seine Füße fallen würde. Es waren ganz andere Typen, die in den vorangegangenen Büchern hinten rüber gefallen sind und deren Geschichte noch zu Ende erzählt werden kann. Wie die von Charlie eben.
Seinem Helden zur Seite gestellt hat Regener mit den Ravern Figuren, die von Apfelwein und anderen Drogen beseelt ununterbrochen die Dinge des Lebens bequasseln und den Begriff Laberflash aufs beste illustrieren, gelegentlich aber auch mal was Erhellendes sagen. So atemlos wie die Raverszene in der äußeren Wahrnehmung daherkommt, so atemlos liest sich das Buch streckenweise auch. Gequirltes Gesabbel de luxe. Manchmal witzig, manchmal nervtötend, aber immer authentisch, Grammatikfehler in wörtlicher Rede absichtlich inbegriffen. Milieugenauigkeit war schließlich schon immer eine der großen Stärken Sven Regeners. Das kann er wie kein Zweiter. Hier eine Szene, dort ein Dialog und schon hat man die jeweilige Welt in ihrer ganzen Surrealität vor Augen. Egal, ob es die zwischen Nostalgie, Geschäftstüchtigkeit und Idealismus sich nicht entscheiden könnende großmäulige Techno Szene ist oder die zwischen Bevormundung und Weltverbesserer-Gehabe schwankende Clean-Cut-Welt.
Regeners Figuren haben alle eine Macke, aber man muss sie mögen. Er hat ganz einfach ein Herz für die Bekloppten dieser Welt. Doch so entlarvend manche Szenen sind, so wenig schaut Regener und mit ihm der Leser auf sie runter. Eine ganz große Stärke entwickelt das Buch in den Momenten, wo es Karl Schmidt über seine paronaiden Schübe, “das Dunkel, das ihn bedroht” und wie er damit umgeht, erzählen lässt. Im Buch ist es die DJane Rosa, in die Charlie sich so ein bißchen verliebt, die stellvertretend für den Leser wissen will, wie es so ist, wenn man verrückt wird. Das erzählt einem ja sonst keiner. Aber Charlie erzählt es jetzt. Ganz nüchtern, nicht wehleidig, nicht pathetisch und genau darum so berührend erzählt er es Rosa und mit ihr dem Leser in bester Hausmeister-Manier, wie es ist mit “der Schraube, die einmal überdreht wurde und nie wieder richtig fest sitzt”
Was bleibt nach der Lektüre? Ein Einblick in die goldene Aufbruchzeit der Raver, Freude, Hoffnung und trotz gelegentlicher Längen und Überdruss ob des allzu breitgetretenen Gelabers die wiederholte Erkenntnis, dass es wenige gibt, die wie Regener mit der deutschen Sprache umgehen können. Texte von ihm machen einfach immer wieder Freude, egal ob es Liedtexte oder Prosa sind. Weit und breit ist wohl keiner zu finden, der Wörter derart kunstvoll zu gebrauchen weiß und damit entzückt, egal ob es der gesungene “Schwachstromsignalübertragungsweg” oder die “Verlaufskontrollpreußen” in der “Bummbummigkeit” der Magical Mystery Tour sind. Und alte abgenudelte Sponti-Sprüche à la “Profile sind nur was für Reifen” in Literatur umzuwandeln, das muss man auch erstmal fertig bringen. Darüberhinaus möchte man ihm schon ziemlich gerne den Titel “Meister der ersten und letzten Sätze in einem Roman”verleihen. Auch wenn diese hier absichtlich nicht zitiert werden, da man sie sich ruhig selbst erlesen sollte, sie sind extremst gelungen – Chapeau.
Sven Regener lebt in Berlin. Bekannt und beliebt wurde er einem eingeschworenen Fankreis als Frontmann der Band Element of Crime. Mit seiner Trilogie über Herrn Lehmann machte er sich auch als Schriftsteller einen Namen und brachte das Kunststück fertig, seitdem mit diversen Projekten gleichermaßen als Lieblings des Feuilletons und der Indie-Szene die deutsche Kulturszene aufzumischen. Dass einem während der Lektüre der Magical Mystery ständig EoC Liedtexte in den Sinn kommen, gehört wohl ebenso zu den Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen des Regener-Universums wie die Tatsache, dass man während des Lesens immer Detlef Buck als Karl Schmidt vor Augen hat.
Nachsatz zur Rezension am 03.12.2015:
Der Kollege Kretzler hat dieses Buch in der Kindle-E-Book-Version gelesen. Neben der Begeisterung für das Werk hat er aber eine kritische Anmerkung, die durchaus in eine Buchbesprechung gehört. Ich zitiere deshalb auch an dieser Stelle aus untenstehendem Kommentar des geschätzten Kollegen:
“Was mir bei der Kindle-Version negativ auffiel waren wiederholt unmotivierte Zahlen in eckigen Klammern mitten im Text, da wurde geschlampt.”
 Im gerade erschienenen ersten Teil der “Muchachas -Tanz in den Tag” bekommt die Geschichte von Stella und ihrer Mutter Leonie, die unter dem gewalttätigen Vater und Ehemann leiden, den größten Raum. Die junge Schrotthändlerin Stella lernen wir als mutige alleinerziehende Mutter kennen, ihre Mutter Leonie ist durch die ständigen Mißhandlungen und Demütigungen ihres Mannes nur noch ein Schatten ihrer selbst. Während die anderen Geschichten weitestgehend in den Metropolen dieser Welt spielen, entdeckt man in Stellas und Leonies Geschichte eine andere, eine dunklere Welt, die des ländlichen, eigentlich bodenständigen Bourguignon.
Im gerade erschienenen ersten Teil der “Muchachas -Tanz in den Tag” bekommt die Geschichte von Stella und ihrer Mutter Leonie, die unter dem gewalttätigen Vater und Ehemann leiden, den größten Raum. Die junge Schrotthändlerin Stella lernen wir als mutige alleinerziehende Mutter kennen, ihre Mutter Leonie ist durch die ständigen Mißhandlungen und Demütigungen ihres Mannes nur noch ein Schatten ihrer selbst. Während die anderen Geschichten weitestgehend in den Metropolen dieser Welt spielen, entdeckt man in Stellas und Leonies Geschichte eine andere, eine dunklere Welt, die des ländlichen, eigentlich bodenständigen Bourguignon. 

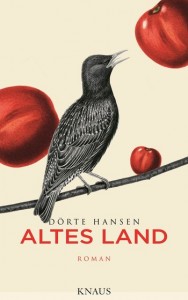 Vera ist fünf Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter auf dem großen steinernen Gutshof im alten Land, dem großen Obstanbaugebiet unweit von Hamburg strandet. Sie sind 1945 aus Ostpreußen geflohen, die wortkargen Norddeutschen heißen die Flüchtlinge nicht gerade willkommen. “Diet Huus is mien un doch nich mien, de no mi kummt, nenn’t ook noch sien” steht über der Tür. “Von mi gift dat nix!“ ist der einzige Satz, den die alte Bäuerin zu den Flüchtlingen spricht.
Vera ist fünf Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter auf dem großen steinernen Gutshof im alten Land, dem großen Obstanbaugebiet unweit von Hamburg strandet. Sie sind 1945 aus Ostpreußen geflohen, die wortkargen Norddeutschen heißen die Flüchtlinge nicht gerade willkommen. “Diet Huus is mien un doch nich mien, de no mi kummt, nenn’t ook noch sien” steht über der Tür. “Von mi gift dat nix!“ ist der einzige Satz, den die alte Bäuerin zu den Flüchtlingen spricht. 
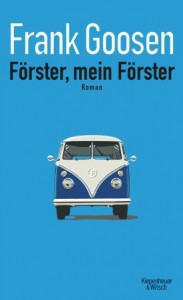 Förster, Schriftsteller mit Schreibhemmung steht kurz vor seinem 50 Geburtstag. Tjanun, so kann es gehen: Gerade noch jung und knackig, das Leben liegt vor einem, findet man sich plötzlich in einem Alter wieder, in dem man einsieht, dass Stracciatella und Pistazie ganz schlecht zusammenpassen. Auch wenn er sich noch so oft einredet, dass es ein Geburtstag wie jeder andere ist und nicht wichtiger als der ein Jahr zuvor – Förster kommt doch ins Grübeln. Die Vollendung des halben Jahrhunderts ist einfach „der Tag, ab dem man sich nichts mehr vormachen kann“.
Förster, Schriftsteller mit Schreibhemmung steht kurz vor seinem 50 Geburtstag. Tjanun, so kann es gehen: Gerade noch jung und knackig, das Leben liegt vor einem, findet man sich plötzlich in einem Alter wieder, in dem man einsieht, dass Stracciatella und Pistazie ganz schlecht zusammenpassen. Auch wenn er sich noch so oft einredet, dass es ein Geburtstag wie jeder andere ist und nicht wichtiger als der ein Jahr zuvor – Förster kommt doch ins Grübeln. Die Vollendung des halben Jahrhunderts ist einfach „der Tag, ab dem man sich nichts mehr vormachen kann“.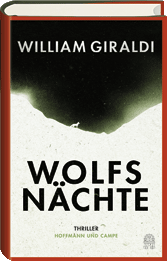
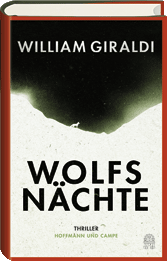 Die Winter sind unbarmherzig in Alaska. In einem dieser unerbittlichen Winter ist es so kalt, dass die Wölfe sich aus den Wäldern wagen und die Kinder aus den Dörfern holen, um ihren Hunger zu stillen. Die Stimmen der Trauernden heulen mit den Wölfen und den Winden um die Wette. Die Menschen haben keine Möglichkeit, das zurückzufordern, was die Natur grausam als ihr Recht entschieden hat. Doch haben die Wölfe auch den sechsjährigen Bailey Slone aus dem gottverlassenen Dorf Keelut auf dem Gewissen?
Die Winter sind unbarmherzig in Alaska. In einem dieser unerbittlichen Winter ist es so kalt, dass die Wölfe sich aus den Wäldern wagen und die Kinder aus den Dörfern holen, um ihren Hunger zu stillen. Die Stimmen der Trauernden heulen mit den Wölfen und den Winden um die Wette. Die Menschen haben keine Möglichkeit, das zurückzufordern, was die Natur grausam als ihr Recht entschieden hat. Doch haben die Wölfe auch den sechsjährigen Bailey Slone aus dem gottverlassenen Dorf Keelut auf dem Gewissen?