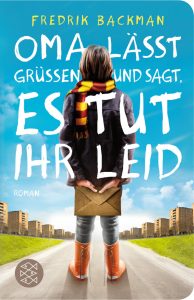 Mit seinem eigenwilligen Roman »Ein Mann namens Ove« bewies Fredrik Backman, dass schwedische Autoren viel mehr können als spannende Krimis mit eigener Melodie zu verfassen. 2013 wurde er dafür zum erfolgreichsten Autor Schwedens gekürt. Sein Folgeroman »Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid« stieg auch in Deutschland sofort in die Bestsellerlisten auf, obwohl oder gerade weil Großkritiker vor dem Buch warnen, das ihnen zu schlicht ist. Weiterlesen
Mit seinem eigenwilligen Roman »Ein Mann namens Ove« bewies Fredrik Backman, dass schwedische Autoren viel mehr können als spannende Krimis mit eigener Melodie zu verfassen. 2013 wurde er dafür zum erfolgreichsten Autor Schwedens gekürt. Sein Folgeroman »Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid« stieg auch in Deutschland sofort in die Bestsellerlisten auf, obwohl oder gerade weil Großkritiker vor dem Buch warnen, das ihnen zu schlicht ist. Weiterlesen
Archiv
Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid
Sympathie für Faune
 Ulli B. Laimers Gedichte berühren eine magische Welt. Nicht, dass wahre Lyrik dies nicht generell vermag, der herrschende Zeitgeist lässt solch kleine Wunder allerdings eher zufällig zu – meist übersieht die modernistische Zensur eher die geistige Welt, an der „magische“ Gedichte nippen, als sie zu vermissen.
Ulli B. Laimers Gedichte berühren eine magische Welt. Nicht, dass wahre Lyrik dies nicht generell vermag, der herrschende Zeitgeist lässt solch kleine Wunder allerdings eher zufällig zu – meist übersieht die modernistische Zensur eher die geistige Welt, an der „magische“ Gedichte nippen, als sie zu vermissen.
Laimer kümmert das Spiritualitätstabu der modernen Literatur nicht: Sie formuliert, was sie denkt. Sie fasst in Worte, was sie spürt. Sie bekennt sich ausdrücklich zum „Diskurs mit einer beseelten Welt“.
Alles was existiert, lebt. Alles in der Welt ist beseelt. Diese Weisheit teilt sie mit den indianischen Ureinwohnern (und allen archaischen Nationen: von der Steppe Zentralasiens, bis in die Tundra, nach Lappland und Kanada; von den Plains zu den Indios Lateinamerikas, bis nach Australien und in die Voodookultur) ebenso wie mit den Ahnen des indoeuropäischen Kulturkreises. Sie schätzt speziell die keltische vormoderne Literatur, und hegt unzweifelhaft keine ästhetizistische, sondern eine aus dem Herzen aller Zeiten, aus Mutter Erdes Schoß geborene Sympathie für Faune.
Sie schreibt von der kreisrunden Zeit, besitzt einen zyklischen Zeitbegriff, wie ihn Rudolf Kaiser in „Gott schläft im Stein“, erläuterte. Die Zeit ist rund, alles kehrt wieder, kreisend um eine leere Mitte: Das Symbol der Nabe, die den Urgrund repräsentiert. Wir finden es in den Upanischaden ebenso wie im Tao Te King des Religionsstifters Lao Tse. Auch in Laimers Gedicht „Rad“ wird der Rhythmus der Rundheit beschworen.
Zu allen Zeiten und in der gesamten Welt war sich die Menschheit ganzheitlicher Weisheiten bewusst. Seit 2oo, 25o Jahren vielleicht glaubt eine intellektualistische Elite an den linearen Verlauf der Dinge. Und rennt wie verrückt in ihrem selbstgebauten Hamsterrad im Kreis. Die Literatur zappelt mit, an vorderster Front, weil sie sich mitsamt den Wissenschaften ab der Aufklärung anmaßte, die richtige Welt – die der Ratio und des sachlichen Verstands – zu beschreiben. Und weil sie heute den Anschluss an die Ressourcenvergabe nicht verlieren will.
Einen wohltuenden Pfad aus dem Käfig, der Kälte und der zynischen Finsternis weisen uns Ulli B. Laimers Gedichte. Oft sind sie ganz einfach schön. Wie: „Ich möchte wieder ein Baum sein“. Oder: „In mir, nächtens“, das zudem auf eindrucksvolle Weise die im aufgeklärten Äon verdrängten, nicht-benannten Wesen der Nacht besingt. In einer berauschend dunklen Tiefe, die an die „Nacht“ Novalis gemahnt.
Im Gedicht „Flut“ vereinigen sich Schönheit und ewige Weisheit auf mythische Weise:
Wenn/das Licht/schwächer wird/kehrt das Meer/in mir/zurück//Knie über/ Knöchel/stirngetaucht/Brandung mein Atem/lebendig/bis/zum/Horizont
In den Raum jenseits des Reichs der kahlen Vernunft entführt uns Laimers Lyrik. Selbst wenn manches schattig, fraglich und fragil erscheint, weiden ihre Verse uns auf Oasen sprießend saftigen Lebens, voll all der Schattierungen von Grün. Einhörner, Drachen, Waldgeister, Wölfe, Mond und Sonne, eine mütterliche Erde bevölkern ihre Gedichtlandschaften – von dort winken sie uns, auf dass wir über die zitternde Hängebrücke eilen, in der Anderswelt zumindest mit unserer Seele zu leben, Seite an Seite mit der glückvollen Phantasie.
Bestellbar im Buchhandel über ISBN 978-3-9503442-5-7
Lug und Trug und Rat und Streben
 Geistreiches Vermächtnis
Geistreiches Vermächtnis
«Ich liebe mein Buch, aber ich kann es nicht empfehlen», so sibyllinisch äußerte sich die kürzlich verstorbene Schriftstellerin Silvia Bovenschen über ihren jetzt posthum erschienenen Roman «Lug & Trug & Rat & Streben». Sie habe sich darin alles erlaubt, warnte die Autorin, er würde von Leuten handeln, die in dieser Zeit leben und merkwürdige Erfahrungen machen. Die feministische 68erin gehört zweifellos zu den wenigen Intellektuellen der deutschen Gegenwartsliteratur, sie negiert in ihren Romanen althergebrachte Erzählkonventionen, profiliert sich stattdessen als streitbare Kämpferin für eine Dichtkunst im wahrsten Sinne des Wortes.
In einer alten Villa, die Alma und ihr Schwager Bärentrost geerbt haben, lebt völlig zurückgezogen der Schwager mit einer Haushälterin im Souterrain, Almas geschiedene Nichte Agnes bewohnt – für eine nur symbolische Miete – das Erdgeschoss. Über ihr wohnt die Tante selbst, das Dachgeschoß wiederum ist unbewohnt, es steht voller alter Möbel und Gerümpel, Theaterrequisiten gleich. Alle drei sind ausgesprochene Exzentriker, die unbeirrt ihre wunderlichen Marotten pflegen und sich am liebsten aus dem Wege gehen. Alma führt allenfalls kurz angebundene Telefonate mit ihrem Schwager, wenn es wegen der Villa etwas zu besprechen gibt, ansonsten reden sie kaum ein Wort miteinander. Als Almas altkluger, zwölfjähriger Enkel Max zu Besuch kommt, erweist sich der Dachboden als Kinderparadies, in dem es phantastische Schätze zu entdecken gibt. Schließlich gesellt sich noch trickreich Mr. Odino, ein Ex-Verehrer von Alma, zu den Bewohnern der Villa und bezieht eine winzige Kammer im Dachgeschoß, obwohl Alma ihn zunächst brüsk abweist, als er nach Jahrzehnten so plötzlich auftaucht.
Silvia Bovenschen beschreibt ihre schrulligen Figuren nicht, sie entwickeln sich vielmehr aus ihrem Tun heraus und aus dem, was sie miteinander reden. Agnes, eine attraktive Frau Anfang vierzig, wird von ihrem Liebhaber zur Heirat gedrängt, fürchtet sich jedoch davor, mit Frederic «in seinem gnadenlos durchgestylten Penthouse» zu wohnen. Alma, Bärentrost und Mr. Odino, Geisteswissenschaftler alle drei, sind hoch gebildete, gleichwohl skurrile Alte, deren köstliche Dispute untereinander wie auch die dozierenden Gespräche mit dem wissbegierigen Max eine Fülle von witzigen Reflexionen enthalten, ergänzt um eine gehörige Portion beißender Gesellschaftskritik. Zudem notiert Bärentrost als Misanthrop mancherlei Kritisches in sein Notizbuch: «Der digitale Fanatismus. Weitaus schlimmer als der Eifer spätmittelalterlicher Dogmatiker. Weltweite Geistesdeformationen. Die Zurichtung der Körper und der Hirne. Eine eindimensional dressierte Menschheit. Allgemeine Denkverpflichtungen. Mentale Selbstauslieferung an die Interessen der Netzgiganten. Am nervigsten sind die Humordeformationen. Ja, es gibt ihn, den neoliberalen Humor. Dauerironisierung ohne kritische Distanz». Im furiosen Mittelteil des Romans reisen Max, Alma und Mr. Odino nach Mispelheim, ein in vielem an Hieronymus Bosch erinnernder, kurioser Höllentrip, und auch Freund Hein schleicht am Ende um die alte Villa.
Dieser Roman wirft mit sentimentalem Unterton Fragen der Menschheit auf und erweist sich dabei als ein Füllhorn kurioser, geistreicher Einfälle, er gibt aber auch witzige und kluge Antworten. Das Ganze wird geradezu spielerisch erzählt in einer turbulenten Geschichte mit märchenhaften Zügen, wobei drei allegorische Figuren, – an den Chor des altgriechischen Dramas erinnernd -, als Stimmen aus dem Off fungieren. All das fordert in seiner Rätselhaftigkeit den Leser zum Mitdenken heraus und entlarvt ganz nebenbei eulenspiegelartig unsere wohlstandsverwahrloste Spaßgesellschaft als zutiefst dekadent und verlogen. Mit ihren zügellosen Phantasien hat uns die Autorin in diesem Roman ihr literarisches Vermächtnis hinterlassen, als parodistisches Verwirrspiel ein ebenso ästhetisches wie intellektuelles Leseabenteuer, das man sehr wohl empfehlen kann.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Eine Schachtel Streichhölzer
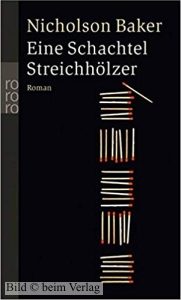 Sternstunde des Insignifikanten
Sternstunde des Insignifikanten
Wer den Plot für einen wichtigen, unverzichtbaren Bestandteil einer Erzählung hält, dem beweist Nicholson Baker mit seinem Kurzroman «Eine Schachtel Streichhölzer» das Gegenteil. Eine Handlung ist nämlich nicht mal rudimentär vorhanden, die Erzählung des US-amerikanischen Schriftstellers beschränkt sich einzig und allein auf Reflexionen seines Protagonisten, die ohne erkennbaren Zusammenhang aneinandergereiht sind. Und wie nicht anders zu erwarten polarisiert ein solcher Roman die Leserschaft, die Hälfte ist begeistert, die andere Hälfte entsetzt, Zwischentöne fehlen völlig, und auch das Feuilleton ist uneins oder ignoriert das Buch ganz einfach.
«Guten Morgen, es ist … Uhr». Mit diesen Worten begrüßt der Protagonist in jedem der 33 Kapitel seinen Leser, variiert wird nur die Uhrzeit, die jedoch immer «in aller Herrgotts Frühe» liegt. Emmett ist notorischer Frühaufsteher vom Schlaftypus Lerche, der uns eine plausible Antwort schuldig bleibt, warum er denn zu solch unchristlichen Zeiten aus den Federn steigt. Den 33 Kapiteln entsprechen 33 Tage, die mutmaßlich aufeinanderfolgen, – nur dass es Winter ist und kalt, soviel ist immerhin gewiss. Und deshalb ist das Feuermachen im Kamin auch die erste der allmorgendlichen Verrichtungen, die 33 Streichhölzer zum Anzünden sind auf dem Titelblatt zu sehen. Anschließend folgt dann Kaffeekochen und einen Apfel essen, ersatzweise eine Birne, erfahren wir. Dieser Morgenzauber findet in völliger Dunkelheit statt, um die noch schlafende Familie nicht aufzuwecken, und so hat er sich schließlich auch ganz unmännlich zum Sitzpinkler entwickelt, das morgendliche Zielen nach Gehör nämlich hat sich als unzuverlässige Methode erwiesen. Emmett ist ein 44jähriger Lektor medizinischer Lehrbücher, verheiratet, zwei Kinder, mit einem Jahresgehalt von siebzigtausend Dollar, von dem er gut leben kann, die Familie wohnt im eigenen Haus in Oldfield an der Ostküste. Es gibt dort auch eine Katze, eine Ente sowie die Ameise Fides, einzige Überlebende einer ganzen Ameisenfarm, die Tochter Phoebe zum dreijährigen Geburtstag geschenkt bekommen hat. Emmett ist jedenfalls mit sich und dem Leben zufrieden, ein gutmütiger, harmloser Zeitgenosse.
Diese allmorgendlichen Rituale verknüpfen assoziativ sämtliche Kapitel miteinander, wobei die Tagträume des Helden deren Inhalte bilden. All das ist unspektakulär Alltägliches, welches sich hier zu einer profanen Denklawine entwickelt. Nicholson Baker erweist sich als ein genialer Beschreibungskünstler, der sich an oberflächlich banal erscheinenden Dingen und Begebenheiten abarbeitet und den Leser mit dem verstörenden Stoizismus seines Protagonisten verblüfft. Das Banale jedoch erweist sich bei genauem Hinsehen als wunderbar stimmige Expedition in die Tiefe des Existentiellen, ins Innerste der Gefühle, ein narrativ als einfältige Erzählung kaschierter Bewusstseinsstrom des Protagonisten. Er ist ein Feuer hütender Alltagsphilosoph, dessen metaphysische Unbedarftheit fast schon sensationell ist, der als Figur jedenfalls ein Unikat darstellt in der heutigen Literatur. Und Vieles, was da gedacht, phantasiert und spintisiert wird erinnert einen an eigene Gedanken und Gefühle. Als harmloser, gutmütiger Tagträumer bringt Emmett einen ganz neuen, fast schon überirdischen Glanz in die Trivialität des Alltags, in die von uns allen so gern verleugneten Niederungen unseres Ichs.
Dieser Roman, der so selbstbewusst den vermeintlichen Zwang zur Handlung ignoriert, ist ein Triumph der Gelassenheit, immer besonnen, heiter und ironisch dem Profanen auf der Spur. In einem metaphernreichen Parcours durch die Gefilde gedanklicher Niederungen wird dabei, zuweilen fast unbemerkt, die US-amerikanische Gesellschaft gehörig kritisiert. Am Ende dieses Parforceritts ist die Streichholzschachtel jedenfalls leer und der Leser, wenn er denn in sich selbst hineinzuhören vermag, dem signifikant Insignifikanten deutlich näher als zu Beginn dieser heiteren Lektüre.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke (Alle Toten fliegen hoch Band 3)
 Hinter den Kulissen
Hinter den Kulissen
Was auf der Bühne anfing, das Erzählen aus seinem Leben, hat der Schauspieler Joachim Meyerhoff als autobiografischen Zyklus unter dem Titel «Alle Toten fliegen hoch» ebenso erfolgreich in Literatur verwandelt. «Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke», als Titel dem «Werther» von Goethe entlehnt, behandelt als dritter, alleinstehend lesbarer Roman der Reihe die Jahre seiner Ausbildung zum Schauspieler an der Otto-Falckenberg-Schule in München.
Ein Entwicklungsroman also, bei dem die moderne, progressive Ausbildung in der berühmten Mimen-Schmiede konterkariert wird vom konservativen Stillstand in der großbürgerlichen Villa seiner Großeltern am Nymphenburger Park, bei denen er während dieser Zeit wohnt. Er hatte sich eher spaßeshalber beworben und besteht die Aufnahmeprüfung als einer von neun unter vielen hundert Aspiranten, trotz hanebüchener Pannen übrigens und zu seiner eigenen Verblüffung, – aber auch zu der des Lesers! In zwei Strängen wird abwechselnd von dieser chaotischen Zeit als Schauspiel-Eleve erzählt, dem diametral sein wohlgeordnetes Privatleben mit den über alles geliebten Großeltern gegenübersteht. Der Großvater ist emeritierter Professor der Philosophie, ein berühmter Wissenschaftler, der schon mal Post vom Vatikan bekommt, die Großmutter eine von der Bühne her bekannte Schauspielerin, die auch im TV bei Derrick zu sehen war. Beide sind liebenswerte Originale mit einem ritualisierten Lebensrhythmus, in dem der Alkohol, in verschiedenster Form genossen, eine gewichtige Rolle spielt. Wobei der junge Mann so kräftig mithält, dass er beim Zubettgehen gelegentlich ebenfalls den Treppenlift der hochbetagten Großeltern benutzt nach einer allzu lustvollen Zecherei, – bei der aber stets die Contenance gewahrt bleibt. Die chaotische, ja hirnrissig erscheinende Ausbildung wird im zweiten Handlungsstrang als eine mentale Tortur dargestellt, immer wieder fragt sich der überforderte Held entnervt, warum er sich das alles antut, ob er nicht besser aussteigt und Medizin studiert. «Was, Großvater, frage ich, ist denn der Kern der Schauspielerei?» […] «Der Moment. Jeder einzelne Augenblick, würde ich sagen. Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze. Aber er hat den Augenblick».
Mit feinem Gespür für das Menschliche beschreibt der Autor die Schar seiner zumeist skurrilen Figuren, von den kauzigen Großeltern bis hin zur Schauspielschule mit ihren durchgeknallten Lehrern und den oft recht merkwürdig erscheinenden Mitschülern. Auffallend ist dabei, dass dieser gutaussehende, athletische junge Mann Anfang zwanzig all die Zeit über keine Freundin hat, eine geradezu mönchische Lebensweise. Dazu passt denn auch eine Szene, in der ein Filmregisseur die greise Großmutter für eine Verfilmung der Erzählung «Ein Ring» von Paul Heyse gewinnen will, die mit einem wundervollen Satz endet: «Höre mein Liebkind, das Schlimmste ist, wenn man bereut, dass man nichts zu bereuen hat». Wie auch immer, das Asketische – der Figur und des gesamten Romans – bleibt rätselhaft.
Die «Lücke» im Titel dieser Geschichte bezieht sich auf den Verlust geliebter Menschen. Mit großer Empathie erzählt der Autor zunächst vom Tod des jung gestorbenen Bruders, von dem seines geliebten Vaters und schließlich von dem der Großeltern, deren beider Lebenslicht ohne Schmerzen und Todeskampf friedlich verloschen ist. Die gleichwohl ironische Distanz des Erzählers lässt den Leser bei aller Betroffenheit zuweilen auch schmunzeln, zu komisch sind doch manche der deutlich fiktional überhöhten Szenen. Dazu gehört denn auch dieses ständige Neben-sich-stehen des Helden, die permanente Selbstanalyse. Geradezu nervig fand ich die narrative Langatmigkeit, das träge Dahinfließen des Plots, das dominant Anekdotische zudem mit seiner extremen Ausführlichkeit. Ohne Zweifel sind aber der Blick hinter die Kulissen, – hier ja mal im wahrsten Sinne des Wortes -, und die allzumenschliche Atmosphäre in der alten Villa bereichernd und unterhaltend zugleich.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Wölfe im Münsterland
 Anfang April 2016 riss ein Wolfsrüde drei Schafe in der Nähe von Oelde. Nach Jahrhunderten gab es damit wieder Wölfe im Münsterland. Nun nimmt die im Outback von Drensteinfurt lebende Diplom-Pädagogin Sabine Gronover sich des Themas als Ausgangspunkt für einen Regionalkrimi an. Weiterlesen
Anfang April 2016 riss ein Wolfsrüde drei Schafe in der Nähe von Oelde. Nach Jahrhunderten gab es damit wieder Wölfe im Münsterland. Nun nimmt die im Outback von Drensteinfurt lebende Diplom-Pädagogin Sabine Gronover sich des Themas als Ausgangspunkt für einen Regionalkrimi an. Weiterlesen
Die vier Söhne des Doktor March

Dienstmädchen Jeanie arbeitet für Doktor March und seine Familie.
Eines Tages findet sie im Schlafzimmer der Hausherrin ein Tagebuch,in dem ein Mord beschrieben wird, der tatsächlich in nächster Umgebung so geschehen ist. Und offenbar ist einer der vier Söhne des Doktor March der Täter, der in diesem Tagebuch nicht nur diese, sondern auch folgende Taten ausführlich beschreibt.
Doch welcher der Vier ist es? Noch während Jeanie versucht, das herauszufinden, gerät sie selbst ins Visier des Täters…
Dieses Buch ist ein aussergewöhnlicher Thriller, an dessen Stil ich mich erst gewöhnen musste. Denn man folgt der Handlung anhand der Tagebucheinträge des Mörders und des Zimmermädchens. Hat man sich einmal daran gewöhnt, kann man sich dem Sog der Geschichte nicht mehr entziehen.
Hausmädchen Jeannie findet im Haus der Familie March ein Tagebuch, dessen Inhalt sie erschauern lässt. Hier beschreibt jemand grausame Taten, die offenbar nicht nacherzählt sind, sondern vom Täter selbst niedergeschrieben. Und dieser ist ein Mitglied der Familie. Somit lebt sie mit dem Mörder unter einem Dach und will herausfinden, wer er ist. Ihr Verdacht fällt schnell auf die jungen Familienmitglieder. Während sie die Söhne des Hausherren beobachtet, hält sie ihre Erkenntnisse ihrerseits in einem Tagebuch fest. Irgendwann beginnt der Täter, sich in seinen Einträgen auf Ihre zu beziehen, auf sie zu antworten. Jeanie begreift, das sie in Gefahr ist- aber wie soll sie sich gegen jemanden schützen, der ihr täglich nah ist, ohne das sie weiß, wer es ist…
Noch dazu ist sie selbst nicht ohne Fehl und Tadel, sie ist in der Vergangenheit mit dem Gesetz in Konflikt geraten, konnte das aber geschickt verbergen. Allerdings offenbar nicht geschickt genug, denn jemand hat herausgefunden, was sie getan hat. Und das gibt diesem Jemand, unserem gesuchten Mörder, einen Trumpf in die Hand, den er ungeniert ausspielt.
Die Geschichte ist extrem fesselnd, gerade durch ihre aussergewöhnliche Erzählform. Man rätselt verzweifelt mit, wer der Täter sein könnte und bangt um Jeanies Sicherheit.
Spannende Unterhaltung der etwas anderen Art!
Quasikristalle
 Superfrau mit Macken
Superfrau mit Macken
Die Rezeption des Romans «Quasikristalle» der österreichischen Schriftstellerin Eva Menasse ist ziemlich konträr. Als Chemie-Nobelpreisträger Daniel Shechtman 1982 die aperiodisch angeordneten Kristalle entdeckte, deren Aufbau von der bis dato wissenschaftlich unstrittig als vorgegeben angesehenen, streng symmetrischen Struktur abwich, erntete er zunächst ebenfalls erbitterten Widerspruch. Der Titel des Buches weist auf eine ähnliche Ungeordnetheit hin, auf die Biografie der eher chaotisch veranlagten Protagonistin nämlich, einer gleichwohl toughen Frau, deren turbulentes Leben in dreizehn Kapiteln erzählt wird. Ein Frauenroman also, der dem Thema offensichtlich neue Seiten abgewinnen will.
In den nur lose zusammenhängenden Kapiteln breitet die Autorin das Leben von Roxane Molin in vielen Facetten vor uns aus, beginnend im Backfischalter in einem Wiener Gymnasium. Es ist ein breites Themenspektrum, das in diesem Roman abgedeckt wird, und es ist denn auch der Tod, dem Xane gleich am Anfang begegnet, als ihre Freundin plötzlich stirbt. Wir erleben sie bei einer Exkursion nach Auschwitz, in einer Fernsehdebatte nach einem Kurzfilm von ihr, in der sie vehement Stellung nimmt gegen den latenten Faschismus in Österreich: Sie habe die verlogene Mozartkugel-Seligkeit gründlich satt. In Berlin, wohin sie erbost umsiedelt, betreibt sie eine alternative Marketing-Agentur, landet in einer Patchwork-Familie mit zwei Stieftöchtern, bekommt nach einer In-vitro-Fertilisation endlich auch selbst ein Kind und durchläuft alle Höhen und Tiefen des Ehelebens. Sie lernt irgendwann einen deutlich älteren Mann kennen, Ankläger des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag, eine rein platonische Beziehung. Natürlich sind auch Seitensprünge Thema in diesem turbulenten Roman, und auch das knallharte Berufsleben in Xanes kreativer Agentur, wo hymnisches Lob und gnadenloser Rausschmiss durch die Chefin sehr nahe beieinander liegen. Seitensprünge, gescheiterte Ehen, Flucht in den Ashram, schwierige Kinder, Drogenprobleme, Seniorenheim, Pflegemissstand, Sterbehilfe, in Eva Menasses Themenspektrum bleibt kaum ein Phänomen der Jetztzeit ausgespart, von dem Frauen tangiert sind. Sogar Xanes kühner Plan, als Großmutter zurück nach Wien zu gehen und mit dem Rest ihres Lebens in ihrer Heimatstadt noch mal etwas ganz Neues zu wagen, wird am Ende dezent angedeutet.
Angedeutet wird auch Vieles sonst in diesem Roman, die einzelnen Kapitel lassen jedenfalls reichlich Leerraum für eigene Phantasien des Lesers bei dieser großangelegten Suche nach Identität. Die Frau wird als kleines Mädchen, Pubertierende, Freundin, Ehefrau, Mutter, Großmutter, Geliebte, Kameradin, Künstlerin, Hochbegabte, Mitarbeiterin, Chefin und Ärztin gezeigt. Was ist wahr an dem Bild, das wir von uns haben? Mit feinem Gespür für psychische Befindlichkeiten wird hier stimmig ein Panorama heutiger Weiblichkeit aufgezeigt, wie es nur eine weibliche Autorin vermag, aus einer eindeutig femininen Perspektive also. Das wird nicht zuletzt beim Thema Sex deutlich, das hier äußerst diskret umschifft wird, mithin also auch hierbei nur dezente Andeutungen, – was das Ganze etwas betulich wirken lässt, denn auch das gehört nun mal zum Frau-Sein dazu.
Das Erzählte spielt sich weitgehend in einem gehobenen Großstadt-Milieu ab. Eva Menasses Sprache ist elegant, leicht lesbar und überrascht zuweilen mit gekonnten Wortgebilden wie der «halbjüdischen Doppelhelix». Das den Verknüpfungsmustern der «Quasikristalle» ähnelnde narrativem Konzept mit seinen selbständigen, in sich abgeschlossen Kapiteln stellt für den Leser allerdings eine Hürde dar, er findet keinen Erzählfaden, sondern muss die Puzzleteile selbst zusammensetzen. Teilweise entsteht so zuweilen sogar ein sich widersprechendes Bild der Protagonistin, deren Identität zu ergründen, deren Charakter offenzulegen ja die Intention der Autorin gewesen sein dürfte. Ein Manko sicherlich, aber lesenswert ist dieser Roman allemal!
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Was vom Tage übrig blieb
 Ungelebtes Leben
Ungelebtes Leben
«Was vom Tage übrig blieb» ist der berühmteste Roman des britischen Schriftstellers Kazuo Ishiguro, er erhielt 1989 dafür den Booker Prize, das Buch wurde vier Jahre später verfilmt. Auf der 2015 erschienenen BBC-Liste der hundert bedeutendsten britischen Romane rangiert dieser Roman auf Platz 18. Im vergangenen Jahr erhielt Ishiguro den Nobelpreis als ein Schriftsteller, «der in Romanen von starker emotionaler Wirkung den Abgrund in unserer vermeintlichen Verbundenheit mit der Welt aufgedeckt hat.» Der Abgrund ist hier die bittere Erkenntnis des Ich-Erzählers am Ende seiner glamourösen Karriere als Butler, dass er mit seinem Kadavergehorsam dem falschen Herrn gedient und in blinder Selbstverleugnung damit auch sein eigenes Leben vergeudet hat.
Dreißig Jahre lang hatte der Butler Stevens seinem Herrn Lord Darlington auf dessen Landsitz Darlington Hill treu ergeben gedient. Nach dessen Tod wurde der Besitz an den amerikanischen Millionär Farraday verkauft, der die hochherrschaftliche Bewirtschaftung mit ehemals fast dreißig Angestellten auf eine Hand voll Mitarbeiter reduziert hat, was zu kaum lösbaren Problemen für den Butler führt. Ein Brief der ehemaligen Haushälterin Miss Kenton lässt ihn hoffen, sie nach mehr als zwei Jahrzehnten zu einer Rückkehr bewegen zu können, um die gravierende personelle Lücke zu schließen. Auf Wunsch seines neuen Dienstherrn begibt er sich im Spätsommer des Jahres 1956 auf eine einwöchige Erholungsreise, bei der er auch die inzwischen verheiratete und sich auf das erste Enkelkind freuende Miss Kenton aufsuchen will.
Diese Reise bildet die erzählerische Klammer für die Geschichte eines Butlers, dessen ganzer Lebensinhalt das Dienen für seinen Herrn war. Privates musste dabei zurückstehen, schüchterne Annäherungsversuche von Miss Kenton wurden von ihm brüsk zurückgewiesen, ja er hat sie als solche nicht mal erkannt und blieb auf verletzender Distanz zu ihr. Sein Diensteifer ging so weit, dass er, als sein Vater während eines Dinners mit hochrangigen Gästen im Dienstbotenzimmer im Sterben lag, seinen Dienst nicht unterbrach, Miss Kenton musste dem Vater die Augen schließen, Stevens war unabkömmlich. In Rückblenden lässt Ishiguro seinen Protagonisten über seine Ideale vom perfekten Butler dozieren. Sein Held dröselt in epischer Breite das Berufsethos dieser typisch britischen Ausprägung eines Majordomus auf, als dessen wichtigste Eigenschaft er die Würde benennt, – die zu definieren sich dann aber doch als recht schwierig erweist. Aber er berichtet nicht nur über den devoten Charakter dieses Berufsstandes, sondern äußerst detailliert, – für meinen Geschmack deutlich zu detailliert -, auch über das nüchterne Arbeitsleben mit allen seinen wunderlichen Usancen und skurrilen Riten, bei denen das Silberputzen an erster Stelle zu stehen scheint. Darlington Hill ist Treffpunkt vieler Größen aus der Politik, die in zum Teil konspirativen Treffen mit Nazideutschland sympathisieren und nicht erkennen, dass sie einen Bund mit dem Teufel einzugehen im Begriff sind. Stevens aber vertraut seiner Lordschaft blindlings, lässt sich auch von Darlingtons jungem Verwandten nicht beirren in seinem Vertrauen auf die integren Motive seines Dienstherrn.
Dieser Butler ist als Ich-Erzähler geradezu der Prototyp narrativer Unzuverlässigkeit, jenes vor allem aus der Romantik bekannten Stilmittels, dessen sich Ishiguro hier äußerst souverän in einer nüchternen, disziplinierten Sprache bedient, – die Butlerwürde fungiert dabei als Rechtfertigung für mancherlei Täuschungen. Der Autor belässt seiner Figur trotz deren emotionaler Leere aber einen Rest von Menschlichkeit, deutet am Ende sogar, als Stevens bei Sonnenuntergang inmitten fröhlicher Menschen auf einer Bank am Meer sitzt, noch eine versöhnliche Perspektive an. Eine leise Hoffnung nämlich für das, «was vom Tage übrig blieb», für den Rest seines bis dato, – so weit ist Stevens Selbstbesinnung inzwischen gediehen -, ungelebten Lebens.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Rolling Stones: I Was There

Es herrscht ja nun wahrlich kein Mangel an Literatur über die größte Rock ‘n’ Roll Band der Welt, auch über die einzelnen Protagonisten der Rolling Stones findet der Fan mühelos genügend Bücher höchst unterschiedlicher Qualität.
Richard Houghton hat mit »Rolling Stones: I was there« einen anderen Weg eingeschlagen als die meisten Autoren: Anstatt die sattsam bekannten Frauen- und Drogengeschichten zum drölfzigsten Mal auszuwalzen oder die unzähligen Hits und Platten aufzulisten, lässt er chronologisch Augen- und Ohrenzeugen der Konzerte zu Wort kommen; von den Anfängen der Band 1962 in düsteren Kellern Londoner Clubs bis zum legendären Auftritt im Hyde Park 1969, wenige Tage nach dem Tod von Brian Jones.
Der Leser begibt sich damit auf eine faszinierende Zeitreise in die 60er Jahre; die Jüngeren lernen durch die authentischen Berichte viel über das damalige Lebensgefühl, während ältere Semester in Erinnerungen schwelgen können. Immer wiederkehrende Themen sind zum Beispiel die Skepsis der Eltern gegenüber den Stones (im Gegensatz zu den Beatles); die so manchem jungen Konzertbesucher eine Menge findiger Kreativität abnötigte, um dabei zu sein oder die Hysterie der (meist weiblichen) Fans, die durch ihr permanentes Geschrei verhinderten, dass man etwas von den Songs verstand.
Interessant auch die unterschiedliche Wahrnehmung der Darbietungen: Während sich manche Zeitzeugen begeistert über den Sound äußern, beklagen andere Besucher (desselben Konzerts) die miese Qualität. Viele Fans sahen die Stones in den 60ern mit Freund oder Freundin und nicht wenige davon feierten inzwischen goldene Hochzeit mit dem damaligen Partner; fast allen der im Buch zu Wort kommenden Musikfreunde ist jedoch eines gemeinsam: Sie lieben die Band bis heute.
Richard Houghton lässt mit den Ohrenzeugenberichten die Entwicklung der frühen Stones Revue passieren; die Anfänge als Bluesband vor einer Handvoll Zuhörer bis zu den Superstars im Hyde Park vor einer halben Million (etliche Fotos der Musiker und der jungen Konzertbesucher gibt es auch). Und Superstars sind sie 50 Jahre später immer noch, unverwüstlich und unerreicht. »Rolling Stones: I was there« ist ein faszinierendes Dokument der Zeit- und Musikgeschichte nicht nur für Fans, sondern für alle, die sich für diese aufregenden Jahre interessieren. Über eine Fortsetzung würde sicherlich nicht nur ich mich freuen…
Das Singen der Sirenen
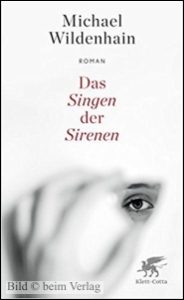 Literarisch ein Solitär
Literarisch ein Solitär
Mit dem Roman «Das Singen der Sirenen» gelang Michael Wildenhain eine überzeugende Synthese aus Inhalt und Stil, aus zeitaktueller Themenvielfalt und bravourös variierter Sprache. Wobei eines seiner Themen schon im Titel anklingt, ist doch der Protagonist wie Odysseus den Verlockungen der Sirenen ausgesetzt, – nur dass niemand den Romanhelden an den Mast bindet. Ein Liebesroman also? Mitnichten! Der Autor hat als ehemaliger Hausbesetzer und Linker soziale, politische, ethische und ökonomische Themen eingebunden in seinen Plot, der zeitlich im Jahre 2010 angesiedelt ist.
Dr. Jörg Krippen, Literaturwissenschaftler, Dramatiker und Frankenstein-Spezialist, wird als Gastdozent nach London eingeladen. Ein willkommener Job, denn eine Karriere als Wissenschaftler hat er längst verpasst, er lebt in prekären Verhältnissen mit Frau und fünfzehnjährigem Sohn Leon in einem Plattenbau in Berlin-Hellersdorf. Sabrina arbeitet als Lageristin, beide waren aktive Mitglieder einer militanten Antifa-Gruppe, haben sich aber aus Angst vor Vergeltung in ein unauffälliges Privatleben zurückgezogen, nachdem die beinharte, prollige Sabrina bei einem Überfall einen Neonazi angeschossen hatte. Auf dem Campus in London trifft Krippen auf Mae, eine an ihrer Promotion arbeitende, deutlich jüngere und überaus attraktive Stammzellen-Forscherin indischer Herkunft, die schon bald seine Geliebte wird. Und ihm dann überraschend seinen elfjährigen, unehelichen Sohn Raji präsentiert, Ergebnis eines Seitensprungs mit ihrer älteren Schwester. Ein Gentest bestätigt seine Vaterschaft, ergibt aber als unerwartetes Nebenergebnis, dass er nicht der Vater von Leon ist.
Der Erzählstoff kreist um polarisierende Themen, die akademische Rivalität zwischen Geistes- und Naturwissenschaften zum Beispiel, oder gebildete Geliebte und proletenhafte Ehefrau, sexuell beglückende Liebe und unerwünschte Fortpflanzung, er lebt aber auch vom kulturellen Kontrast zwischen westlichem und östlichem, hier indischem Lebensstil, – selbst Pegida wird thematisiert. Die beiden Söhne Raji und Leon könnten unterschiedlicher nicht sein, draufgängerischer Rugbyspieler und Schachgenie der eine, untalentierter Fußballer der andere. Natürlich spart Wildenhain als Linker auch nicht mit Kapitalismuskritik, personifiziert hier durch den Cousin von Mae, der viel Geld verdient, ohne dass wirklich klar wird, womit, während Jörg als Dramatiker auf Hartz 4 angewiesen wäre ohne seine Gastdozentur. Der antriebslose Protagonist, ein typischer Looser, übt eine unerklärliche Anziehungskraft auf Frauen aus, dem auch die «schöne Russin» erlegen ist, Regisseurin eines seiner erfolglosen Bühnenwerke. Als Liebhaber bringt er Frau und Geliebte im Bett gleichermaßen zum Stöhnen, der Sex wird jedoch niemals vulgär erzählt, sondern ausgesprochen dezent, eher beiläufig, erwähnt. Erzählerisches Meisterstück ist der Kuss im 49ten, dem vorletzten Kapitel: «Es ist ein Kuss, der, wie Alice Munro es ausdrückt, ein Ereignis für sich ist», der Abschiedskuss von Mae nämlich, nachdem er sich endgültig zur Rückkehr nach Deutschland entschieden hat. «Denk nach, Jörg Krippen, geh in dich, horche in dich hinein, weißt du, wogegen du dich entscheidest?» sagt die Erzählerstimme, als er Mae im Arm hält. Grandios, diese knapp zwei Seiten!
Wildenhain jongliert sprachlich virtuos mit verschiedenen Stilen, variiert sie stimmig und szenensynchron nach Erzählsträngen, wechselt perspektivisch von der Ich- zur Er-Erzählform oder auch zur Du-Form und deutet, kursiv gesetzt, am Ende als auktorialer Erzähler sehr berührend das weitere Schicksal seiner Figuren an. Seine bilderreiche Sprache ist komplex, changiert von stakkatoartigen Wortfetzen zu ambitionierten Satzgebilden, vom Gassenjargon bis zur fein ziselierten Hochsprache. Ich habe in der deutschen Gegenwartsliteratur schon lange nichts Vergleichbares mehr gelesen, literarisch ein Solitär also, – bereichernd, erfreuend und unterhaltend im besten Sinne!
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
Dark Matter. Der Zeitenläufer

Dark Matter. Der Zeitenläufer von Blake Crouch
Was wäre wenn? In diese spannende Frage taucht US-Autor Blake Crouch ein, indem er sich des Phänomens der Paralleluniversen annimmt. Er macht es auf spielerische Weise und verlangt keinerlei Vorkenntnisse in theoretischer Physik oder welcher Disziplin auch immer. Das macht den Roman, der zum Science-Fiction-Genre gerechnet werden kann, zu einer angenehmen Lektüre. Doch Vorsicht: Der Stoff hat es in sich! Weiterlesen
Von dieser Welt
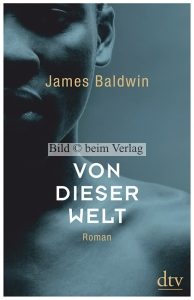 Apokalyptisches Klagelied
Apokalyptisches Klagelied
Der Hype um den in den USA wiederentdeckten farbigen Schriftsteller James Baldwin hat nun auch uns erreicht, die aktuelle Neuübersetzung seines autobiografischen Debütromans von 1953 «Go Tell It on the Mountain» wird vom Feuilleton allenthalben gefeiert. Wobei der Titel der neuen deutschen Ausgabe «Von dieser Welt» ein wenig ablenkt von dem, was den Leser wirklich erwartet, bezieht sich doch der Originaltitel auf ein allseits bekanntes, oft gehörtes Spiritual. Womit das beherrschende Thema des Romans weitaus treffender verdeutlicht wird, es geht nämlich um religiöse Inbrunst, ausgelöst hier durch das schreiende Unrecht der Rassendiskriminierung. Die aber ist auch heute noch weitgehend unveränderte Wirklichkeit im «Land der unbegrenzten Möglichkeiten», entsprechende Nachrichten von dort, untermauert durch die einschlägigen Polizeistatistiken, erinnern uns regelmäßig wieder daran. Und der offen rassistische Präsident ist als Nachfolger des ersten Farbigen in diesem Amt ein überdeutliches Indiz für diese reaktionäre Entwicklung, eine Rolle rückwärts also in der Rassenfrage. «Sein Werk altert nicht» heißt es über Baldwin im Vorwort, dabei wünscht man sich, dieser Roman wäre weniger aktuell.
Anders als die meisten seiner Zunft entwickelt Baldwin seine Thematik fast ausschließlich aus dem Innenleben seiner Figuren heraus, berichtet von den seelischen Verheerungen, die das schreiende Unrecht bei der unterdrückten farbigen Bevölkerung anrichtet. In der Rahmenhandlung der im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts angesiedelten Geschichte fungiert John als äußere Klammer, er droht auf der Suche nach sich selbst zu scheitern. «Alle hatten immer gesagt, John werde später mal Prediger» lautet der erste Satz. Als ihm 1935, am Morgen seines 14ten Geburtstages, seine nächtliche Masturbation bewusst wird, als in seiner Fantasie ein Fleck an der Zimmerdecke sich in eine nackte Frau verwandelt, ist sein Schrecken grenzenlos, er fühlt sich auf ewig verdammt. Der Tag endet in der Kirche, wo er in einer rauschhaften Erweckungsszene, im rasenden Kampf wütend mit sich selbst ringend, vor dem Altar liegt und endlich zu Gott findet.
In drei Teilen behandelt der Roman in Rückblicken die Biografie von Johns Stiefvater, unerbittlicher Laienprediger und böser Heuchler zugleich, von seiner Mutter und der Schwester des Vaters. Alle drei waren Kinder von Sklaven, die der Gewalt des Südens zu entkommen suchten, um dann in New York das Elend zu finden. Baldwin thematisiert den Hass der Farbigen, wobei der sich erstaunlicher Weise gegen sie selbst richtet, sie fühlen sich schuldig und sind Opfer ihrer Selbstverachtung. Ihr Leben wird bestimmt von Armut, Angst, Hass, Gewalt, – und von der Hölle, die ihnen ein rigider Pietismus unermüdlich einredet, indem er selbst alltägliche Ereignisse permanent als Menetekel an die Wand malt, immer nach dem Motto: Es gibt keine Unschuldigen! Als Sohn eines Baptistenpredigers ist dem Autor dieser religiöse Fanatismus quasi schon mit der Muttermilch eingegeben, die fatale Lebensfeindlichkeit seiner Geschichte ist also vorbestimmt, verschärft noch durch seine, auch im Roman anklingende, Homosexualität. Die naive Gläubigkeit seiner Figuren dient als Ausweg aus ihrem Dilemma, kompensiert den Unbill ihres prekären Lebens.
Streckenweise liest sich dieser Roman, seiner unverblümten Indoktrination wegen, wie naivste Erbauungsliteratur, deren Sprache in Diktion, Melodie und Rhythmus, in ihren häufigen Wiederholungen zudem, stark an das Alte Testament erinnert. Vergleicht man Baldwin mit Jerome David Salinger, Harper Lee, William Faulkner, E. L. Doctorow, so fällt die einseitige Perspektive von Baldwin auf, er stimmt ein apokalyptisches Klagelied an, das alle anderen Aspekte ausblendet und die Welt einseitig als Jammertal darstellt. Spätestens bei der Religion aber endet jede rationale Diskussion, über die Lesefrüchte, die dieser Roman uns beschert, hüllen wir also besser den Mantel des Schweigens.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Spanische Delikatessen
 Eva Siegmund liebt Barcelona. Unter dem geschickt gewählten Pseudonym Catalina Ferrera führt sie den Leser zu einigen ihrer Lieblingsplätze, informiert über kulturelle und soziale Hintergründe und vermittelt den Reiz der malerischen Stadt am Mittelmeer.
Eva Siegmund liebt Barcelona. Unter dem geschickt gewählten Pseudonym Catalina Ferrera führt sie den Leser zu einigen ihrer Lieblingsplätze, informiert über kulturelle und soziale Hintergründe und vermittelt den Reiz der malerischen Stadt am Mittelmeer.
Apollokalypse
 Poststrukturalistisches Chaos
Poststrukturalistisches Chaos
Der vielseitig tätige Schriftsteller Bernhard Falkner hat 2016 mit «Apollokalypse» sein Prosadebüt vorgelegt, ein Epochenroman aus dem Berlin der achtziger und neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, der es auf Anhieb auf die Longlist des Deutschen Buchpreises 2016 geschafft hat. Der Neologismus seines Titels spiegelt das Schöne und Verführerische in der totalen Zerstörung. Gott seines Romans ist ein zwielichtiger, dionysischer Held, dem nach allmählichem Zerbrechen sämtlicher Illusionen schließlich der Leibhaftige gegenübertritt. Mehr als zehn Jahre, so wird kolportiert, hat der österreichische Lyriker sich Zeit gelassen für seinen Roman-Erstling, dessen beeindruckende Bildermacht und Intertextualität vom Feuilleton zum Teil bejubelt wurde, während Andere jedwede erzählerische Kontinuität vermissen und am Falknerschen «Wortgeschwurbel» zu ersticken drohen. «Meine Vermieterin sagt, dies hier wäre ein schlechter Roman», lässt der Autor mit geheuchelter Selbstkritik seinen Doppelgänger sagen, und er liefert wortreich auch gleich die Gründe dafür mit.
«Wenn man verliebt ist und gut gefickt hat, verdoppelt die Welt ihre Anstrengung, in Erscheinung zu treten» lautet symptomatisch der erste Satz des Romans. Georg Autenrieth, eine undurchsichtige Gestalt aus Westdeutschland, ist dem Sog der Metropole erlegen und durchstreift auf der Suche nach Genuss die einschlägige Szene Berlins in der Wendezeit. Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll stehen im Mittelpunkt einer extensiv ausgelebten Lebensgier, die sich völlig unpolitisch gibt, selbst der Mauerfall wird nicht thematisiert. Gleichwohl unterhält der junge Mann scheinbar Kontakte zur RAF und zu den Geheimdiensten beider Deutschlands, – scheinbar, denn wie alles bleibt auch das vage in diesem Roman, der sich immer wieder in Andeutungen verliert. Die Wendepunkte dabei setzten Frauen: «Das Buch Isabel» widmet sich der Geschichte seines manisch-depressiven Freundes Büttner, eines exaltierten Künstlers, dem er die Freundin ausspannt, indem er sie zu einer Reise in die USA einlädt, deren Höhepunkt eine feuchtfröhliche Nacht bei Musik vom Plattenspieler im Amargosa Opera House von Death Valley Junction bildet. Büttner landet in der Psychiatrie und wirft sich später vor den Zug, was bei Autenrieth zu einer Identitätskrise führt, in deren Verlauf er untertaucht, sich als «Glasmann» unsichtbar zu machen sucht. Die zweite Zäsur unter dem Titel «Das Buch Billy» ist dann die leidenschaftliche Affäre mit Bilijana, einer undurchsichtigen Bulgarin, die mit einem deutschen Militärattaché liiert ist. Alle diese zwiespältigen Figuren bewegen sich voller Obsessionen in einem geradezu mythologischen Berlin, welches sie voller burlesk überzeichneter Ausschweifungen rauschhaft erleben, das sie dann aber immer wieder ernüchtert auf sich selbst zurückwirft.
Eine den Leser faszinierende Geschichte auszubreiten ist Gerhard Falkners Sache nicht, das Atmosphärische bildmächtig und sprachverliebt in allen seinen Facetten auszubreiten ist schon eher sein Metier, der Lyriker in ihm ist partout nicht zu verleugnen. Dabei stört das vulgär Sexuelle seines narzisstischen Helden mit den multiplen Identitäten, der zuweilen neckisch mit sich selber spricht und als Figur vom Autor selbst kaum noch unterscheidbar ist. Als Poststrukturalist bildet Falkner mit seiner Sprachmacht Realität nicht nur ab, er erschafft sie vielmehr selbst durch seine radikale Abkehr von einer objektivistischen Sicht sozialer oder moralischer Kriterien.
Sein Anspielungsreichtum wirkt dabei selbstverliebt überzogen, die Literaturgeschichte wird schon fast parodistisch einbezogen in den schwer lesbaren, diskontinuierlichen Erzählfluss, der heftig zwischen Schein und Sein mäandert. So bleibt dem Leser als Lektürebonus die grandiose Beschreibungskunst des Autors, der mit scharfem Blick hinter die Fassaden Berlins schaut, sein narratives Chaos aber nicht auflöst, der alles in der Schwebe hält bis zum Schluss.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de

