 Schwarze Löcher als Metapher
Schwarze Löcher als Metapher
Mit ihrem Roman-Debüt «Das flüssige Land» hatte Raphaela Edelbauer schon 2018 den Publikumspreis in Klagenfurt erhalten, nun kam sie damit sehr zu recht auf die Shortlist des diesjährigen Frankfurter Buchpreises. Als Jurymitglied hätte ich eher für sie als Preisträgerin gestimmt, aber das Migrations-Thema ist derzeit wohl gar zu übermächtig und verspricht wohl weit höhere Auflagen als ein surrealer Roman, auch wenn der literarisch besser gelungen erscheint und zudem deutlich unterhaltsamer ist.
Die 35jährige Wiener Physikerin Ruth steht kurz vor ihrer Habilitation, als sie die Nachricht erhält, ihre Eltern seien beide bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Deren schriftlich hinterlassener Wunsch, im Ort ihrer Kindheit beerdigt zu werden, bereitet der Ich-Erzählerin nun aber große Probleme, denn Groß-Einland ist nirgendwo in Österreich verzeichnet, obwohl doch ihre Eltern ihr viel erzählt hatten von ihrem früheren Leben dort. Irritiert macht sie sich mit dem Auto auf den Weg in die Gegend, wo nach den Erzählungen der Ort eigentlich liegen müsste. Und tatsächlich sieht sie nach tagelanger vergeblicher Suche, bei der ihr niemand irgendeinen Hinweis geben konnte, weil keiner je von diesem Ort gehört hat, im Vorbeifahren an einer Nebenstrasse plötzlich ein verwittertes Schild «Groß-Einland». Auf einem Feldweg, der irgendwann nur noch über Stock und Stein mitten durch den Wald führt, gelangt sie mit ihrem dadurch total ramponierten, werkstattreifen Auto tatsächlich in den Ort, den niemand kennt. Es stellt sich bald heraus, dass Groß-Einland auf einem riesigen Hohlraum steht, den ein ehemaliges Bergwerk hinterlassen hat. Dieses gewaltige Loch im Untergrund bewirkt ständige Erdabsenkungen, die gefährliche Schäden an den Häusern anrichten, manche sind schon unbewohnbar. Merkwürdig ist allerdings, dass die Bewohner kaum Notiz davon nehmen, die ständig auftretenden und immer breiter werdenden Risse werden einfach zugespachtelt, niemand verliert ein Wort darüber.
In diesem Szenarium stößt Ruth bei den Vorbereitungen für die Beerdigung der Eltern auf Einwohner, die sie zwar freundlich aufnehmen, die aber allesamt seltsam verschlossen sind und ihren Fragen ausweichen. Je tiefer sie in die eigene Familiengeschichte einzudringen versucht, desto verwirrender wird sie. Ruth beschließt, neugierig geworden, länger als geplant zu bleiben und die geheimnisvollen Hintergründe aufzudecken. In einer an Kafka erinnernden, surrealen Geschichte eines merkwürdigen Ortes gerät die Protagonistin immer tiefer hinein in die rätselhaften Strukturen der Einwohnerschaft, die von einer geheimnisvollen, alles beherrschenden Gräfin regiert wird. Ruth nimmt schließlich sogar deren Auftrag an, eine Lösung für das «Loch» zu finden, obwohl sie als theoretische Physikerin dazu überhaupt nicht qualifiziert ist. Die Habilitation rückt völlig in den Hintergrund, so sehr nimmt sie ihre Recherche in Anspruch, sie vermutet nämlich einen Massenmord der Nazis hinter dem hartnäckigen Schweigen der Bewohner, den sie partout aufdecken will. Und aus den paar Tagen, die sie ursprünglich zu bleiben gedachte, werden schließlich drei Jahre, in denen sie dieser merkwürdigen, kollektiven Verdrängung nachspürt!
Listig führt die kreative Autorin im Stil der unzuverlässigen Erzählerin den zunächst arglosen Leser, sprachlich souverän, ständig auf falsche Spuren. Sie brennt dabei ein wahres Feuerwerk ab an skurrilen Einfällen, die sie zuweilen mit komplizierten physikalischen Anmerkungen garniert, was dem surrealen Plot einen realistischen Anstrich gibt. Die Figuren erscheinen allesamt sympathisch, Landschaft und Ort sind bilderbuchartig als idyllisch beschrieben, womit das Thema Heimat als eine weitere falsche Fährte gelegt ist. So steht in dieser parabelhaften Traumwelt den Schwarzen Löchern der Astrophysik das mysteriöse «Loch» in Groß-Einland gegenüber als Metapher für ein auf schwankendem Boden errichtetes soziales Gefüge.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de



 Geschmälerte Lesefrüchte
Geschmälerte Lesefrüchte
 Der Proll als Millionär
Der Proll als Millionär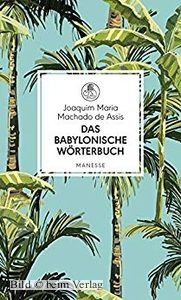 Date mit einem Unbekannten
Date mit einem Unbekannten Der Poet als gottgleicher Schöpfer
Der Poet als gottgleicher Schöpfer Danksagung als raffinierte Ergänzung
Danksagung als raffinierte Ergänzung Mehr Selbstkritik geht ja nicht
Mehr Selbstkritik geht ja nicht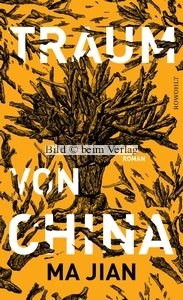 Satirische Dystopie
Satirische Dystopie Vom Dilemma femininer Selbstverwirklichung
Vom Dilemma femininer Selbstverwirklichung Tragischer Pantoffelheld
Tragischer Pantoffelheld


 Der Trafikant: Die Literaturvorlage zu diesem Film lieferte Robert Seethaler in seinem gleichnamigen Roman und scheinbar scheint er damit einverstanden gewesen zu sein, da es auch einen cameo Auftritt des Autors gibt. Die Handlung spielt im Wien der Jahre 1937/38, also vor dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Österreich hatte bereits ein protofaschistisches Regime, das die Opposition und das Parlament ausgeschalten hatte. Antisemitismus gab es auch schon, aber er war noch nicht so mörderisch wie nach dem Anschluss.
Der Trafikant: Die Literaturvorlage zu diesem Film lieferte Robert Seethaler in seinem gleichnamigen Roman und scheinbar scheint er damit einverstanden gewesen zu sein, da es auch einen cameo Auftritt des Autors gibt. Die Handlung spielt im Wien der Jahre 1937/38, also vor dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland. Österreich hatte bereits ein protofaschistisches Regime, das die Opposition und das Parlament ausgeschalten hatte. Antisemitismus gab es auch schon, aber er war noch nicht so mörderisch wie nach dem Anschluss. Man könnte auch über die Besetzung der Sigmund Freud Rolle durch Bruno Ganz streiten, aber vielmehr ist doch gesagt, wenn man bemerkt, dass Szenen, die in der Berggasse (Freuds Wohn- und Arbeitsstätte) im neunten Wiener Gemeindebezirk Alsergrund spielen im dritten Bezirk hinter dem Heumarkt gedreht wurden. Ich meine, wenn schon ein Film an Originalschauplätzen, warum dann nicht gleich an der richtigen Stelle? Vielleicht ist das ja alles beabsichtigt und es soll alles so künstlich wirken oder man muss einfach vorher den Roman gelesen haben, um diese Verfilmung als gelungen bezeichnen zu können. Und da ich das (noch) nicht habe, wollte ich diesen Film zumindest vorstellen, denn als Anschauungsmaterial für die Schule ist er allemal geeignet, wie ein Blick ins Internet offenbart.
Man könnte auch über die Besetzung der Sigmund Freud Rolle durch Bruno Ganz streiten, aber vielmehr ist doch gesagt, wenn man bemerkt, dass Szenen, die in der Berggasse (Freuds Wohn- und Arbeitsstätte) im neunten Wiener Gemeindebezirk Alsergrund spielen im dritten Bezirk hinter dem Heumarkt gedreht wurden. Ich meine, wenn schon ein Film an Originalschauplätzen, warum dann nicht gleich an der richtigen Stelle? Vielleicht ist das ja alles beabsichtigt und es soll alles so künstlich wirken oder man muss einfach vorher den Roman gelesen haben, um diese Verfilmung als gelungen bezeichnen zu können. Und da ich das (noch) nicht habe, wollte ich diesen Film zumindest vorstellen, denn als Anschauungsmaterial für die Schule ist er allemal geeignet, wie ein Blick ins Internet offenbart. Ein literarisches Requiem
Ein literarisches Requiem