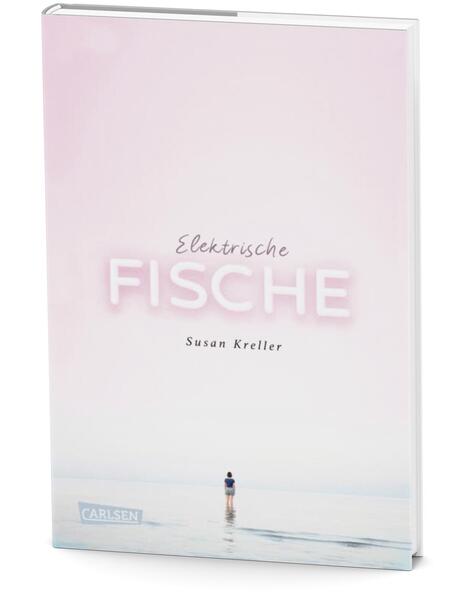
Umzug, Heimweh und ein Fluchtplan
Von der irischen Hauptstadt Dublin ins verschlafene mecklenburg-vorpommerische Velgow: Der Unterschied könnte für Emma und ihre beiden Geschwister nicht größer sein. Nach der Trennung von ihrem trunksüchtigen Vater zieht die Mutter mit ihren drei Kindern zurück in das Haus ihrer Eltern, mit denen sie seit 20 Jahren kein Wort mehr gewechselt hat. Keine guten Voraussetzungen für einen Neustart. Der geht auch genauso holprig weiter, wie er begonnen hat: Die deutschen Großeltern sind Fremde, die geliebten irischen weit weg, ebenso die irischen Freunde, die sich einfach nicht durch deutsche ersetzen lassen wollen. Und Emmas kleine Schwester Aiofe verstummt vollständig, nachdem sie in ihrer neuen Schule gemobbt worden ist.
Emma ist sich sicher: Hier will sie nicht bleiben! Also fasst sie heimlich den Plan, wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren. Unerwartete Hilfe bekommt sie von Levin, einem Klassenkameraden, der wie sie ein Außenseiter ist. Der dünne, langhaarige Junge ist ausgewiesener Metal-Fan, schüchtern und ein guter Beobachter. Obwohl er selbst große Probleme zuhause hat, bietet er Emma seine Hilfe an. Aber damit sein Plan klappen kann, müssen die beiden komplexen Charaktere erst einmal zueinander finden.
Entwurzelung
Die Geschichte stellt schön heraus, wie es ist, völlig fremd zu sein und seine Wurzeln verloren zu haben. Das immense Heimweh, das die Kinder plagt, der mühsame Neubeginn und eine Mutter, die immer Heimweh nach Deutschland hatte, sich jetzt aber nach all den Jahren verloren fühlt und wie ihre Kinder im Nirgendwo feststeckt.
Auch die finanzielle Lage ist angespannt, da die Mutter zumindest anfangs nichts verdient und später “nur” einen Aushilfsjob hat. Die dadurch entstandene Abhängigkeit von den Großeltern und der mangelnde Platz im Haus machen die Lage nicht besser.
Nur allmählich wachsen winzig kleine Wurzeln und finden fruchtbaren Boden zum Verwurzeln. Im Fall der Mutter ist es der Aushilfsjob, der ihr Spaß macht, und der Kontakt zu einer alten Klassenkameradin. Aber auch dieser Kontakt ist durchwachsen, da die Klassenkameradin, Levins Mutter, geistig erkrankt ist.
Emma findet in Levin einen neuen Freund, wobei aber auch diese Beziehung nicht unbelastet ist. Außerdem entflieht sie dem Alltag, indem sie in der Ostsee schwimmt, die aber, wie sie immer wieder anmerkt, nicht das Meer Dublins ist. Erschwert ist auch die Hinfahrt zum Meer, denn sie hat nur das alte DDR-Klappfahrrad als Vehikel.
Ihre Schwester Aoife findet in der alten Nachbarin jemanden, der ihr beim Schweigen zuhört, die die anderen aber eher seltsam finden. Und die deutschen Großeltern tun sich mit der Empathie für ihre irischen Verwandten schwer, zumal sie ihrer Tochter nachtragen, dass sie sie wegen ihres Mannes verlassen hat.
Aber auch hier wachsen erste zarte Wurzeln, als z.B. der Großvater für Emma ein Bett baut, sodass sie nicht länger nur auf ihrer Matratze schlafen muss. Diese kleinen gegenseitigen Annäherungsversuche an das jeweils Fremde sind zwar steinig, aber mit Erfolg gekrönt, sodass sich langsam ein Sog in Richtung eines neuen, nicht mehr so schlimmen Alltags entwickelt. Natürlich denkt man als LeserIn dabei an die diversen Flüchtlingskrisen, die zur Menscheitsgeschichte immer schon dazugehört haben. Und an die Entwurzelung, z.T. auch die Entwertung der geflüchteten Menschen, die oft nicht willkommen waren und es dadurch noch schwerer als ohnehin schon hatten. Vielleicht will das Buch u.a. Empathie wecken für solche Entwurzelten, weil es das mühsame Verwurzeln so ausführlich beschreibt.
Schwierige Familienverhältnisse
Dass es immer mal wieder Schwierigkeiten, auch gerne in diversen Abstufungen, in Familien gibt, ist wohl jedem bekannt. Emma trifft es allerdings härter, weil sie einen Alkoholiker in ihrer Familie hat. Und sie ist hin- und hergerissen zwischen der Liebe zu ihrem Vater und v.a. zu ihren irischen Großeltern und der Liebe zu ihrer Mutter, die von Frust und Wut bgleitet wird, weil die Mutter unerreichbar weit von der irischen Verwandtschaft wegzieht. Auf der anderen Seite zeigt sie aber auch Ansätze, ihre Mutter und deren Entscheidung zu verstehen. Die Entfremdung zu ihrer deutschen Verwandschaft trägt allerdings nicht dazu bei, ihre Situation zu verbessern.
Auch Levins Familienverhältnisse sind schwierig. Die Mutter, vorher eine hoch dotierte Biologin, ist schwer psychisch erkrankt und belastet die Familie sehr. Ihr Selbstmordversuch am Schluss des Buches ist die Spitze vom Eisberg, unter dem die Familie schon seit Jahren leidet. Die beiden Brüder leiden aber auch an der Unfähigkeit des hilflosen Vaters, mit der Situation umzugehen. In dieser Familie ist praktisch jeder auf sich allein gestellt mit seinem Kummer.
Mit schwierigen Situationen umgehen lernen
Das Buch bietet keinen perfekten Lösungsweg. Es beschreibt eher, wie sich die Figuren an schwierige Situationen herantasten, stolpern, versuchen, damit umzugehen, wieder stolpern usw. bis es irgendwann erträglich und vielleicht sogar besser wird. Es gibt nicht den einen Weg, sondern ein ständiges Tasten und try and error – wie auch im echten Leben. Trotzdem sind immer wieder gute Lösungsansätze zu sehen wie z.B. Hilfsbereitschaft, die Bereitschaft zuzuhören, Schweres gemeinsam auszuhalten, denken und ausprobieren, miteinander kommunizieren, erste Schritte aufeinander zugehen, den anderen in seiner Entscheidung respektieren. Dass es dabei auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten und Streit gibt, ist normal. Der Weg zueinander wird aber ebenso oft gesucht, auch wenn es manchmal dauert.
Sonstiges
Das Buch stellt sich den Schwierigkeiten, die es vor den LeserInnen ausbreitet. Aber vielleicht ist es zu überfrachtet mit all diesen Schwierigkeiten, die mal eher angedeutet, mal ausformuliert werden. Ich persönlich fand es etwas sperrig zu lesen, was nicht an der Satzlänge liegt. Die ist in Ordnung. Mir macht eher die Distanz zu schaffen, denn ich bin nicht wirklich warm geworden mit den Figuren, auch nicht mit der Hauptfigur. Vielleicht liegt es daran, dass Emma für einen Teenager viel zu erwachsen wirkt, trotz der Schwierigkeiten. Für mich ist die Darstellung der Figuren insgesamt zu gedeichselt, um noch plausibel zu wirken. Das Buch mutet wie eine typische Schullektüre an, die man als Teenager gezwungen ist zu lesen, weil sie so viel Lehrreiches vermittelt, danach aber nie mehr anrührt. Da ändert auch die Tatsache nichts, dass die Autorin u.a. schon für Preise nomminiert war und diese z.T. auch gewonnen hat.
Fazit
Das Thema Entwurzelung ist nach wie vor sehr aktuell, das Thema familiäre Schwierigkeiten sowieso und diese Themen werden im Buch gut herausgearbeitet und beleuchtet. Trotzdem ist eine Distanz vorhanden, die es LeserInnen schwer macht, mit den Figuren warm zu werden.

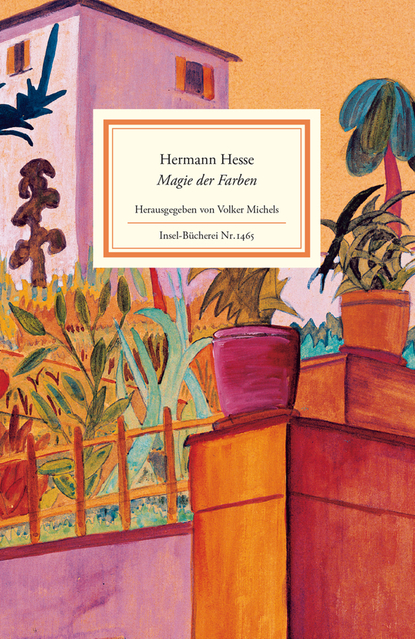



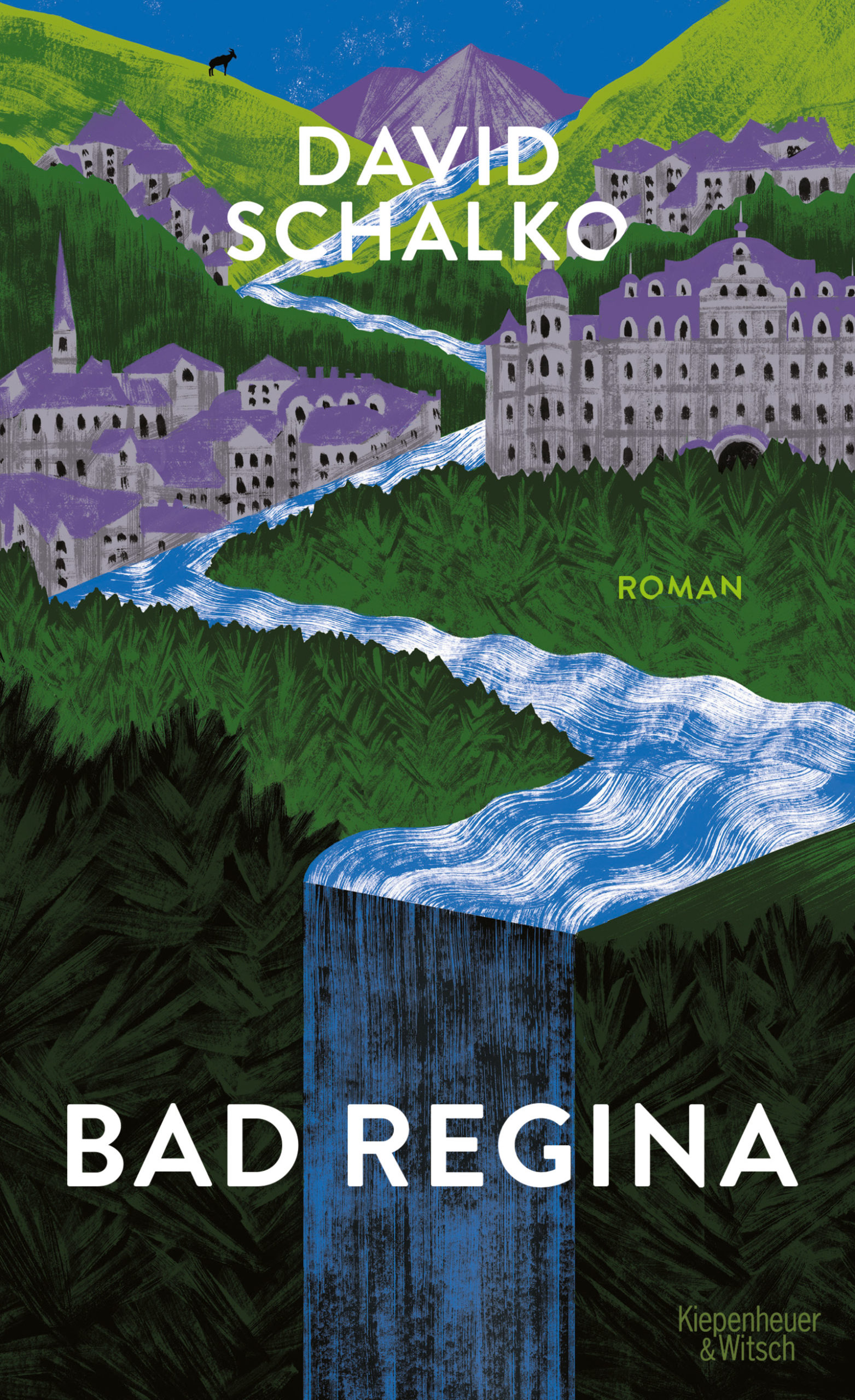

 Kein Wort ist wahr
Kein Wort ist wahr Für echte Leser
Für echte Leser
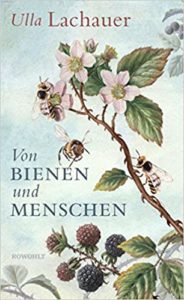 Auch für dieses Buch über Bienen und ihre Menschen nimmt die Autorin uns mit auf ausgedehnte Reisen, am Anfang und zum Schluss sind wir wieder bei Galina in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehn bei Kaliningrad, wo wir schon beim
Auch für dieses Buch über Bienen und ihre Menschen nimmt die Autorin uns mit auf ausgedehnte Reisen, am Anfang und zum Schluss sind wir wieder bei Galina in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehn bei Kaliningrad, wo wir schon beim  Mega-Roman im Intervall
Mega-Roman im Intervall

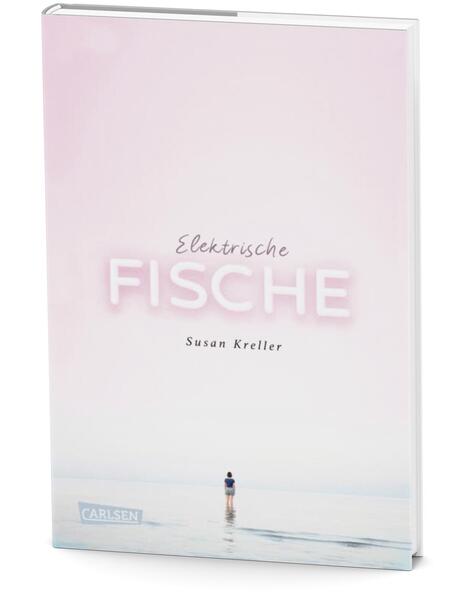
 Einfach genial
Einfach genial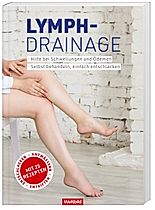 Lymphsystem – das unbekannte Wegenetz
Lymphsystem – das unbekannte Wegenetz