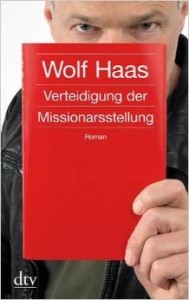Man muss die kindliche Anarchie in sich wiederentdecken, um auf den Sternen zu reiten
Der Autor Jando erzählt in seinem Buch „Sternenreiter – Kleine Sterne leuchten ewig“ davon, dass man heute noch an Wunder glauben soll.
Mats ist Angestellter eines renommierten, börsennotierten Unternehmens und glaubt nicht mehr an seine Träume – zu sehr ist er daran gewöhnt, in der Arbeitswelt, die aus Sitzungen, Kundenpräsentationen, Kursschwankungen und koffeinbetriebenen Überstunden besteht, zu funktionieren. Auch seine Frau Kiki erreicht ihn nicht mehr, die Arbeit geht vor, schließlich muss das Haus abbezahlt und der gehobene Lebensstandard gehalten werden. Doch dann kommt es unerwartet zu einem Ereignis, das Mats zwingt, innezuhalten. Ein kleiner Junge hilft ihm dabei, die Welt mit anderen Augen zu sehen und sein Leben neu zu gestalten.
Die Welt mit anderen Augen sehen ist das Thema des Buches, für das der Leser die Bereitschaft aufbringen sollte. „Wenn wir anfangen, auf unser Herz zu hören, werden wir Dinge im Leben erkennen, die uns unvorstellbar erschienen.“, schreibt Jando als Ouvertüre in den Klappentext. Damit ist „Sternenreiter“ thematisch ein Buch, das sich kritisch mit dem Leistungsdenken und den negativen Erscheinungen wie Erfolgsdruck, Versagensangst, Gier und Einsamkeit im gegenwärtigen Neoturbokapitalismus beschäftigt. Das erinnert an Tom Hodgkinson der in „Die Kunst, frei zu sein – Handbuch für ein schönes Leben“ schreibt: „Karrieren gestatten uns nicht, wir selbst zu sein, denn ihr Erfolgsmaßstab sind nicht Spaß an der Arbeit und Kreativität, sondern Geld und Status. Ein Beruf dagegen – im Sinne von Berufung – ist eine Aufgabe, mit deren Erledigung du deinen Lebensunterhalt verdienst und die dir gleichzeitig Spaß macht.“
Wo Hodgkinson rational argumentiert und vorführt, wie man sich aus diesen Zwängen befreien kann, wählt Jando den Stil eines modernen, poetischen Märchens. Das ist logisch, denn er weiß, dass er diejenigen Leser, die am dringendsten darauf angewiesen sind wieder wie als Kind auf ihr Herz zu hören und an Wunder zu glauben, nur mit der Stimme des Herzens und der Poesie erreicht. Und damit erinnert er einerseits in seiner Vision an Friedrich Nietzsches Satz des Zarathustra: „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“, dem der Titel dieser Rezension entlehnt ist: Denn es geht nicht darum, das eigene kindliche Chaos zu haben, sondern darum, es wiederzuentdecken und sich wieder anzueignen. Andererseits fühlt man sich an den vielzitierten Satz: “Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ von Antoine de Saint-Exuperys Kleinem Prinzen erinnert.
Diese Herzenssicht entwickelt Jando im Sternenreiter weiter, zu einer wahrhaften und poetischen Erziehung des Herzens:
„Der wertvollste Samen,
der in die Erde eingesetzt wird,
ist die Liebe.
Sie wächst überall dort,
wo sie gesät wird.“ (Sternenreiter, S. 5)
Gemeinsam mit dem anarchischen Ungehorsam gegen das Leistungssystem entsteht ein Plädoyer für Freundschaft, Menschlichkeit und die Verwirklichung von Träumen:
„Ihr großen Menschen hört irgendwann auf, an Träume zu glauben. Manchmal wäre es schön, wenn ihr wieder klein wärest. So könntet ihr euch erinnern, dass Träume nur entstehen, wenn man bereit ist, sie zu leben und zu akzeptieren.“ (Sternenreiter, S. 10)
Der Ausdruck des Sternenreiters von den „großen Menschen“ ist eine bewusst Adaption an „die großen Leute“ des Erzählers aus dem kleinen Prinzen. Stilistisch daran angelehnt setzt Jando die Begegnung des Erzählers mit dem Sternenreiter allerdings – im Gegensatz zu Exupéry – nicht in eine isolierte Situation, sondern in eine realistische Alltagssituation und schafft damit einen neuen poetischen Realismus. Dazu die Leseprobe aus dem Prolog:
Die Sterne leuchteten heller als sonst. Das Meer war ruhig. Im Mondlicht schimmerte es silbrig blau. Um mich herum war es still. Es war eine himmlische Ruhe, wie ich sie nur am Meer erlebte. Fünf Jahre sind vergangen, seit ich diesen sonderbaren – nein, sonderbar wird ihm nicht gerecht – vielmehr einzigartigen Jungen kennenlernen durfte. Schnell wird in unserer heutigen Zeit das Wort „Legende“ benutzt. Doch bei ihm trifft es zu. Seine Geschichte wird Generationen überdauern. Es ist eine Geschichte über Liebe, Mut und Hoffnung. „Na und? Das habe ich schon oft gelesen“, werden vielleicht einige sagen. Das mag stimmen und hat auch seine Berechtigung. Doch wenn ihr euch einlasst auf die Geschichte des Jungen − nur Gott allein weiß, woher er kam − können Träume wahr werden. Ich habe es selbst erlebt. Ich kann mich noch gut an seine Antwort erinnern, als ich zu ihm sagte: „Ach, Träume… Ich habe es aufgegeben, meine Kraft und den Glauben daran zu verschwenden.“ Der Junge antwortete, wie es seine Art war, langsam und bedächtig: „Ihr großen Menschen hört irgendwann auf, an Träume zu glauben. Manchmal wäre es schön, wenn ihr wieder klein wäret. So könntet ihr euch erinnern, dass Träume nur entstehen, wenn man bereit ist, sie zu leben und zu akzeptieren.“ Damals konnte ich wenig mit seiner Antwort anfangen. Na ja, wenn ich es mir eingestehe, schon ein bisschen. Doch zur damaligen Zeit war ich noch nicht bereit, mich damit auseinanderzusetzen. Aber dazu komme ich später. Mir war er der beste Freund, den ich mir wünschen konnte. Irgendwann erwähnte er in einem unserer zahlreichen Gespräche: „Wenn ich einmal groß bin, möchte ich gerne allen Menschen erzählen, wie einzigartig das Leben ist. Ich spreche und höre lieber zu, anstatt zu schreiben. Du wirst einmal ein beachtenswerter Schriftsteller sein. Ich wäre glücklich, wenn du es wärest, der meine Geschichten weiterträgt. Jeder sollte das tun, was er am besten kann und was ihm am meisten Freude bereitet.“ Das war das Geringste, was ich für meinen Freund tun konnte. Für ihn ging aber wieder einmal ein Traum in Erfüllung…“
Was diese Melodie des Textes auf der literarischen Ebene einlöst, begleiten die handgemalten Bilder der Kinder- und Jugedbuchillustratorin Antjeca auf der bildpoetischen Ebene: durch die schlichte Form einer Kalkulation größtmöglicher Einfachheit entsteht die Radikalität der Bildsprache hin zu einer ozeanischen Zärtlichkeit. Diese poetische Wirkung ist die Fähigkeit des Textes und der Bilder, immer neue und andere Lesarten zu erzeugen, ohne sich jemals ganz zu verbrauchen. Dieses ist meine ganz persönliche Lesart.
Mit dem „Sternenreiter“ ist dem Autor – nach seinem Erstling Windträume – wieder ein wundervolles und poetisches Buch gelungen, das ich uneingeschränkt empfehle. Doch nicht nur das, denn ein gutes Buch sollte man empfehlen, ein sehr gutes seinen Freunden ans Herz legen und die wirklich besonders wichtigen Bücher sollte man seinen besten Freunden schenken. Ich freue mich darauf, meinen besten Freunden mit dem „Sternenreiter“ ein Herzensgeschenk zu machen.