 Hätte mein Sohn dieses Buch schon gelesen, sein Kommentar wäre: “Was für eine kranke Scheisse!”. Nicht falsch verstehen, das ist in Jugendsprech derzeit ein Maximalkompliment. Die kranke Scheisse scheint auch anderen zu gefallen, seit Wochen ist Er ist wieder da -der Roman von Timur Vermes ganz oben in sämtlichen verfügbaren Bestsellerlisten.
Hätte mein Sohn dieses Buch schon gelesen, sein Kommentar wäre: “Was für eine kranke Scheisse!”. Nicht falsch verstehen, das ist in Jugendsprech derzeit ein Maximalkompliment. Die kranke Scheisse scheint auch anderen zu gefallen, seit Wochen ist Er ist wieder da -der Roman von Timur Vermes ganz oben in sämtlichen verfügbaren Bestsellerlisten.
Ein Mann erwacht orientierungslos auf einem Berliner Trümmergrundstück. Er braucht nicht lange, dann fällt es ihm wieder ein: Er ist Adolf Hitler, der selbsternannte GröFaz. Daran erinnert im Jahre 2011 allerdings lediglich seine Uniform. Keine Eva ist in Sicht, kein Reichsmarschall, kein Führerbunker und warum steht auf dem Rückenteil des unweit seines Erwachungsortes kickenden Hitlerjungen bloß Ronaldo? Es muss allerhand passiert sein, während er geschlafen hat – sogar die Achse Berlin-Ankara scheint endlich zu einem erfolgreichen Bündnis gekommen zu sein, stellt er schnell fest bei einem ersten Spaziergang durch die Reichshauptstadt. Das hätte er Goebbels gar nicht zugetraut. Derart ermutigt stellt er sich tapfer den Herausforderungen der neuen Zeit, begeistert sich schnell für die neuen Medien, gerät zufällig in ein Casting und reüssiert höchst erfolgreich als Fernsehstar mit einer eigenen Show. Nur dass er öfter mit diesem Stromberg verwechselt wird, das stört ihn schon noch etwas.
So geht es munter weiter im Überraschungserfolg des Herbstes. Vernes lässt Hitler als Ich – Erzähler agieren und nutzt diese Konstellation zu einem verbalen Rundumschlag gegen bundesdeutliche Wirklichkeiten. Wenn ein Autor als Adolf Hitler spricht, lädt das ja nun nachgerade dazu ein, ohne Rücksicht auf irgendwen oder irgendwas hemmungslos an nichts ein gutes Haar zu lassen. Ob es der feine Herr Rossmann ist, der zu fein ist, sich selbst hinter seine Ladentheke zu stellen oder dieser dilettierende schlitzäugige Gesundheitslehrling aus dem sogenannten Kabinett. Selbst die heiligsten Kühe unserer Republik werden so gnadenlos geschlachtet. Kleine Kostprobe? Vermes aka A.H. über Helmut Schmidt: “dieser Mann etwa hat absolute Narrenfreiheit und kann Blödsinn reden noch und noch. Man setzt ihn in einen Rollstuhl, wo er in ununterbrochener Reihenfolge Zigaretten abbrennt und …. die schlimmsten Allgemeinplätze verkündet…… dann stellt sich heraus, dass sich sein Ruhm lediglich auf zwei läppische Taten gründet, nämlich dass er im Fall einer Hamburger Sturmflut die Armee zu Hilfe rief, wozu man kein Genie sein muss, und dass er den entführten Schleyer kommunistischen Verbrechern überlassen hat, was ihm sogar gesinnungsmäßig entgegen gekommen sein dürfte.” Noch Fragen? So geht es das ganze Buch. Es gibt keine Klarstellung, nichts, es gibt nur die Sicht Adolf Hitlers. Die NPD kriegt ihr Fett übrigens auch ab, das sind für ihn nur halbgare verpickelte Jüngelchen, derer man sich schämen muss.
Natürlich ist es allerdünnstes Glatteis, auf das sich Vermes da begibt. Aber es hält. Er beherrscht die Gratwanderung, einerseits alles aus der Perspektive Hitlers zu schreiben, andererseits keinen Moment vergessen zu lassen, dass man hier Satire in den Händen hält. Natürlich ist es eigenartig, mit Hitler zu lachen und nicht über ihn, natürlich bleibt einem das Lachen ständig im Halse stecken, weil man sich so oft bei zustimmendem Nicken ertappt. Und natürlich ist es bei allem Witz, aller Schlagfertigkeit auch verstörend und erschreckend, wie plausibel der Roman rüberkommt.
Allerdings: Es ist aus berufenen Mündern zu hören, dass Timur Vermes den Duktus des A.H. sehr gut getroffen habe. Das ist sicher eine der Stärken des Romans, zugleich aber auch seine größte Schwäche. Denn mal Hand aufs Herz – alle political correctness, die ganze Thematik ruhig mal außer Acht gelassen, wenn A.H. ins Schwafeln geriet, war es definitiv ermüdend. Und genauso geht es einem im Buch immer wieder, dass man denkt: mach hinne, komm zum Punkt. Ich will wieder was Witziges lesen.
Fazit: lesenswert. Schon alleine, weil sich mit Timur Vermes endlich mal jemand traut, Adolf Hitler als das darzustellen, was er neben allem anderen wohl auch war: Ein attraktives, verführerisches Massenphänomen und dadurch zu zeigen, wie groß die Gefahr wirklich ist, dass ein Land so einem Wahnsinnigen jederzeit wieder erliegen könnte.
Diskussion dieser Rezension im Blog der Literaturzeitschrift
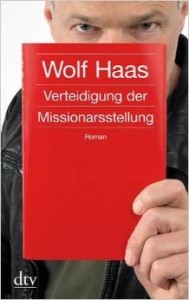








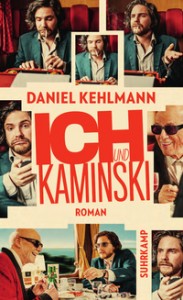 Sebastian Zöllner, ein von Freunden und Freundin verlassener, erfolgloser Journalist, setzt kurz vor seiner endgültigen Pleite alles auf eine Karte, um einen guten Job in der Kunstszene zu ergattern. Er will ein Buch, ein bleibendes Quellenwerk, über einen uralten, zurückgezogen lebenden Maler schreiben, der als einer der Großen seiner Zunft gilt: Manuel Kaminski, ein von Picasso und Matisse gelobter Malerfürst.
Sebastian Zöllner, ein von Freunden und Freundin verlassener, erfolgloser Journalist, setzt kurz vor seiner endgültigen Pleite alles auf eine Karte, um einen guten Job in der Kunstszene zu ergattern. Er will ein Buch, ein bleibendes Quellenwerk, über einen uralten, zurückgezogen lebenden Maler schreiben, der als einer der Großen seiner Zunft gilt: Manuel Kaminski, ein von Picasso und Matisse gelobter Malerfürst.
