Es gibt Bücher, die einen ratlos zurücklassen, bei deren Lektüre man sich ernsthaft fragt, was in aller Welt der Autor hat mitteilen wollen.
Schlimmer noch: Wollte er dem Leser überhaupt etwas mitteilen oder wollte er einfach nur mal all seine Gedanken aufschreiben und loswerden? Am allerschlimmsten: Wenn man am Ende des Romans angelangt ist, es nicht ungern gelesen und sich nicht gelangweilt hat, aber trotzdem nicht weiß, ob einem das Buch gefallen hat, ob man aus der Lektüre jetzt etwas für sich mitnimmt. So ein Buch ist für mich „Otis“, der erste Roman von Jochen Distelmeyer, dem hochgelobten Sänger und Texter der ehemaligen? wiedervereinigten? (man weiß es derzeit nicht so genau) Hamburger Band Blumfeld.
Distelmeyer erzählt vom Leben, Wirken, und Denken seines Helden Tristan Funke, von seinen wolkigen Träumen und seinen gelegentlichen Stippvisiten auf dem Boden der Realität. Tristan ist erst vor kurzem von Hamburg nach Berlin gezogen, um über die Trennung von seiner langjährigen Liebe hinwegzukommen. Einen gutbezahlten Job hat er deswegen geschmissen, nun ist er unter die Schriftsteller gegangen. Sein Thema ist die Odyssee, darunter macht er es nicht. Natürlich übertragen in die Neuzeit. Sozusagen Metaebene auf der Metaebene in der Metaebene.
Der Held in Tristans Buch ist Otis, ein moderner Anti-Held auf der Flucht, angelehnt an die Figur des berühmt berüchtigten Kim Dotcom. Während Tristan – meist erfolglos – an seinem Buch rumdoktert, erlebt er in der Hauptstadt so etwas wie seine persönliche Odyssee.
In Tristans Lebens gibt es genug, wovor er nur zu gerne flüchten mag. Vor gleich zwei Frauen, mit denen er zeitgleich Liebschaften unterhält, während er sich eigentlich eher für eine Dritte interessiert. Vor dem Intellektuellen-Gehabe der neugewonnenen flüchtigen Hauptstadt-Bekanntschaften, mit denen er doch eigentlich so gerne konkurrieren möchte. Vor dem ganzen Elend bundesrepublikanischer Wirklichkeit in den Zehner-Jahren des noch jungen Jahrtausends. Tristan – so scheint es – ist geradewegs von der Pubertät in die Midlife-Crisis gerutscht.
Jochen Distelmeyer ist ein belesener, ein gebildeter, sehr kluger Mensch, der kluge Gedanken noch klüger zu formulieren weiß. Er kann wunderbar mit Worten umgehen, sie zu melodischen, lange nachklingenden Sätzen zusammensetzen. Es ist eine Freude, diese Sätze zu lesen, einfach um der Sätze willen. Formulieren also kann er, eine Handlung stringent erzählen hingegen eher nicht.
Wikipedia merkt zur Band Blumfeld an, dass deren Texte „eigene Gefühlswelten mit Gesellschaftskritik“ verbinden. Sehr gelungene Formulierung, die sich eins zu eins auf „Otis“ übertragen lässt. Denn genau das ist es, was in diesem Buch passiert. Nicht weniger, aber leider auch nicht mehr. Das, was in Songtexten so ganz wunderbar funktioniert, lässt sich eben nicht so einfach in Romanform übertragen. Zumal die Gesellschaftskritik an jeder Stelle so wirkt, als habe Distelmeyer sie einfach unbedingt unterbringen wollen, um jeden Preis. Auch um den Preis, dass die behandelten Themen selten etwas mit der ohnehin schon recht dürftigen Romanhandlung zu tun haben. Schlussendlich hat man das Gefühl, einfach nur aneinander montierte Szenen gelesen zu haben, die sich bei allem spürbaren Bemühen einfach nicht verdichten wollen.
Distelmeyer scheint wie sein Protagonist Tristan der Meinung zu sein, dass die Bevolkerung quasi in der „Sicherheit ausländischer Krisensituationen gewiegt wird“, während „allen im Innersten längst klar ist, dass das Spiel an sich längst gelaufen ist.“ So. Das muss mitgeteilt werden, das muss endlich mal allen klar werden. Und wenn man es in einen Roman presst, damit es nicht nur eingefleischte Blumfeld Anhänger zu hören/lesen kriegen.
Das liest sich streckenweise spannend, zum Beispiel wenn Distelmeyer sein schwelendes Unbehagen am Umgang mit jüngerer deutscher Geschichte am Beispiel des Berliner Holocaust-Mahnmals erzählt. Da ist es eigenartig berührend, wenn man selbst miterlebte Geschichte in Romanform erzählt bekommt und gleichzeitig bestürzend offenlegend, wie absurd doch so vieles ist.
Aber kein Thema ist abseitig genug, um nicht irgendwie noch in den Roman hineingequetscht zu werden. Wozu geht Tristan auf schicke Partys, wenn nicht, um die dort entstehenden Dialoge für Gesellschaftskritik zu nutzen? Da kann man gerne schon mal über Cern in Genf als das „Ground Zero für Urknall-Traumatisierte“ philosophieren. Schön formuliert, griffig, wohlklingend, aber was genau soll das dem Leser jetzt sagen?
Überdruss macht sich da schnell breit, vor allem auch, wenn kaum einmal etwas auch von einem zweiten Standpunkt aus betrachtet und so ungewollt das Vorurteil vom weltfremden Kulturschaffenden genährt wird. Sehr schön zu sehen am Exkurs über den Verlag Behrmann, wohl angelehnt an die jüngere Geschichte des Suhrkamp-Verlags. Alles richtig, alles wahr, aber alles auch nur aus der Sicht des Literaten betrachtet. Dass es auch noch andere Dinge gibt, die das Zusammenleben regeln, Gesetze beispielsweise – das schenkt Tristan/Distelmeyer sich durch elegantes Weglassen. Dadurch reduziert er seine ihm doch so am Herzen liegende Gesellschaftskritik auf eine trotzige Pippi-Langstrumpf-Ich-mach-mir-die-Welt-wie-sie-mir-gefällt-Attitude.
Dazu kommt, dass vieles im Buch sehr Berlin-spezifisch ist und für den, der nicht so mit der Welt der Promis und Hipster in der Hauptstadt vertraut ist, schwer zu enträtseln. Kann man sich immerhin gut in Tristan hereindenken, dessen nordisch-grüblerisches Wesen in der Hauptstadt auch weit weniger gefragt ist als das im Buch nicht ungeschickt gezeichnete intellektuell verbrämte, überhebliche Weltenerklärer-Gehabe. Tristan befindet sich da in einem Zwiespalt und Distelmeyer mit ihm. Nie weiß man genau, was ihn eigentlich treibt und schon gar nicht warum. Wut? Überhöhtes Selbstverständnis? Resignierte Melancholie der intellektuellen Boheme?
Viel authentischer, viel empathischer und glaubwürdiger wirkt Distelmeyers Roman dafür an den Stellen, an denen er die Gesellschaftskritik einfach beiseite lässt und von den Leuten erzählt, mit denen Tristan sein Leben verbringt. Cousine Juli und Freund Ole beispielsweise sind so fein entworfen, so lebensnah, darüber hätte man gerne mehr gelesen. Genauso wie über das Romangeschehen auf der Meta-Ebene. Die Geschichte von Otis als modernem Odysseus ist eine großartige Idee, liest sich auch in Ansätzen so schön, dass man sich bei dem Gedanken ertappt, lieber als Tristans Irrwege durch Berlin hätte man diese Geschichte gelesen. Doch auch Distelmeyers Auslassungen zu Odyssee und Orestie sind weit hergeholt und verschwurbelt. Es ist eine Odyssee der Ziellosigkeit.
Erstveröffentlichung in den Revierpassagen am 20.04.2015
Genre: RomaneIllustrated by Rowohlt
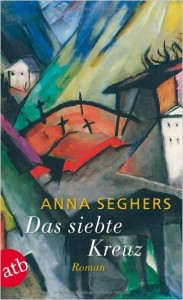 Deutschland 1937: Im Konzentrationslager Westhofen bei Worms lässt der Kommandant aus Platanen sieben Kreuze errichten, um daran sieben geflohene Häftlinge nach erfolgter Gefangennahme als abschreckendes Beispiel zur Schau zu stellen. Einer der Flüchtlinge ist Georg Heisler, ein kommunistischer Aktivist, der sich nun auf die Suche macht nach alten Freunden und Verbindungen, die es ihm ermöglichen, das Land zu verlassen. Dabei muss er auf der Hut sein, denn in den zwei Jahren seiner Inhaftierung haben sich nicht nur die politischen Verhältnisse im Land geändert, sondern mit ihnen auch die Menschen; er weiß nicht, auf wen noch Verlass ist. Seine Verfolger, eine unheilige Allianz aus Polizei, Gestapo und SS, sind ihm stets dicht auf den Fersen und sie schrecken vor nichts zurück. Nach und nach werden alle Sträflinge gefasst, nur Georg, unterstützt von seinen Genossen und anderen aufrichtigen Menschen gelingt am Ende die Flucht nach Holland; das siebte Kreuz bleibt leer.
Deutschland 1937: Im Konzentrationslager Westhofen bei Worms lässt der Kommandant aus Platanen sieben Kreuze errichten, um daran sieben geflohene Häftlinge nach erfolgter Gefangennahme als abschreckendes Beispiel zur Schau zu stellen. Einer der Flüchtlinge ist Georg Heisler, ein kommunistischer Aktivist, der sich nun auf die Suche macht nach alten Freunden und Verbindungen, die es ihm ermöglichen, das Land zu verlassen. Dabei muss er auf der Hut sein, denn in den zwei Jahren seiner Inhaftierung haben sich nicht nur die politischen Verhältnisse im Land geändert, sondern mit ihnen auch die Menschen; er weiß nicht, auf wen noch Verlass ist. Seine Verfolger, eine unheilige Allianz aus Polizei, Gestapo und SS, sind ihm stets dicht auf den Fersen und sie schrecken vor nichts zurück. Nach und nach werden alle Sträflinge gefasst, nur Georg, unterstützt von seinen Genossen und anderen aufrichtigen Menschen gelingt am Ende die Flucht nach Holland; das siebte Kreuz bleibt leer. m September 1958: Der rheinische Architekt Heinrich Fähmel begeht seinen 80. Geburstag, es ist die Zeit für Erinnerungen, für Rückblenden, nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie. Seine Frau, die im Irrenhaus lebt, ohne verrückt zu sein; sie erträgt nur das „normale“ Leben nicht und will endlich Rache nehmen (muss haben ein Gewehr) für die toten Kinder. Sein Sohn Robert, ebenfalls Architekt, der die vom Vater erbaute Abtei St. Anton in den letzten Kriegstagen sprengte, aus Hass auf die Nazis und ihre Kollaborateure, Mönche, die die Lämmer nicht geweidet haben, sondern stattdessen die Lieder der Faschisten sangen. Und auch Heinrich Fähmel selbst erinnert sich schmerzlich daran, wie er sein Lachen verlor, weil er erfahren musste, dass Ironie nicht ausreichte und nie ausreichen würde.
m September 1958: Der rheinische Architekt Heinrich Fähmel begeht seinen 80. Geburstag, es ist die Zeit für Erinnerungen, für Rückblenden, nicht nur für ihn, sondern für die ganze Familie. Seine Frau, die im Irrenhaus lebt, ohne verrückt zu sein; sie erträgt nur das „normale“ Leben nicht und will endlich Rache nehmen (muss haben ein Gewehr) für die toten Kinder. Sein Sohn Robert, ebenfalls Architekt, der die vom Vater erbaute Abtei St. Anton in den letzten Kriegstagen sprengte, aus Hass auf die Nazis und ihre Kollaborateure, Mönche, die die Lämmer nicht geweidet haben, sondern stattdessen die Lieder der Faschisten sangen. Und auch Heinrich Fähmel selbst erinnert sich schmerzlich daran, wie er sein Lachen verlor, weil er erfahren musste, dass Ironie nicht ausreichte und nie ausreichen würde. Ein Klassiker aus meiner Bibliothek und eines (bzw. drei) meiner liebsten Bücher überhaupt.
Ein Klassiker aus meiner Bibliothek und eines (bzw. drei) meiner liebsten Bücher überhaupt.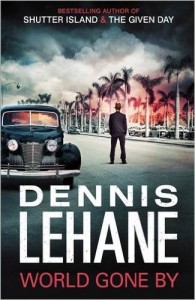

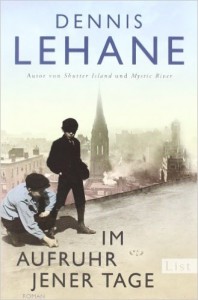
 Mit Schemaliteratur tue ich mich schwer, und Liebesromane überlasse ich normalerweise denjenigen, die damit etwas anfangen können. Da ich aber Einzeltitel von Kirsten Wendt und Markus Hünnebeck mit Gewinn gelesen habe und immer noch auf der Suche nach der Formel bin, wie Titel es schaffen, über Nacht die Gunst des Publikums zu erobern, habe ich diesen Wechselgesang der beiden Autoren gelesen und es keine Minute bereut.
Mit Schemaliteratur tue ich mich schwer, und Liebesromane überlasse ich normalerweise denjenigen, die damit etwas anfangen können. Da ich aber Einzeltitel von Kirsten Wendt und Markus Hünnebeck mit Gewinn gelesen habe und immer noch auf der Suche nach der Formel bin, wie Titel es schaffen, über Nacht die Gunst des Publikums zu erobern, habe ich diesen Wechselgesang der beiden Autoren gelesen und es keine Minute bereut. Das Buch beginnt mit einer Kulturgeschichte von Sprache und Schrift und beschreibt eindrucksvoll, wie gerade das geschriebene Wort von den Herrschenden systematisch als Machtinstrument missbraucht wurde; ein Umstand, der erst mit der Erfindung des Buchdrucks korrigiert wurde.
Das Buch beginnt mit einer Kulturgeschichte von Sprache und Schrift und beschreibt eindrucksvoll, wie gerade das geschriebene Wort von den Herrschenden systematisch als Machtinstrument missbraucht wurde; ein Umstand, der erst mit der Erfindung des Buchdrucks korrigiert wurde.