 In Nicola Karlssons Debütroman „Tessa“ erleidet der Leser die Schussfahrt der Protagonistin durch die Berliner Tankstellen ihrer Sucht.
In Nicola Karlssons Debütroman „Tessa“ erleidet der Leser die Schussfahrt der Protagonistin durch die Berliner Tankstellen ihrer Sucht.
Tessa ist jung, begehrenswert und schön, sie könnte theoretisch glücklich sein. Früher hat sie mal als Model gearbeitet, doch da sie inzwischen keinen Erfolg mehr in der Branche hat und sich mit McJobs finanziell über Wasser halten muss, hat sie anscheinend beschlossen, ihren Körper dafür zu bestrafen, indem sie ihn konsequent ruiniert. Dass sie seit längerem psychiatrischer Behandlung ist, die mit der regelmäßigen Einnahme von Lithium, Antidepressiva und Barbituraten verbunden ist, hält sie jedenfalls nicht davon ab, sich selbst zusätzlich mit Wodka, Wein und Koks zu medikamentieren. Bereits im ersten Kapitel führt ihre manische Beziehungssucht zu heftigem Beziehungsstress mit ihrem Freund Nick. Als sie abends ohne Nick mit ihrer Freundin Charlotte in einer Bar ist, flirtet sie derart heftig mit dem Barmann, dass der später gegen ihren Willen über die wehrlose weil total betrunkene Tessa herfällt. Irgendwie kommt sie wieder nach Hause, ihre Blessuren erklärt sie Nick mit einem Fahrradunfall. Ein paart Tage später legt sie Nick nach Charlottes Geburtstagsfeier die nächste Eifersuchtsszene hin und als er sie auf ihren Konsum anspricht rechtfertigt sie sich:
„Aber ich fühle mich unsicher, und deswegen betrinke ich mich, und dann passieren mir solche Sachen.“
Nick entgegnet kühl: „Halt mich daraus. Ich habe keine Lust auf diese Art von Beziehung. Das ist doch krank.“
Aber ich bin krank.“ – „Dann tu was dagegen, aber hör auf, alle anderen damit zu terrorisieren.“
Das ist das Grundthema des Romans: Tessa ist Opfer ihrer Erkrankung, die in Richtung Bipolar oder Borderline geht. In ihren manischen Schüben macht sie die Drama-Queen und ist andererseits nicht zu wirklicher Nähe fähig, die sie sich zwar einerseits sehnlichst wünscht, vor der sie jedoch gleichzeitig flieht. In ihren depressiven Phasen versinkt sie in Einsamkeit, Selbstmitleid und Weltschmerz. Sie hat zwar eine Krankheitseinsicht, verweigert sich aber ärztlicher Hilfe, zu ihrer Ärztin geht sie nur, wenn sie mal wieder dringend ein neues Rezept für die Pillenbude braucht. Der nächste Club ist ja nicht weit und dort gibt es immer einen Mann, der Stoff hat oder einen Wodka ausgibt, wenn sie ihn dafür mal rüber lässt. Nachdem sie sich von Nick getrennt hat ist sie frei und lernt Jochen kennen, der ist zwar verheiratet, aber egal, ein anderes Mal macht sie ihren Bekannten Jens klar, obwohl sie weiß, dass ihre Freundin Charlotte ernsthaft an ihm interessiert ist und zwischendurch wacht sie auch mal morgens nackt neben ihrem Dealer Uwe und ihr unbekannten Männern oder Frauen auf. Bis sie in einer Bar auf zwei üble Freaks trifft und nicht rechtzeitig den Absprung kriegt …
Der Roman ist eine Zumutung. Mehrere Mal gelobt Tessa Besserung und ein drogenfreies Leben, ebenso oft wird sie routiniert rückfällig. Ihr Trugschluss, dass sie ihren Konsum im Griff hat, wird spätestens deutlich, als sie nachts beim Spätkauf die zweite Flasche Wein holt und zuhause öffnen will:
„Der Korkenzieher liegt nicht griffbereit, und sie kann ihn auch sonst nirgends sehen. Sie öffnet die Küchenschubladen. Nein. Sie geht zwei Schritte zur Spüle. Sieht hinein. Kann ihn zwischen dem dreckigen Geschirr nicht entdecken. Nein. Sie geht wieder zur Flasche, entfernt das Plastik vom Flaschenhals und starrt auf den Korken. Sie nimmt die Flasche in die Hand und setzt sich erst einmal auf den Küchenstuhl. Nachdenken. Ruhig bleiben. Wo hat sie die andere Flasche aufgemacht? Leere in ihrem Kopf. Wie steht wieder auf und schiebt das dreckige Geschirr zur anderen Seite. Irgendwo muss dieser scheiß Korkenzieher ja sein. Vielleicht kann sie den Flaschenhals sauber abschlagen. Nein. Sie wandert in ihrer Wohnung umher. Sie sucht unter dem Kleiderhaufen. Geht von Zimmer zu Zimmer. Sieht sich immer wieder die Flasche an. Vielleicht kann sie den Korken mit einem Besteckgriff reindrücken. Nein. Der Wein schmeckt dann scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn sie nur einen Schluck trinken könnte. Im Wohnzimmer bricht sie zusammen, knickt in die Knie, hält die Flasche fest umklammert. Sie beugt sich nach vorne und schlägt ihren Kopf auf den Boden. Warum nur kann sie sich nicht erinnern, wo sie den scheiß Öffner gelassen hat? Sie muss sich zusammenreißen, ruhig bleiben. Sie zwingt sich aufzustehen. Geht wieder in die Küche, stellt sich an die Spüle. Sie versucht sich zu erinnern, aber je mehr sie sich anstrengt, umso weniger Gedanken hat sie in ihrem Kopf. Sie imitiert das Öffnen der Flasche und versucht dabei, ihre Panik und aufsteigende Tränen zu unterdrücken. Sie dreht sich zum Mülleimer, öffnet ihn und entdeckt den Korkenzieher im stinkenden Müll. Den alten Korken muss sie erst einmal abdrehen.“
Nicola Karlsson liefert hier nicht weniger als die detaillierte Momentaufnahme eines Suchtmenschen in der Situation chronischer Entzügigkeit, den Stoff vor Augen jedoch unerreichbar entfernt und entsprechend kurz vor der Panikattacke. Wäre „Tessa“ das Psychogramm einer Generation, dann wäre diese durch das Hauptmerkmal der Betäubung und Ziellosigkeit gekennzeichnet. Ist es aber nicht, es ist eine Fallstudie im wahrsten Sinne des Wortes, dass Tessa im Laufe ihrer Drogenkarriere immer weiter wie die Stufen einer Treppe hinunterfällt, das Ende nicht erkennbar, nur zu ahnen, dass es ganz weit unten ist. Dafür stehen auch die hervorragend eingefügten Szenen, in denen Tessa in den Straßen Pennern und Pfandflaschensammlern begegnet, Menschen, vor denen sie sich ekelt und von deren Situation sie nur eine Schicht Makeup und die drohende Mietkündigung entfernt ist.
„Tessa“ spielt zwar in Berlin, doch es ist auch kein Berlin-Roman, dafür sind die Verweise auf die Stadt zu dürftig, auch wenn die Stadt bereits in zahllosen Romanen als die Partymetropole der Republik besungen wurde. Eine Koksparty und der Spätkauf machen noch keinen Bären. Wenn Karlsson mit „Tessa“ eine Aussage über Berlin macht, dann höchstens diese, dass das Märchen vom chilligen und kommunikativen Leben dort ein Märchen ist. Berlin ist hart, asozial und verdammt einsam, von Hilfsbereitschaft keine Spur. In diesem Sinne funktioniert auch eine der wenigen Szenen, in der wir die Stadt wiedererkennen, als Tessa nachts über den Alex zu ihrem Dealer Uwe läuft. Das Bild vom Platz mit Punks und Pennern beschwört noch die nächtliche Großstadtdschungelromantik. Als Tessa in Nebenstraßen jemanden hinter sich Laufen zu hören glaubt, kippt die Stimmung ins Bedrohliche, man fühlt sich an den Film Noir mit seinen düsteren Licht-Schatten-Effekten erinnert. Leider bleibt es eine der wenigen Szenen, in denen die Stadt Berlin durchschimmert; bei den zahllosen Wegen, die Tessa auf ihrer Odyssee zwischen Koksparty, dem nächsten Weinkühlschrank, Bett und Pillenbude zurücklegen muss, wäre da wesentlich mehr drin gewesen. So bleibt Tessa in erster Linie die Geschichte der Drogenkarriere einer jungen Frau. Das ist nicht neu, denn dass der Abstieg in die Sucht nicht an ein Mindestalter jenseits der 30 gekoppelt ist, haben bereits in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts im Westsektor der damals noch geteilten Stadt die wesentlich jüngeren „Kinder vom Bahnhof Zoo“ eindrucksvoll auf nonfiktionaler (!) Ebene verdeutlicht.
Nicola Karlsson hat mit „Tessa“ ein sperriges Romandebüt vorgelegt, dass dem Leser fast kein Detail der Selbstentwürdigung eines Menschen im Teufelskreis der Sucht erspart. Die literarische Umsetzung des inneren Gedankenrasens der Protagonistin Tessa ist bemerkenswert, ihr Portrait als einer zutiefst zerrissenen Persönlichkeit interessant. Der Teufelskreislauf der Sucht ist ein in seiner Banalität bekannter Allgemeinplatz, insbesondere die Art und Weise, wie Nicola Karlsson dieses Schicksal gnadenlos seziert, hat einen ganz eigenen, düsteren Klang, der in der Masse der literarischen Debüts hervorsticht.
Genre: RomaneIllustrated by List München
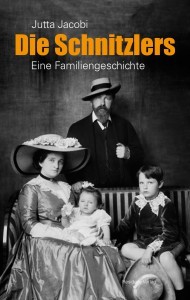 Jutta Jacobi beschreibt mit diesem Buch die Geschichte der Familie um den Schriftsteller Arthur Schnitzler, und zwar nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Vor- und Nachfahren. Der gesamte Zeitraum der Darstellung erstreckt sich über mehr als 150 Jahre, mehrere Länder und beschreibt neben der eigentlichen Familiengeschichte auch sehr schön den Wandel der Gesellschaft von 1850 bis heute.
Jutta Jacobi beschreibt mit diesem Buch die Geschichte der Familie um den Schriftsteller Arthur Schnitzler, und zwar nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Vor- und Nachfahren. Der gesamte Zeitraum der Darstellung erstreckt sich über mehr als 150 Jahre, mehrere Länder und beschreibt neben der eigentlichen Familiengeschichte auch sehr schön den Wandel der Gesellschaft von 1850 bis heute.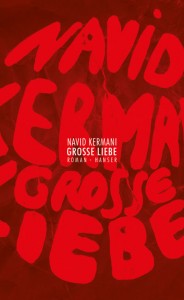

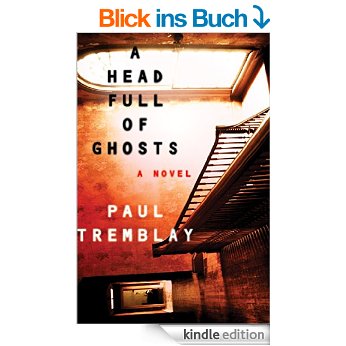
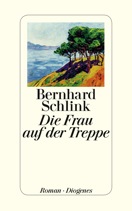
 In Nicola Karlssons Debütroman „Tessa“ erleidet der Leser die Schussfahrt der Protagonistin durch die Berliner Tankstellen ihrer Sucht.
In Nicola Karlssons Debütroman „Tessa“ erleidet der Leser die Schussfahrt der Protagonistin durch die Berliner Tankstellen ihrer Sucht.
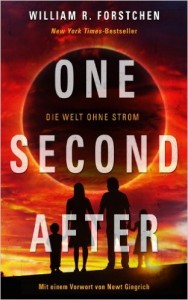
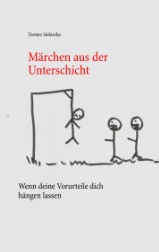
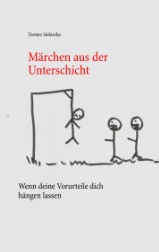
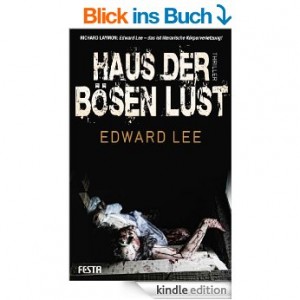 n Bierexperte mit eigener TV-Show, begibt sich zu Recherchezwecken für sein neues Buch in den tiefsten Süden der USA, nach Gast, Tennessee. Das Kaff ist benannt nach dem schwerreichen Howard Gast, der zu Zeiten des Sezessionskriegs eine Eisenbahnlinie bauen ließ und dafür – lokalen Gerüchten zufolge – seine Seele dem Teufel andiente. Collier steigt in Gasts ehemaligem Wohnhaus ab und merkt schon bald, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Geistererscheinungen und schreckliche Alpträume aus der Vergangenheit sind hier an der Nachtordnung und dazu kommt noch seine Libido, die verrückt spielt und sich rasend steigert …
n Bierexperte mit eigener TV-Show, begibt sich zu Recherchezwecken für sein neues Buch in den tiefsten Süden der USA, nach Gast, Tennessee. Das Kaff ist benannt nach dem schwerreichen Howard Gast, der zu Zeiten des Sezessionskriegs eine Eisenbahnlinie bauen ließ und dafür – lokalen Gerüchten zufolge – seine Seele dem Teufel andiente. Collier steigt in Gasts ehemaligem Wohnhaus ab und merkt schon bald, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Geistererscheinungen und schreckliche Alpträume aus der Vergangenheit sind hier an der Nachtordnung und dazu kommt noch seine Libido, die verrückt spielt und sich rasend steigert …
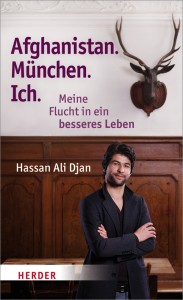
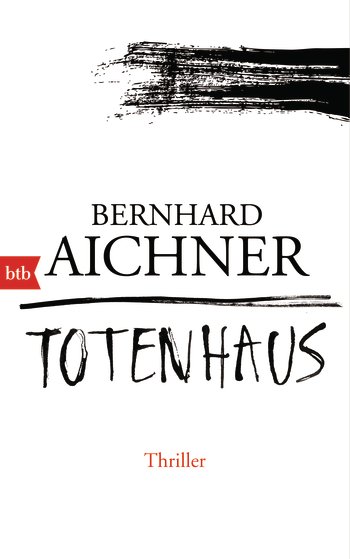
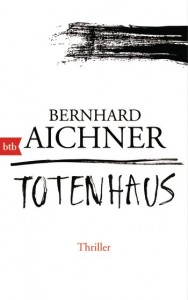
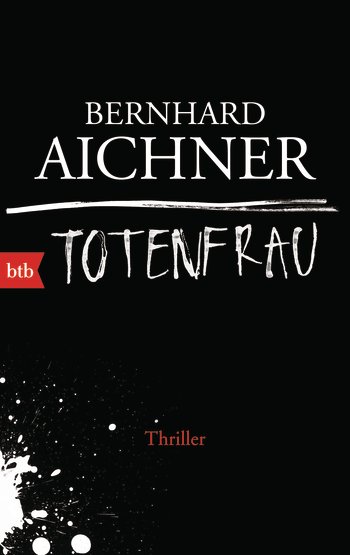
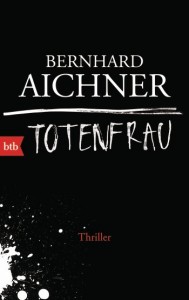

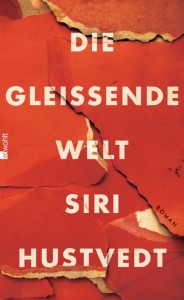
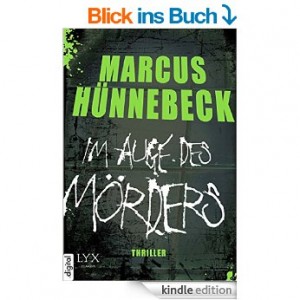
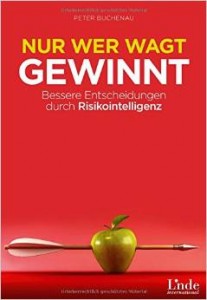 Peter Buchenau mag ein guter »Redner, Ratgeber und Kabarettist« (Eigenwerbung) sein, ein brillanter Autor ist er nicht. Sein Buch »Nur wer wagt, gewinnt« ist in erster Linie eine labyrinthische Predigt, die apodiktisch angelegt ist unter dem Mantra »Nur wer dies und jenes tut oder lässt, der …«
Peter Buchenau mag ein guter »Redner, Ratgeber und Kabarettist« (Eigenwerbung) sein, ein brillanter Autor ist er nicht. Sein Buch »Nur wer wagt, gewinnt« ist in erster Linie eine labyrinthische Predigt, die apodiktisch angelegt ist unter dem Mantra »Nur wer dies und jenes tut oder lässt, der …«