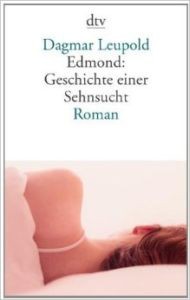 Eine Nabelschau
Eine Nabelschau
Ihrem 1992 erschienenen Debütroman «Edmond» hat die damals 37jährige Dagmar Leupold den Titelzusatz «Geschichte einer Sehnsucht» beigefügt, womit sie das Genre ihres Erstlings von vornherein definiert hat: es handelt sich um einen Liebesroman. Und wer die Vita der Autorin anschaut, dem drängen sich so manche Übereinstimmungen auf zwischen ihr und ihrer namenlos bleibenden Ich-Erzählerin. Ob ihre Geschichte also autobiografisch ist oder doch fiktional, bleibt somit fraglich, – es ist aber auch ziemlich egal, wenn’s nur gut ist. Ist es das?
Wie eine äußere Klammer umgibt eine bevorstehende Geburt die viele Jahre zurückliegende innere Erzählung, ein Stilmittel der Autorin, das sie später in ihrem Roman «Unter der Hand» ganz ähnlich benutzt hat. «Mit jeder Stunde, die vergeht, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind in die Schlagzeilen gerät» lautet der erste Satz. Denn es ist der letzte Dezembertag des Jahres 1999, das Ungeborene könnte also medienwirksam als das erste Baby des Jahrtausends auf die Welt kommen. Ob es so war, bleibt ungewiss. Denn der Roman endet mit den Sätzen «Einundzwanzig Stunden nach der ersten Wehe kommt mein Sohn auf die Welt. Er gleicht niemandem». Die Frage nach dem Vater bleibt offen. «Viele Jahre nach unserer Liebesgeschichte (sie liegt jetzt neun Jahre zurück, und eigentlich hat er die Frau schon während unserer Geschichte kennengelernt) hat Edmond eine Frau geheiratet, deren Gefühlskompass intakt war».
Nun zur inneren Geschichte: Im Zug nach Paris lernt eine junge Schriftstellerin Edmond aus der Dominikanischen Republik kennen, einen muskulösen Sportlehrer, der in den USA studiert hat. Es ist Liebe auf den ersten Blick, schon am Gare de l’Est geben sie sich den ersten Kuss. Die fast ohne Dialoge erzählte Geschichte ist an sich belanglos, man liest sie nicht der Handlung wegen und begeht also auch keinen die Spannung zerstörenden Verrat, wenn man sie hier kurz skizziert. Die Beiden verbringen einige Wochen in Paris, gehen dann gemeinsam nach New York. Auf einer Party bei Edmonds Kollegin merkt sie, dass ihre Romanze dem Ende zugeht. Edmond überrascht sie zwar noch mit einer gemeinsamen Reise nach Jamaika, danach aber trennen sich ihre Wege endgültig.
«Jeder hat so seine Epiphanie; meine war der Buddha im Wald bei Worpswede». Leupold bindet diese Statue wie einen Schutzengel in ihre Geschichte ein, sie dient der Heldin, einer inneren Stimme gleich, als Kommentator und Souffleur. «Ohne Götzen keine Bücher und ohne Gespenster auch nicht» heißt es im Text, und genau hier liegt der Reiz dieser leichtfüßigen, wie schwebend erscheinenden Prosa. Weite Passagen der Geschichte nämlich sind dem Thema Schreiben im Allgemeinen gewidmet und der Entstehung dieses Romans im Besonderen. «Statt Bücher über Edmond zu schreiben könnte man selbstverständlich die deutsche Einheit oder Zwietracht zum Gegenstand wählen …» erklärt sie dem staunenden Leser, die ihr beim Schreiben quasi über die Schulter schauen darf. Wobei ihr Buch im Krankenhaus entsteht, wo sie wegen einer Komplikation die letzten Monate der Schwangerschaft verbringen muss, sie nutzt dort die Zeit zum Schreiben. Dass sie dabei über eine vergangene Liebschaft berichtet, muss nichts bedeuten, kann es aber. «Man schreibt aus denselben Gründen, aus denen man liest: aus Wissensdurst und Liebeshunger» heißt es einmal, und weiter: «Unordnung stiften, verlorenes Territorium zurückgewinnen: Blühender Sinn und ausschweifender Verstand – für all das gewährt das Papier Raum». Und was die Leser anbelangt, so stellt sie klar, «dass man jemand die Bücher ansieht, die er gelesen hat». Die Schriftstellerin hält also eine vergnügliche Nabelschau in diesem Roman, nicht mehr und nicht weniger. Liebe, Erleben, Erzählen, Lesen bilden hier eine literarische Funktionskette, formen «eine Liebesgeschichte, die im Sande verläuft», die aber auf eine intelligente und nachdenkliche Art erzählt wird, in der die Genese des Plots das eigentliche Ereignis ist.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Ein hintergründiges Triptychon
Ein hintergründiges Triptychon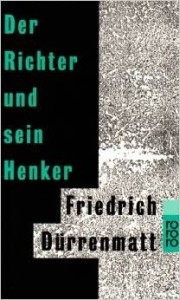 Böses mit Bösem bekämpfen
Böses mit Bösem bekämpfen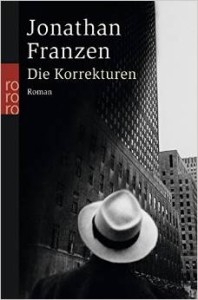 Vom Scheitern der Familie
Vom Scheitern der Familie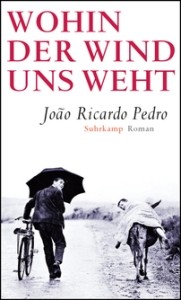 ker in spe
ker in spe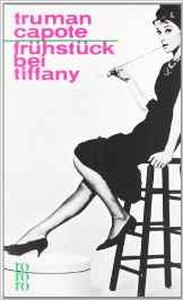 Satire auf New Yorks Schickeria
Satire auf New Yorks Schickeria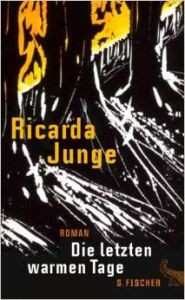 Resignative Melancholie
Resignative Melancholie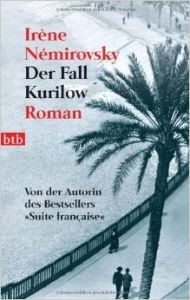 Exekution eines Hampelmanns
Exekution eines Hampelmanns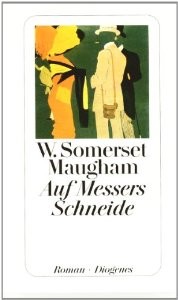
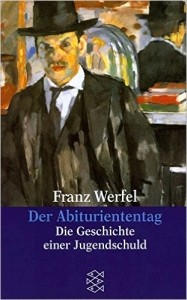 Die können es einfach
Die können es einfach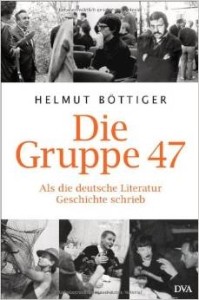 Von literarischem Kannibalismus
Von literarischem Kannibalismus Zu liquidierender Schriftsteller
Zu liquidierender Schriftsteller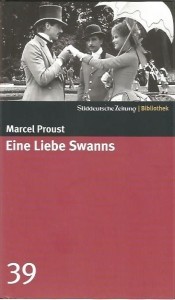 Vinteuils Phrase und die Cattleyas
Vinteuils Phrase und die Cattleyas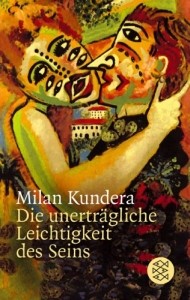 Es muss sein
Es muss sein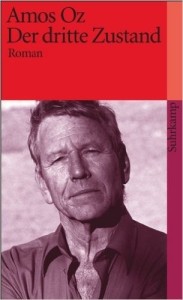 Licht von droben
Licht von droben