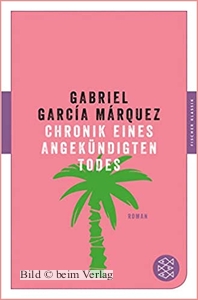 Mord und Moral
Mord und Moral
Zu den bekanntesten Werken des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel Garcia Márquez gehört der 1981 erschienene Roman «Chronik eines angekündigten Todes». Die Geschichte geht auf eine wahre Begebenheit zurück. Im Stil des Magischen Realismus geschrieben, zu deren wichtigsten Vertretern der ein Jahr später mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Autor zählt, gehört der schmale Band inzwischen zu den südamerikanischen Klassikern.
«An dem Tag, an dem sie ihn töten sollten, stand Santiago Nasar um fünf Uhr dreißig morgens auf, um das Schiff zu erwarten, mit dem der Bischoff kam». In diesem ersten Satz steckt bereits ein Teil der beißenden Kritik des Autors, Bischoff und Töten werden in einem Atemzug genannt, Ursache und Wirkung also einer rigiden katholischen Sexualmoral, die dem fragwürdigen Ehrenkodex einer naiven, dörflichen Bevölkerung zugrunde liegt. Es ist die Geschichte einer pompösen Hochzeitsfeier und ihrer Folgen. Der erst vor wenigen Monaten in das Dorf gekommene, reiche und charismatische Bräutigam hat sich spontan ein schönes, junges Mädchen zu Braut erwählt. Die ist aber gar nicht begeistert, da sie ihn kaum kenne und nicht liebe. «Auch die Liebe lässt sich lernen», hält ihr die resolute Mutter entgegen, die Eltern stimmen der geplanten Ehe erfreut zu. Als die Schöne ihrer Mutter gesteht, dass sie keine Jungfrau mehr sei, werden ihre Bedenken dahingehend zerstreut, es gäbe da einschlägige Hebammen-Tricks, um dem meist ja ziemlich betrunkenen Bräutigam die geforderte Unberührtheit vorzugaukeln. Die Sache geht schief, nach der Hochzeitsnacht bringt der Bräutigam seine Braut zu den Eltern zurück, als Reklamation quasi. Die wütende Mutter prügelt aus ihr den Namen des Verführers heraus, Santiago Nasar sei es gewesen, ein arabisch-stämmiger junger Mann aus der Nachbarschaft. Die Zwillingsbrüder der Braut führen sich verpflichtet, die Familienehre wieder herzustellen, indem sie den Verführer töten. Der Skandal ist da, jeder im Dorf weiß davon, und jeder weiß auch, was nun geschehen wird.
Der Ich-Erzähler kommt 27 Jahre später in sein Heimatdorf zurück und spricht mit vielen Beteiligten über das noch fest in der gemeinsamen Erinnerung verankerte Geschehen von damals. Die aus seiner Perspektive erzählte Geschichte erscheint nicht nur im Nachhinein völlig grotesk, es bleiben auch viele Fragen offen. Niemand habe das ahnungslose Opfer nachdrücklich vor den auf ihn lauernden Zwillingen gewarnt, keiner habe versucht, die Tat zu verhindern, die meisten aber nahmen die Drohung überhaupt nicht ernst. Die journalistisch knappe Erzählweise klammert beispielsweise die Vorgeschichte der Entjungferung ebenso aus wie das Geschehen in der Hochzeitsnacht. Nur vage wird angedeutet, dass der mit einer andern Frau verlobte Santiago Nasar mutmaßlich nicht der Verführer gewesen sei, was seine Sorglosigkeit erklärt, als er wenige Minuten vor dem Mord doch noch von der Drohung der Zwillinge erfährt.
Garcia Márquez legt den Fokus seiner Erzählung konsequent auf die Umstände vor der Tat, er blendet also alle für die Tat selbst nicht relevanten, voraus gegangenen Geschehnisse bewusst aus. Eine puristische, auf jegliche Spannung verzichtende Erzählweise, die den religiös indizierten, moralischen Irrwitz, der hier geradezu satirisch thematisiert wird, genau deshalb umso deutlicher bloßlegt. Dazu tragen insbesondere auch seine allesamt recht einfältig wirkenden Figuren bei, deren oft verschrobene, undurchsichtige Charaktere er nicht beschreibt, sondern durch ihr irreales Handeln verdeutlicht. Selbst die beiden Täter haben Zweifel an ihrer vermeintlichen Ehrenpflicht. Sie tun alles, um ihr zu entgehen, indem sie ihre Absicht lautstark ankündigen in der Hoffnung, jemand würde beherzt eingreifen und sie vom Tatzwang befreien. Ein fast kammerspielartiges Setting macht diesen kleinen Roman zu einem nachwirkenden Leseerlebnis, dessen offene Fragen den Leser noch lange beschäftigen, gerade weil sie so abstrus erscheinen.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
 Verquer, aber emotional anregend
Verquer, aber emotional anregend Eine Entmystifizierung
Eine Entmystifizierung Zeitloses Lesevergnügen
Zeitloses Lesevergnügen Pop-Trash
Pop-Trash Wenn ihr so weitermacht
Wenn ihr so weitermacht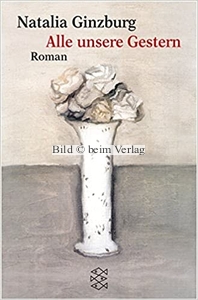 Beten hilft nicht
Beten hilft nicht Dreifach diskriminiert
Dreifach diskriminiert Bukowski Fuck Machine. „Erections, Ejaculations, Exhibtions and General Tales of Ordinary Madness 1967-1972“ war der Titel des Sammelbandes in denen Charles Bukowskis unzählige Kolumnen aus diversen Undergroundzeitschriften erstmals als Buch erschienen. Aber Bukowski schrieb auch Gedichte und Romane und insgesamt umfasst sein Werk mehr als 40 Bücher. Am 16. August wäre er 100 Jahre alt geworden, ein guter Vorwand für eine Re-Lektüre.
Bukowski Fuck Machine. „Erections, Ejaculations, Exhibtions and General Tales of Ordinary Madness 1967-1972“ war der Titel des Sammelbandes in denen Charles Bukowskis unzählige Kolumnen aus diversen Undergroundzeitschriften erstmals als Buch erschienen. Aber Bukowski schrieb auch Gedichte und Romane und insgesamt umfasst sein Werk mehr als 40 Bücher. Am 16. August wäre er 100 Jahre alt geworden, ein guter Vorwand für eine Re-Lektüre.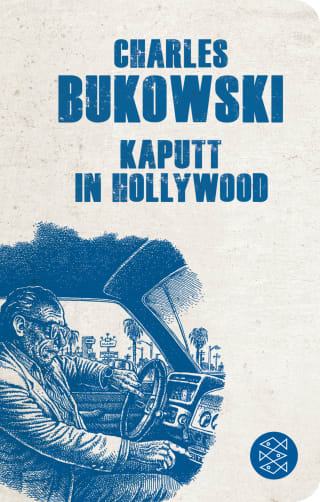
 Kaputt in Hollywood: Zum 100. Geburtstag des geliebten Skandal-Autors Charles Bukowski ist in der FISCHER Taschenbibliothek „Kaputt in Hollywood“ eine Neuausgabe als gebundenes Buch mit 192 Seiten erschienen. Dieser Rezension liegt die Taschenbuchausgabe von 2018 mit 121 Seiten vor. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich inhaltlich meines nur durch die Druckgröße der Buchstaben. Alles zehn Stories sind eine Auswahl aus dem unter dem amerikansichen Original erschienenen Sammelband „Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1967-1972“. Bukowskis Geschichten waren vor 1972 in diversen Undergroundzeitschriften erschienen und unter diesem Titel erstmals gesammelt veröffentlicht worden. Die deutsche Erstveröffentlichschung übernahm damals der Maro-Verlag im Jahre 1976. Im Anhang zu dieser Ausgabe findet sich ein Interview von Thomas Kettner mit dem Autor.
Kaputt in Hollywood: Zum 100. Geburtstag des geliebten Skandal-Autors Charles Bukowski ist in der FISCHER Taschenbibliothek „Kaputt in Hollywood“ eine Neuausgabe als gebundenes Buch mit 192 Seiten erschienen. Dieser Rezension liegt die Taschenbuchausgabe von 2018 mit 121 Seiten vor. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich inhaltlich meines nur durch die Druckgröße der Buchstaben. Alles zehn Stories sind eine Auswahl aus dem unter dem amerikansichen Original erschienenen Sammelband „Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1967-1972“. Bukowskis Geschichten waren vor 1972 in diversen Undergroundzeitschriften erschienen und unter diesem Titel erstmals gesammelt veröffentlicht worden. Die deutsche Erstveröffentlichschung übernahm damals der Maro-Verlag im Jahre 1976. Im Anhang zu dieser Ausgabe findet sich ein Interview von Thomas Kettner mit dem Autor. Prinz Vogelfrei
Prinz Vogelfrei Ein narratives Verwirrspiel
Ein narratives Verwirrspiel Hic sunt leones
Hic sunt leones
 Kein Wohlfühlroman
Kein Wohlfühlroman