 Feministischer Schelmenroman
Feministischer Schelmenroman
Der dritte Roman von Isabelle Lehn mit dem Titel «Die Spielerin» wurde inspiriert durch ein Buch des Journalisten Sandro Mattioli, in dem die Frage aufgeworfen wurde, ob die Mafia den 2013 in die Insolvenz gegangenen «Deutschen Depeschendienst» kaufen wollte. Darin tauchte auch eine unscheinbare junge Frau aus der niedersächsischen Kleinstadt Einbeck auf, der die Protagonistin dieses Romans nachempfunden ist. Die Autorin hat den Inhalt ihres Buches mit den Worten charakterisiert: «Es ist eine Welt des schönen Scheins und der Fassaden. Eine Welt, die glänzt und durch Komplexität blendet, um zu verbergen, was sich hinter den Fassaden verbirgt.» Herausgekommen ist dabei eine Art feministischer Schelmenroman mit Anklängen an einen veritablen Wirtschaftskrimi.
Im Prolog wird das Ende der dreiteiligen Geschichte vorweg genommen, wenn nämlich A., die namenlos bleibende Romanheldin, im Frühling 2006 in einem noblen Hotelzimmer ihre wahre Geschichte erzählt, so wie sie keiner kennt und wie sie auch kein anderer jemals von ihr hören wird. Als Zuhörer hat sie einen am Bahnhof von Florenz aufgegabelten, blutjungen Gigolo auserkoren, der nackt auf ihrem Bett sitzt und sich, bevor er seinen Job tun wird, sein Geld auch als geduldiger Zuhörer verdienen muss. «Er soll der Einzige sein, der weiß, wie sie alles erzählen würde», heißt es dazu. In dem ihr drohenden Prozess wird A. nämlich beharrlich schweigen, dem wildfremden Callboy gegenüber aber muss sie sich, einmal wenigstens, alles von der Seele reden. «So können wir uns das Ende vorstellen», heißt es dann weiter mit einer dem ‹Pluralis Majestatis› ähnelnden, allwissenden Erzählstimme, die aber nur eine von mehreren erzählerischen Perspektiven dieses Romans ist, eine Autorin und Leserschaft kumpelhaft vereinende Wir-Form.
Gegen den Willen ihrer Eltern geht die ehrgeizige junge Bankangestellte A. nach Zürich, um dort eine Karriere als Investment-Bankerin hinzulegen. Sie beginnt als Telefonistin, interessiert sich für alles, was um sie herum passiert, macht sich Notizen. Schon bald ist sie so tief mit den Machtstrukturen der Bad Banks vertraut und in die Geheimnisse des Großen Geldes eingeweiht, dass sie zur Assistentin aufsteigt. Ihre Unscheinbarkeit als junge Frau in einer machohaften Männer-Domäne erweist sich schnell als Vorteil im Umgang mit den männlichen Kunden, denen sie riskante Investments vermitteln muss, – je riskanter, desto höher ist ihre Provision. Sie ist vertrauenswürdiger als ihre geldgeilen, männlichen Kollegen und übernimmt als toughe Key Account Managerin schon bald die Verwaltung von immer mehr und immer bedeutenderen Portfolios. Bis sie schließlich selbst den Verlockungen der hohen Profite erliegt und immer mehr zweifelhafte Geschäfte einfädelt in dem «kapitalistischen Schurkensystem», in das sie da hineingeraten ist. Um nun für ihre Mafia-Kundschaft beispielsweise anonyme Konten in fragwürdigen Südsee-Zwergstaaten zu eröffnen, «schwarze Kassen in saubere Bilanzen» zu transferieren und andere kriminelle Transaktionen mehr.
Isabelle Lehn stellt in einem kühlen Erzählton nach offensichtlich akribischer Recherche ein schwer durchschaubares, patriarchal dominiertes Finanzsystem an den Pranger, ohne dabei der Versuchung zu erliegen, dies scheinbar moralisch überlegen aus dezidiert feministischer Sicht zu tun. Dabei gelingt es ihr, die vielen Erzählfäden spannungsreich miteinander zu verweben und die komplexen Vorgänge auch für ökonomisch unbedarfte Leser einigermaßen verständlich zu machen. Auch wenn man Begriffe wie Leerverkäufe, Hedgefonds, Derivate und noch deutlich schwierigere dann aber doch nachschlagen muss als braver Sparbuchbesitzer. Der stilistisch sachliche, leicht lesbare Plot bietet mit seiner eher als graue Maus denn als Powerfrau dargestellten Protagonistin allerdings kaum Identifikations-Potential, denn man erfährt wenig von ihr als Privatmensch. Sie ist eine Einzelgängerin, Männer interessieren sie in ihrem Single-Dasein nur als Partner beim Geldverdienen, Familie und beste Freundinnen spielen keine Rolle.
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de
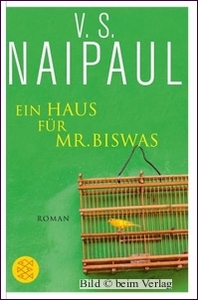 Lesespaß aus kontrapunktischer Ironie
Lesespaß aus kontrapunktischer Ironie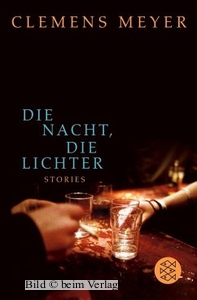 Stories von den Underdogs
Stories von den Underdogs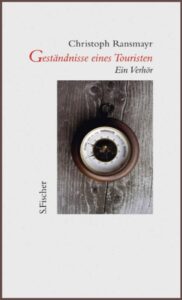
 Masse und Komplexität als Manko
Masse und Komplexität als Manko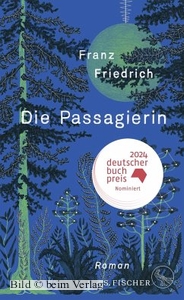 Dystopische Zeitreise
Dystopische Zeitreise Literarisch hochstehender Schwulenroman
Literarisch hochstehender Schwulenroman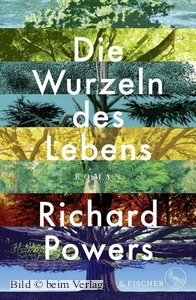 Staunend am Mammutbaum
Staunend am Mammutbaum Schicken Sie Ihre Phantasie auf Reisen oder testen Sie einfach nur Ihre Geografiekenntnisse, indem Sie Nadeln in eine imaginäre Weltkarte stecken. Osterinsel, China, Brasilien, Kalifornien, Marokko, Andalusien, Island, Griechenland, Wien, Neuseeland, Neu Delhi, Nepal, Bolivien, Mexiko, Juan Fernandez Archipel, Irland, Laos, Nordpol, Ontario, Kambodscha, Yokohama, Valparaiso, Pitcairn, Jemen, Sydney, Irland. Stopp! Das sind nur etwa die Hälfte der Orte und Ziele, die Christoph Ransmayr in seinem Atlas eines ängstlichen Mannes wie auf einer geografischen Perlenkette auffädelt.
Schicken Sie Ihre Phantasie auf Reisen oder testen Sie einfach nur Ihre Geografiekenntnisse, indem Sie Nadeln in eine imaginäre Weltkarte stecken. Osterinsel, China, Brasilien, Kalifornien, Marokko, Andalusien, Island, Griechenland, Wien, Neuseeland, Neu Delhi, Nepal, Bolivien, Mexiko, Juan Fernandez Archipel, Irland, Laos, Nordpol, Ontario, Kambodscha, Yokohama, Valparaiso, Pitcairn, Jemen, Sydney, Irland. Stopp! Das sind nur etwa die Hälfte der Orte und Ziele, die Christoph Ransmayr in seinem Atlas eines ängstlichen Mannes wie auf einer geografischen Perlenkette auffädelt. 
 Aus der Kommunalka
Aus der Kommunalka

 Redundanter Lebensgefühls-Roman
Redundanter Lebensgefühls-Roman Unvergesslich?
Unvergesslich?