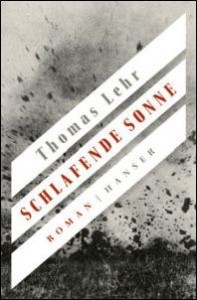 Poetologische Phänomenologie
Poetologische Phänomenologie
Mit «Schlafende Sonne» ist der erste Teil des Opus Magnum von Thomas Lehr erschienen, dem zwei weitere folgen sollen. «Wird fortgesetzt» lesen wir also am Ende, doch so mancher Leser wird spätestens da, wenn er denn überhaupt so weit gekommen ist, entnervt aufstöhnen: «Aber ohne mich!» Denn indem der Autor schon im Motto mit dem Phänomen der Spirale seinem Roman dessen formales Prinzip voranstellt, weist er auch gleich auf ein narratives Chaos hin, dem er in seinem unkonventionellen Text immer wieder vom Innern einer erzählerischen Spirale her beizukommen sucht. Es wird also nicht linear erzählt, sondern ohne erkennbare Chronologie vom stofflichen Zentrum her in sich drehenden, geradezu verwirbelten Erzählsträngen, die lesend nachzuvollziehen mehr als anstrengend, häufig gar unmöglich ist. Verliert also der arglose Leser in dieser fragmentierten Erzählung die Orientierung, was voraussehbar ist, liegt das ganz gewiss nicht an seinem rezeptiven Unvermögen, soviel vorab.
Dreh- und Angelpunkt der Geschichte mit ihren drei Protagonisten ist ein einziger Tag im August 2011, an dem die Künstlerin Milena Sonntag im Berlin ihre große Werkschau eröffnet. Ihr Ex-Geliebter Rudolf Zacharias, einst ihr Philosophie-Professor, reist extra aus Tokio an, ihr Ehemann Jonas, dessen Statement «Ich bin nur Physiker» ihn in intellektuellen Disputen der Künstlergemeinde stets aus der Schusslinie nimmt, holt ihn am Flughafen ab. Das ist auch schon die eigentliche Handlung, die wegen ihrer eintägigen Dauer unwillkürlich an Joyce erinnert. Aber anders als im «Ulysses» stehen hier nicht die Protagonisten im Zentrum der Erzählung, sondern die Geschichte Deutschlands selbst in politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher Hinsicht, und zwar über einen Zeitraum von etwa hundert Jahren hinweg. In den vielen die Seiten füllenden, aus der leitmotivischen «Spirale» heraus sich entwickelnden Erzählkreisen werden intellektuell anspruchsvoll philosophische, physikalische, kunsttheoretische, universitäre, historische, soziologische Themen behandelt. Die so entstehenden erratischen Bilder jedoch sind ohne inneren Zusammenhang, vieldeutig und kaum zu entschlüsseln, auch mit Hilfe des zweiten Leitmotivs «Sonne» nicht.
Muss man also, wie in Feuilleton zu lesen war, den Roman mehrmals lesen, um ihn wirklich zu verstehen? Man könnte den sich radikal außerhalb aller Konventionen stellenden Erzählstil Lehrs, seine eher technisch als poetologisch angelegte Sprache, als provokativ empfinden. Inwieweit der auf diese Art bewerkstelligte Einblick ins deutsche Bewusstsein wirklich Erkenntnis fördernd ist, hängt einzig vom Erfahrungshintergrund des jeweiligen Lesers ab. Der Roman schließt nach meiner Einschätzung aber weite Leserkreise von einer bereichernden Wirkung der Lektüre mit Sicherheit aus, zu akademisch hochgestochen wird hier schwadroniert, quasi nach Bildungsbürgerart. «Ich bin vielfach ungebildet» hat der Autor mit einem Musil-Zitat eine entsprechende Frage abgewiegelt, meinen Nonsens-Verdacht damit erhärtend. Denn ob das akademische Parlando des Romans einer fachlich kritischen Prüfung standhält, vermag ich zwar nicht zu beurteilen, es bleibt aber doch fraglich.
Ohne Zweifel schreibt Thomas Lehr auf höchstem Niveau, virtuos immer wieder die Erzählperspektiven wechselnd. Er erzeugt mühelos hoch assoziative Bilder in seinem breit angelegten deutschen Panorama, in dem Alltagsleben oder ökonomische Aspekte ausgeblendet bleiben und Sex als eine fast schon artistische Zweckübung behandelt wird, bei der Erotik kaum eine Rolle spielt. Die Figuren des Romans sind wenig lebensecht, zudem intellektuell maßlos überzeichnet, und manche der weit ausholenden Erzählbögen führen einfach nur ins Leere. In dem für die Shortlist des diesjährigen Buchpreises nominierten Roman ist der Inhalt der Form derart radikal untergeordnet, dass der Leser größte Mühe hat, auch nur ein Gran Sinn in das Ganze zu bringen. Schade eigentlich!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
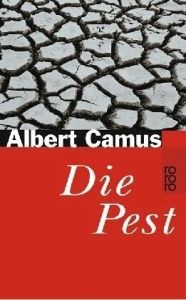 Zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages
Zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages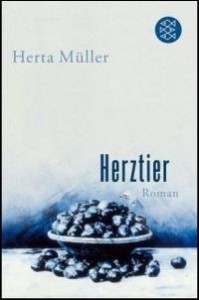 Nichts stimmt, aber alles ist wahr
Nichts stimmt, aber alles ist wahr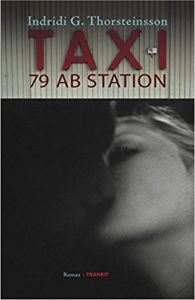 Brennevín oder Whisky
Brennevín oder Whisky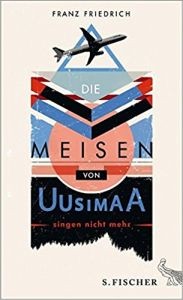 Diagnose Meisenmanie
Diagnose Meisenmanie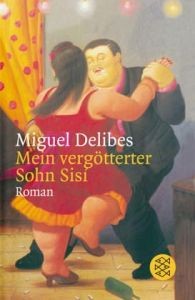 Ein Unsympath
Ein Unsympath Ein Buch für die Stadt
Ein Buch für die Stadt Vom Meister der Plaudertons
Vom Meister der Plaudertons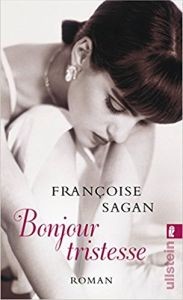 Eine Stilistin der Einsamkeit
Eine Stilistin der Einsamkeit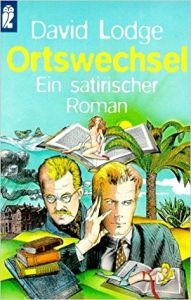 Effekthascherische Trivialität
Effekthascherische Trivialität Skandalöser Nonsens
Skandalöser Nonsens Genie und Wahnsinn
Genie und Wahnsinn

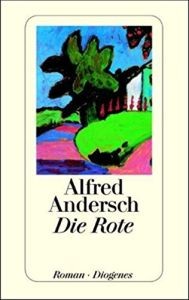 Mumpitz und Humbug
Mumpitz und Humbug Decamerone in der Jockey-Bar
Decamerone in der Jockey-Bar