 Der Turm schützt uns
Der Turm schützt uns
Um den neuesten Roman des rumänisch-stämmigen Schriftstellers Catalina Dorian Florescu mit dem Titel «Der Feuerturm» ist es merkwürdig still. Das deutsche Feuilleton hat sich vornehm zurück gehalten, während andere Bücher oft ja eilfertig schon unmittelbar nach ihrem Erscheinen besprochen werden. Erzählt wird hier die Geschichte einer rumänischen Familie über fünf Generationen hinweg, in der die Männer traditionell bei der Feuerwehr sind. Es ist auch ein Gesellschafts-Roman, und ein typischer Stadt-Roman obendrein, eine Hommage an Bukarest.
Der Roman wird eingeleitet mit der Legende von Iane, einem Unglücksboten, der aus dem Wald gelaufen kam und die Stadt vor einem nahenden Unheil warnen wollte. Auch der titelgebende Feuerturm hat eine solche Alarmfunktion, er wurde 1892 fertig gestellt und bietet mit 42 Meter Höhe eine weite Aussicht über Bukarest. Der dort oben diensthabende Feuerwehrmann alarmiert im Brandfall seine Kollegen und gibt ihnen Hinweise auf den genauen Ort des Brandes. «Dieser Turm ist eine Metapher für die Widerstandskraft der Menschen» hat der Autor erklärt. Im Roman fungiert er als Leitmotiv, um ihn rankt sich ein dichtes Geflecht von zeitlich vor und zurück springenden Geschichten und Episoden.
Ich-Erzähler ist der 1932 geborenen Victor Stoica, der froh ist, dass sein älterer Bruder Alex, der unumstößlichen Tradition folgend, Feuerwehrmann wird, er selbst hatte wenig Lust dazu. Lieber studiert er Geschichte. Im Laufe der Zeit wechseln sich, begleitet von heftigen Unruhen, die verschiedenen Regime ab. Als die Kommunisten zunehmend angefeindet werden, finden die Freiheitlichen auch auf der Uni Anhänger, zu denen auch Victor gehört. Prompt wird er als Klassenfeind denunziert, – er ahnt, wer dahinter steckt. Man holt ihn zu Verhör, er durchleidet eine unmenschliche Untersuchungshaft. Beim Prozess stellt sich sein stärkster Belastungs-Zeuge als jemand aus seinem unmittelbaren Umfeld heraus. Homo homini lupus! Denunziant und Zeuge stehen beide natürlich ebenfalls unter dem Druck der Securitate. Als er acht Jahre später entlassen wird, gibt er seine düsteren Rachepläne auf, er sucht nur noch ein ruhiges Plätzchen. Das findet sich bei einem jüdischen Schneider, der ihn einstellt, obwohl er gar nicht schneidern kann, er sucht eigentlich nur einen Gesprächspartner. Erst als der alte Schneider sein Ende nahen spürt, bringt er Victor, im Crashkurs sozusagen, das Schneidern bei, Victor soll das kleine Geschäft fortführen. Dort lernt er dann auch seine spätere Frau kennen, mit der er schließlich ein Kind hat und in einen Plattenbau zieht.
Man hilft sich gegenseitig in diesem Unterschichten-Milieu, da werden auch schon mal verhungernde Kinder von der Straße in die Familie aufgenommen. Das geschilderte Elend ist unsäglich und wird über die Zeiten hinweg im Kommunismus vom geradezu absurden Mangel als neuer Drangsal abgelöst. Bei alldem wirkt die Feuerwehr-Dynastie der Stoicas wie ein Fels in der Brandung, mit dem Turm als Symbol. Wobei die Frauen die dominante Rolle einnehmen, immer gestützt auf eine bedingungslos gläubige Religiosität, man läuft oft mehrmals am Tag in die Kirche und spricht für jeden Wunsch direkt den dafür zuständigen Schutzpatron an. Florescu bildet sehr überzeugend das Leiden unter der ständigen Fremdherrschaft Rumäniens ab, schildert detailreich das bunte Leben in den Gassen, das Gewusel auf den Märkten der Stadt. Was dann aber, durch allzu häufige Wiederholungen überstrapaziert, irgendwann langweilig wird. Neben den wilden Zeitsprüngen erschwert auch eine Überfülle von oft schwer einzuordnenden Figuren das Lesen. Die rumänischen Begriffe und Sätze tun ein Übriges, das schmalbrüstige Glossar hilft da meistens nicht. Was die Spannung anbelangt, nimmt der Roman erst im letzten Drittel etwas an Fahrt auf und lässt einen roten Faden erkennen. «Der Turm schützt uns» heißt es ganz am Ende, als Victor nach seiner aufmüpfigen Tochter sucht in den Wirren des Umbruchs von 1989.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Hochaktuell
Hochaktuell Literatur-Skandal
Literatur-Skandal
 Hintersinnige Heimkehrer-Geschichte
Hintersinnige Heimkehrer-Geschichte Und täglich grüßt das Murmeltier
Und täglich grüßt das Murmeltier Schläfenlocken und Dolce Vita
Schläfenlocken und Dolce Vita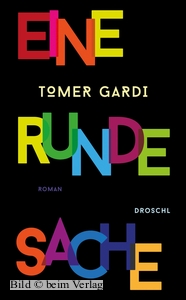 Absolut keine runde Sache
Absolut keine runde Sache Fataler Mix aus Rasse, Klasse und Geschlecht
Fataler Mix aus Rasse, Klasse und Geschlecht Hochaktuell
Hochaktuell Peinlich
Peinlich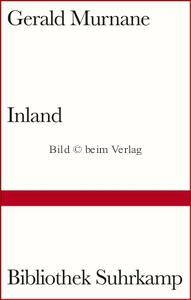 Unterschätzt
Unterschätzt Mehr Realität als Fälschung
Mehr Realität als Fälschung
 Wenn Tote miterzählen
Wenn Tote miterzählen