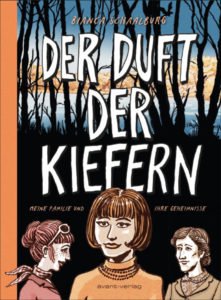 Eine wahre Geschichte über eine Mutter. In Liebe erzählt von ihrer Tochter. So lautet die Widmung in dieser Familienchronik der Kriegsgeneration als graphic novel inklusive Familienstammbaum im Anhang. Aber es ist nicht nur die Geschichte ihrer Familie, die Bianca Schaalburg hier erzählt, sondern auch ein großes Stück deutsche Geschichte. Die Geschichte eines Landes und eines Volkes repräsentativ dargestellt anhand einer typisch deutschen Familie.
Eine wahre Geschichte über eine Mutter. In Liebe erzählt von ihrer Tochter. So lautet die Widmung in dieser Familienchronik der Kriegsgeneration als graphic novel inklusive Familienstammbaum im Anhang. Aber es ist nicht nur die Geschichte ihrer Familie, die Bianca Schaalburg hier erzählt, sondern auch ein großes Stück deutsche Geschichte. Die Geschichte eines Landes und eines Volkes repräsentativ dargestellt anhand einer typisch deutschen Familie.
Der Duft der Kiefern
Das Erbe, das die Protagonistin übernimmt, besteht zunächst in schweren Holzkästen und einer Spiegelkonsole aus den Dreißigern, in der Bianca sich und ihre Familie erkennt. Wie war das, eine Kindheit unter den Nazis? Kann sie die Erinnerungen an diese Zeit bald ebenso mit Kreide überschreiben wie die alten Türen des Nussholzkastens, auf den sie Worte der Schönheit und der Träume schreibt? Die Kienäpfel (Berlinerisch für Kiefernzapfen), die sie als Kinder in der Siedlung Onkel Toms Hütte unter den Kiefern einsammeln vermitteln schöne Erinnerungen und doch ist das eigentliche Erbe der Eltern und Großeltern schwer zu (er)tragen. Opa Heinrich war schon 1926 (!) in die NSDAP eingetreten, aber die noch lebenden Familienmitglieder wissen nichts mehr davon. Das Mantra „Wir. Wussten. Von. Nichts.“ Bekommt sie in ihrer Familie und Verwandtschaft öfters zu hören. Also macht sie sich selbst auf die Suche nach Antworten und rekonstruiert die Familiengeschichte der Bewohner ihres Hauses. „Diese Menschen können ihre Geschichte nicht mehr erzählen. Deshabl will ich ihnen eine Stimme geben.“, schreibt sie und tut es sodann.
Zeitgeschichte für jede Generation
Aber sie erzählt auch von den anderen ermordeten MitbürgerInnen, den ZwangsarbeiterInnen, den Erschießungskommandos und Hinrichtungen, die oft in drei bis sechs Stunden 2-400 Menschen ermordeten. „Dazu gab es Wodka, manchmal auch einen Imbiss“, ergänzt sie, denn das Morden war tatsächlich organisiert wie eine Kaffeefahrt. Die Toten wurden zu Tausenden aufeinander gestapelt und im Wald vergraben. Und was war Onkel Heinrichs Aufgabe in Riga? Auch diese Frage bleibt unbeantwortet. Aber wer damals auf einem Pferd vor einem Holzhaus saß, dem konnte es wohl nicht so schlecht gehen. Der war aber auch nicht unschuldig. „Wenn wir gewinnen, müssen wir nichts erklären, wenn wir verlieren, gibt es nichts zu erklären“, lautete die bizarre Logik des Zweiten Weltkrieges. Darüber hinaus erzählt die Autorin auch von der Teilung der beiden deutschen Staaten, der Stasi, dem Kalten Krieg und 1968. Ein deutsches Lesebuch also, das in einfachen Worten und Bildern den Schrecken unseres Jahrhunderts nacherzählt, ohne etwas zu beschönigen. Vielleicht kann man gerade durch so eine graphic novel auch die junge Generation für die Geschichte ihrer (Groß-)Eltern interessieren und so die Erinnerung wachhalten, damit das, was passiert ist, nie mehr passiert. Ein wichtiger Beitrag also!
Bianca Schaalburg
Der Duft der Kiefern
Text & Zeichnung: Bianca Schaalburg
2021, 208 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen, 19,5 x 26,5 cm, vierfarbig
ISBN: 978-3-96445-058-6
Avant Verlag
26,00 €
Illustrated by Avant Verlag
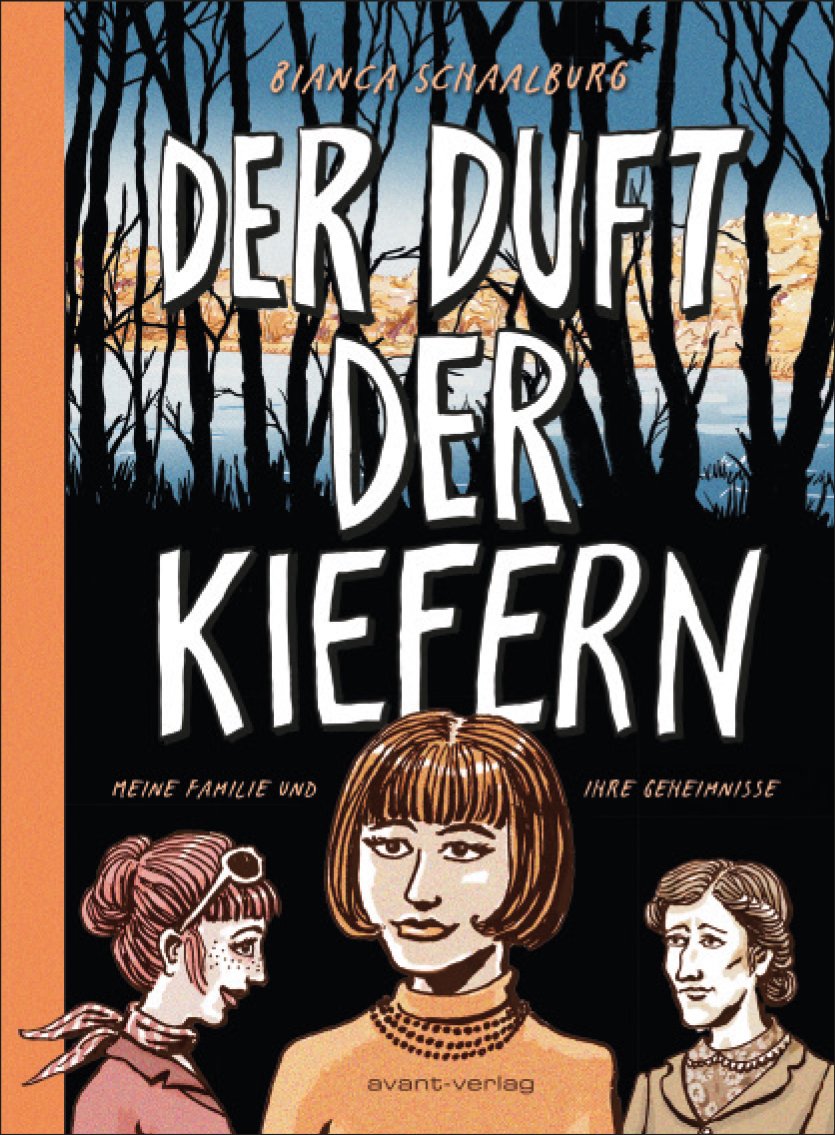

 The Cure. Dunkelbunte Jahre: 2019 wurden The Cure in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das bisher letzte, aktuelle, 13., Studioalbum von der Band aus dem südenglischen Crawley erschien 2008, also schon vor mehr als zehn Jahren. Da es also mit Album #14 noch etwas dauern könnte, können sich die Fans die Zeit bis dahin mit „The Cure. Dunkelbunte Jahre“ vertreiben. Das reich bebilderte, großformatige Werk orientiert sich in seiner Erzählung an der Chronologie der Studioalben. Ideal also auch als Nachschlagewerk für Fans und die es noch werden wollen.
The Cure. Dunkelbunte Jahre: 2019 wurden The Cure in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Das bisher letzte, aktuelle, 13., Studioalbum von der Band aus dem südenglischen Crawley erschien 2008, also schon vor mehr als zehn Jahren. Da es also mit Album #14 noch etwas dauern könnte, können sich die Fans die Zeit bis dahin mit „The Cure. Dunkelbunte Jahre“ vertreiben. Das reich bebilderte, großformatige Werk orientiert sich in seiner Erzählung an der Chronologie der Studioalben. Ideal also auch als Nachschlagewerk für Fans und die es noch werden wollen.



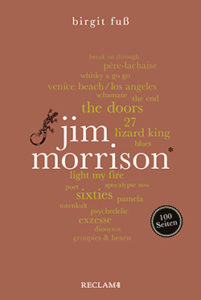 Jim Morrison. 100 Seiten: Am 3. Juli 2021 jährt sich der Todestag des Leadsängers der amerikanischen Rockgruppe The Doors zum 50. Mal. Der Poet, Regisseur und Rockstar würde Ende dieses Jahr aber auch seinen 78. Geburtstag feiern. Hätte er nur jenen verhängnisvollen 3. Juli 1971 überlebt. Oder doch Mojo Risin‘?
Jim Morrison. 100 Seiten: Am 3. Juli 2021 jährt sich der Todestag des Leadsängers der amerikanischen Rockgruppe The Doors zum 50. Mal. Der Poet, Regisseur und Rockstar würde Ende dieses Jahr aber auch seinen 78. Geburtstag feiern. Hätte er nur jenen verhängnisvollen 3. Juli 1971 überlebt. Oder doch Mojo Risin‘?


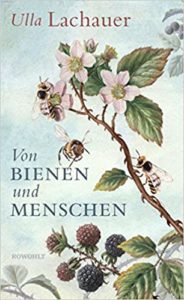 Auch für dieses Buch über Bienen und ihre Menschen nimmt die Autorin uns mit auf ausgedehnte Reisen, am Anfang und zum Schluss sind wir wieder bei Galina in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehn bei Kaliningrad, wo wir schon beim
Auch für dieses Buch über Bienen und ihre Menschen nimmt die Autorin uns mit auf ausgedehnte Reisen, am Anfang und zum Schluss sind wir wieder bei Galina in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehn bei Kaliningrad, wo wir schon beim  Heliogabal oder der gekrönte Anarchist: „Wer von der Liebe nur die Flamme kennt, die Flamme ohne Ausstrahlung, ohne die Vielheit des Herdes, wird weniger haben als jener andere neben ihm, dessen Hirn wieder zur Schöpfung als Ganzem zurückkehrt und für den die Liebe eine gründliche, grauenhafte Ablösung ist.“ Eine an „eine Feuersbrunst gemahnende Sprache“ unterstellt Jean-Paul Curnier dem Text von Artaud, die zu einer allgemeinen Asphyxie (Atemnot) führen würde, so dicht und überwältigend ist sie. Diesem Erstickungsgefühl habe Artaud einmal selbst im Theatre du Vieux-Colombier durch einen Schrei Luft verschafft und rechtfertigte sich in einem Brief an André Breton, den Diktator der Surrealisten, mit den Worten: „(…) denn tatsächlich war mir klar geworden, dass es genug der Worte war, sogar genug des Brüllens, dass es Bomben brauchte, aber ich hatte keine zur Hand, nicht einmal in meinen Hostentaschen“. Jean-Paul Curnier stellt die – berechtigte – Frage, ob es heute denn keinen Anlass mehr gebe, vor Atemnot und Empörung zu schreien. Die Antwort kennt wohl jeder von uns.
Heliogabal oder der gekrönte Anarchist: „Wer von der Liebe nur die Flamme kennt, die Flamme ohne Ausstrahlung, ohne die Vielheit des Herdes, wird weniger haben als jener andere neben ihm, dessen Hirn wieder zur Schöpfung als Ganzem zurückkehrt und für den die Liebe eine gründliche, grauenhafte Ablösung ist.“ Eine an „eine Feuersbrunst gemahnende Sprache“ unterstellt Jean-Paul Curnier dem Text von Artaud, die zu einer allgemeinen Asphyxie (Atemnot) führen würde, so dicht und überwältigend ist sie. Diesem Erstickungsgefühl habe Artaud einmal selbst im Theatre du Vieux-Colombier durch einen Schrei Luft verschafft und rechtfertigte sich in einem Brief an André Breton, den Diktator der Surrealisten, mit den Worten: „(…) denn tatsächlich war mir klar geworden, dass es genug der Worte war, sogar genug des Brüllens, dass es Bomben brauchte, aber ich hatte keine zur Hand, nicht einmal in meinen Hostentaschen“. Jean-Paul Curnier stellt die – berechtigte – Frage, ob es heute denn keinen Anlass mehr gebe, vor Atemnot und Empörung zu schreien. Die Antwort kennt wohl jeder von uns. Im Matthes & Seitz Verlag sind auch viele andere Werke von und über Artaud erschienen, zuletzt auch „Die Metaphysik Antonin Artauds“ von Merab Mamardaschili.
Im Matthes & Seitz Verlag sind auch viele andere Werke von und über Artaud erschienen, zuletzt auch „Die Metaphysik Antonin Artauds“ von Merab Mamardaschili.
 Der Mann mit der Ledertasche: „Post Office“ – so der amerikanische Originaltitel von 1971 – war Bukowski’s erster Roman, der den Grundstein für seine spätere Schriftstellerkarriere legte. Denn nach dem „Mann mit der Ledertasche“ quittierte er seinen Dienst und lebte von seinen Gedichten, Stories und Romanen. Insgesamt erschienen mehr als 40 Bücher, die meisten davon auch bei verschiedenen deutschsprachigen Verlagen.
Der Mann mit der Ledertasche: „Post Office“ – so der amerikanische Originaltitel von 1971 – war Bukowski’s erster Roman, der den Grundstein für seine spätere Schriftstellerkarriere legte. Denn nach dem „Mann mit der Ledertasche“ quittierte er seinen Dienst und lebte von seinen Gedichten, Stories und Romanen. Insgesamt erschienen mehr als 40 Bücher, die meisten davon auch bei verschiedenen deutschsprachigen Verlagen.
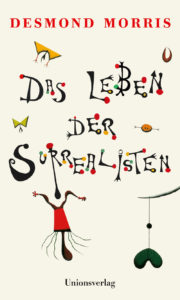 Das Leben der Surrealisten: Zunächst sei der Surrealismus gar keine Kunstbewegung, sondern ein philosophisches Konzept gewesen, das nach dem Ende des Völkerschlachtens des Ersten Weltkriegs in Europa Anhänger fand. Aufgrund der Fülle der Protagonisten hat sich Desmond Morris vor allem auf bildende Künstler und Künstlerinnen beschränkt, zweiundreißig an der Zahl, jeweils mit einem Porträtfoto und einem für sein Gesamtwerk charakteristisches Bild illustriert.
Das Leben der Surrealisten: Zunächst sei der Surrealismus gar keine Kunstbewegung, sondern ein philosophisches Konzept gewesen, das nach dem Ende des Völkerschlachtens des Ersten Weltkriegs in Europa Anhänger fand. Aufgrund der Fülle der Protagonisten hat sich Desmond Morris vor allem auf bildende Künstler und Künstlerinnen beschränkt, zweiundreißig an der Zahl, jeweils mit einem Porträtfoto und einem für sein Gesamtwerk charakteristisches Bild illustriert.



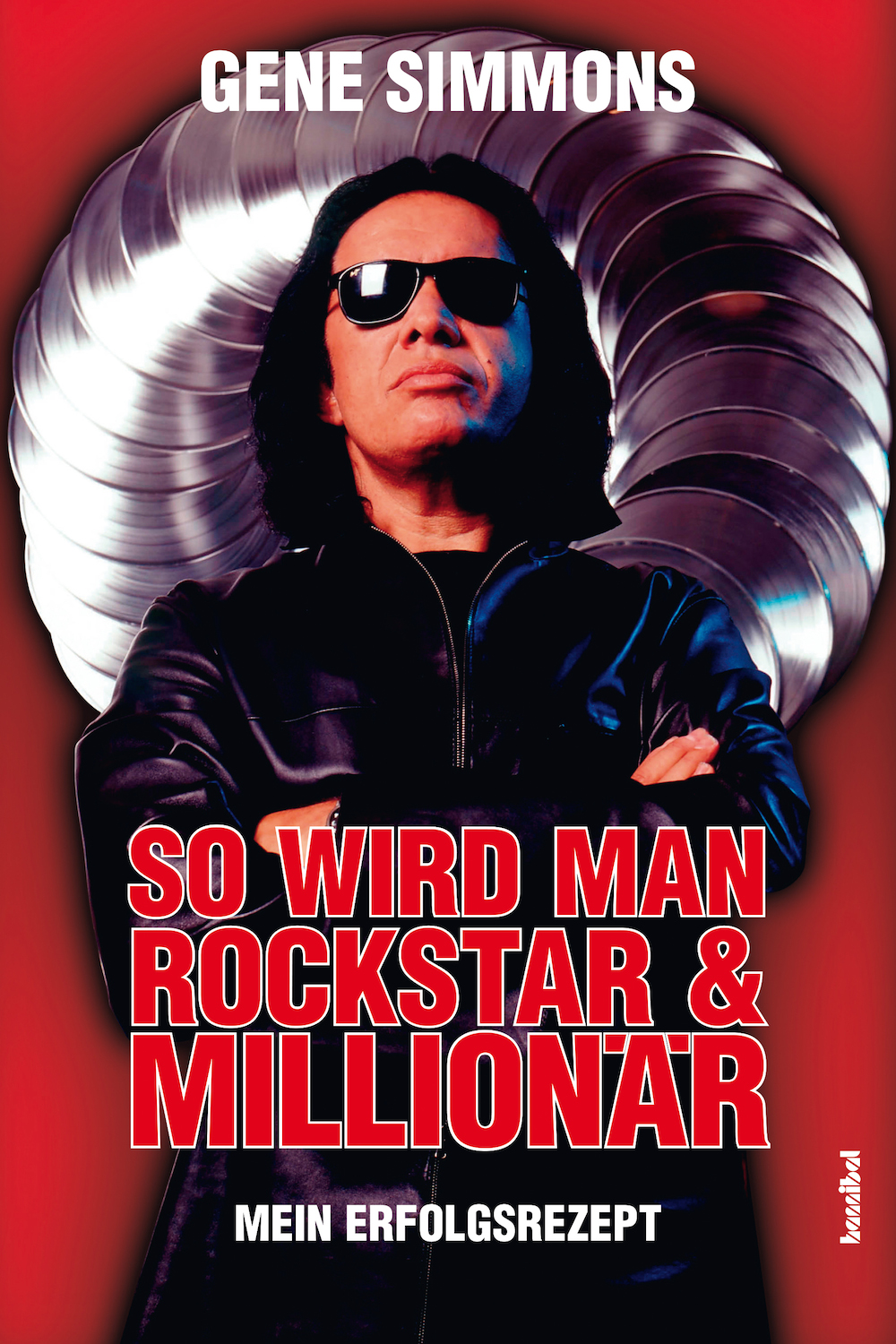
 Band oder Brand? Gene Simmons, der Rockstar: Seine Gruppe Kiss gehört zu den führenden Hard Rock Metal Bands die von den Siebzigern bis heute überlebt haben. Demnächst gehen Kiss aber dennoch auf ihre Abschiedstournee „End of the Road“. In „So wird man Rockstar und Millionär“ verrät der Frontman von Kiss sein Erfolgsrezept.
Band oder Brand? Gene Simmons, der Rockstar: Seine Gruppe Kiss gehört zu den führenden Hard Rock Metal Bands die von den Siebzigern bis heute überlebt haben. Demnächst gehen Kiss aber dennoch auf ihre Abschiedstournee „End of the Road“. In „So wird man Rockstar und Millionär“ verrät der Frontman von Kiss sein Erfolgsrezept. Unternehmensvorstände und Rockstars haben alle eine Gemeinsamkeit mit dir: Sie kamen als ganz normale Menschen auf die Welt! Den Rest machen einige Faktoren und Variablen aus, nicht zu vergessen ein unerschütterliches Arbeitsethos.“
Unternehmensvorstände und Rockstars haben alle eine Gemeinsamkeit mit dir: Sie kamen als ganz normale Menschen auf die Welt! Den Rest machen einige Faktoren und Variablen aus, nicht zu vergessen ein unerschütterliches Arbeitsethos.“

