Ein in jeder Hinsicht wichtiges Buch! Ich möchte diese Rezension nicht weniger derb beginnen, weil „New Cage“ sowohl zur Lektüre jedes spirituell Interessierten als auch des chronischen Kritikers jeglicher Esoterik zählen sollte.
Die Krux am gesellschaftlichen Diskurs ist doch, dass es über „Esoterik“ keinen gibt. Die Linke hat mit diesem garstigen Thema gar nichts am brennenden Hut – ist einfach außer jeder Kritik; die Konservativen wollen keine Konkurrenz durch Diskussion salonfähig machen; eingefleischte Atheisten scheinen sich wie der Teufel vorm Weihwasser zu fürchten.
Daher ist die Unternehmung Johannes Fischlers aufs äußerste zu begrüßen. Er schafft eine wertvolle Basis für einen fundierten Diskurs, der unerlässlich sein sollte, vor allem wenn man davon ausgeht, dass eine Grundannahme des Autors stimmt. Nämlich, dass die Esoterik bereits mitten in der Gesellschaft angekommen sei. Mit zahlreichen Beispielen belegt er diese These – etwa würden Schulklassen auf Esoterikfachmessen gekarrt, um Kinderenergiearbeit (und Kinderschutzengelkommunikation) kennenzulernen. Das WiFi fördert Kurse, in denen man/frau sich nach „Kryon“-Ausbildungskonzepten zum Energie-, schlimmer noch: Lichtarbeiter umschulen lassen kann. Und Geistheiler kann man durch staatliche Legitimation werden, wenn man den entsprechenden Gewerbeschein der österreichischen Wirtschaft ersteht.
Kein esoterisch denkender/glaubender Mensch kommt ohne Engelsprays oder Engelkarten (die oftmals im Set feilgeboten werden) oder allerlei anderen Tand aus, was zu einer zweiten Hypothese des Autors führt: dass die esoterische Spiritualität 2.0 vor allem eine riesige Geschäftemacherei im Sinne gewiefter Werbe-Strategen sei.
Den Kunden – die heute nicht in Sekten organisiert sind, sondern in Onlineforen bzw. -gruppen Lehr-CDs und Engelsprays bestellen können – werden von ihren Geschäftsmeistern Aufträge mitgegeben, die Welt ins Licht zu führen, Planentenarbeiter zu werden, die Energie der Erde anzuheben etc. – so kaufen sie gern im Bewusstsein ihrer Wichtigkeit: missionieren sowie verkaufen in einem Atemzug. Fischler stellt recht klare Bezüge zur Konsumwelt her, in der der Trend zur Super-Marke, zum Mega-Brand unübersehbar ist, der zugleich den Konsumenten zum Spezialisten und Kenner (etwa der feinsten neuen Kaffeekapseldüfte) erhöht. Ähnlich funktioniert das Geschäft mit der Esoterik: jeder Lichtarbeiter kann sich eingeweiht schätzen und damit auch noch Geld verdienen (versuchen). Ich verstehe diesen Drang aus einer entfremdeten Arbeitswelt aussteigen zu wollen und auf einer Ebene zu arbeiten, in der das eigene Heil, Gesundheit, Glück erreichbar scheinen und gleichzeitig der Lebensunterhalt zu bestreiten ist. Leider aber werden damit zahlreiche ehrlich Sich-Bemühende zu Opfern, die gleichzeitig als Täter fungieren. Sie führen nicht ins, sondern hinters Licht. Fischler unterscheidet in seinem Werk zwischen spirituellen Methoden wie Meditation, Yoga, Chi Gong und Konsumesoterik. Er bestätigt das Bedürfnis in einer entindividualisierenden und entseelenden Zeit nach Identität und Erfüllung zu suchen: Sehr deutlich lässt er uns wissen, wie dieses Bedürfnis gerade in der Esoterik 2.0 korrumpiert, manipuliert und ins Gegenteil verkehrt wird.
Fischler spricht von der Re-sakralisierung der Welt in Folge der eher agnostischen Jahrzehnte der Vergangenheit. Doch Spiritualität, die zu Luxusartikeln verkam, die der auf Markenprodukte geeichte Konsument noch zu seinem Image hinzufügt, um ein bezauberndes Ich in die Welt zu stellen – damit hat Spiritualität, die nicht auf Schein und Selbstinszenierung abzielt, sondern auf psychisches/seelisches Wachstum nichts gemein. Fischler arbeitet einen Effekt heraus, der tiefer ins Elend, statt zur Befreiung führt: je massiver sich der Eso-Suchende mit scheinspirituellem Tand umgibt, desto schneller muss er sich nach weiteren Dingen umsehen, damit die scheinbare Wirkung nicht verfliegt, der Engelsduft sich nicht verflüchtigt. Damit gerät der Eso-Konsument (der aber als Lichtarbeiter ja gleichzeitig heilige Tupperware verhökert) in eine Teufelsspirale. Einerseits mag diese ihn in den Abgrund der materiellen Verelendung reißen (wenn alles Geld für diverse unmöglichen Quacksalber-Produkte und Kurse verpulvert wurde), anderseits kommt`s möglicherweise bald auch psychisch zum Burnout. Um nichts von der wirklichen Welt in sein Denken einzulassen, muss der Engel-, Planeten- und Allarbeiter ständig nach neuen Angeboten der sakralen Konsumwelt suchen, um seine Scheinidentität aufrechtzuerhalten. Er benötigt zunehmend schneller frische „Systeme“, um Praktisches, Lebenswichtiges und Notwendiges sowie seine eigenen Zweifel und Ängste zu verdrängen. Das schafft eine weit abgehobene Persönlichkeit (die im Zeitalter des Narzissmus noch nicht sonderlich auffallen würde), vor allem aber eine Psyche, die vermittels sämtlicher aus der Psychoanalyse bekannten Abwehrmechanismen Realität derart verleugnet, dass letztlich der Feind im Außen gleichermaßen an Gewaltigkeit zunimmt, wie eigene unerwünschte Impulse verdrängt werden müssen. Anzunehmen ist auch, dass nicht alles so läuft, wie es der Glücksarbeiter gern hätte und dem (teuflischen/dämonischen) Außen dafür Schuld gegeben werden muss. Hier zeichnet sich eine politisch äußerst gefährliche Entwicklung ab, die nur im ernsthaften und bemühten Diskurs aller mit Vernunft Ausgezeichneten und mit einem liebevollen Herz Begnadeten abgewendet werden kann.
Nicht zustimmen vermag ich des Autors Rekurs auf überholte Entwicklungsmodelle des Ich-Konzepts, wie sie uns reduktionistische Wissenschaft einreden will. Eine spirituelle Psyche ist keineswegs eine regredierte, Fischler (ver)mag nicht im Sinne Ken Wilbers zwischen prä- und transpersonalen Entwicklungen zu unterscheiden. Für den Eso-Narzissten gilt jedoch leider sehr wohl, dass nicht reifere Ich-Strukturen aufgebaut werden, sondern eine Schein-Identität von Besonderheit, Spiritualität, Einzigartigkeit die innere Leere übertüncht. (Was für den Narzissten, der wissenschaftlich tätig ist, ebenso gilt; Spiritualität ist halt dann durch den Allmachtglauben der Wissenschaft ersetzt). Der Mystiker weiß aber, dass jenseits des abgeschotteten, isolierten Modernen-Ich eine Dimension der Erfahrung existiert, die sein Dasein unendlich bereichert. Der Mystiker weiß allerdings auch, dass Engel selten zum Menschen sprechen – und wenn, dass ihn diese Erfahrung bis ins Mark erschüttert, und die infantilisierten Engel des Eso-Betriebs, die eher wie Heinzelmännchen wirken, die man auf astraler Ebene für sich schuften lassen will, schon gar nichts damit gemein haben. Den Irrglauben beständig Botschaften aus dem Himmelreich, anderen Planeten, anderen Dimensionen channeln zu können/müssen, sollte wirklich schleunigst ein heiliger Riegel vorgeschoben werden. In Engelsprays sind keine Engel zerstampft oder destilliert, Engelsalben aus Energie gibt’s nicht, und allerlei anderer Unsinn wäre einfach mit dem Begriff der Quacksalberei aus den Verkaufsregalen der Drogeriemärkte zu verbannen.
Traurig ebenfalls, dass heute Kinder als Partnerersatz missbraucht werden (lt. Winterhoff u.a.). Furchtbar, wenn sie zu Indigo- oder Kristallkindern stilisiert werden, womit man ihnen eine normale Kindheit raubt, weil man sie auf ihre besondere Rolle vorbereitet (die auch auf die Eltern zumindest violett abfärbt), sie damit jedoch hundertprozentig ins narzisstische Größenselbst und in egomanische Allmachtphantasien treibt. Natürlich passiert das jenseits esoterischer Familien (Mütter) ebenfalls – dies vergisst Fischler nicht zu erwähnen.
Kontraproduktiv scheint mir einzig die Einleitung des Buchs, die von einem der Science Busters verfasst wurde: Er versucht Spiritualität insgesamt zu diskreditieren. Diese sei eingebildet und überheblich, während Wissenschaft Segnungen wie das Fernsehen und Handys hervorgebracht habe. Als Beweis für die Richtigkeit und Allgültigkeit der Wissenschaften nennt er die Lebenserwartung eines heute Geborenen von 100 Jahren im Vergleich zu jener vor 15o Jahren, die bei 35 gelegen habe. Ich denk, dieser aus dem Hut gezauberte Zahlentrick belegt zur Genüge, wie arrogant und kreativ Wissenschaft mit der Wahrheit umgeht: In den USA nimmt die Lebenserwartung aufgrund der ungesunden Lebensweise und der zerstörten Umwelt bereits wieder ab; in Europa wird sie hauptsächlich deshalb höher, weil die Kindersterblichkeit abnahm (wäre eine eigene Diskussion, ob wegen Impfungen oder sonstigen Gründen), außerdem starb wohl die Generation schon fast aus, die zahlreiche Vertreter im 1. oder 2. Weltkrieg verlor. Zudem liegt die Lebenserwartung in manchen afrikanischen Ländern nun bei unter 35 Jahren, da die Ausbeutung durch Fischereikonzerne der langlebenden Welt und Landgrabbing und diverse andere Ungerechtigkeiten das eben bewirken.
Man könnte auch sagen: Wir fressen denen dort drunten das Fleisch von den Knochen – aber verfettet lebt man auch nicht lange – siehe oben: USA… Und wer heute als 8o-Jähriger stirbt, verbrachte wahrscheinlich die letzten zehn Jahre sediert im Altersheim: welch Sinnbild für unsere moderne wissenschaftlich so fortschrittliche Welt.
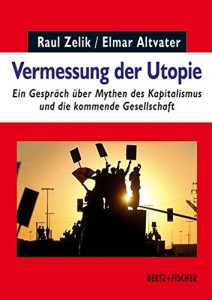
 Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Folge der Fortsetzungsgeschichte »Fleischsucht: Wie wir unsere Fleischreste unters Volk bringen« veröffentlicht wird. Nur weil derzeit nicht bundesweit über neues Ekel- oder Gammelfleisch skandalisiert wird, heißt das nicht, dass derlei Schweinereien nicht stattfinden.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht eine neue Folge der Fortsetzungsgeschichte »Fleischsucht: Wie wir unsere Fleischreste unters Volk bringen« veröffentlicht wird. Nur weil derzeit nicht bundesweit über neues Ekel- oder Gammelfleisch skandalisiert wird, heißt das nicht, dass derlei Schweinereien nicht stattfinden.