SPRACHE UND EXIL
Der österreichische Lyriker Fritz/Frederick Brainin
Peter Paul Wiplinger
,,Nach Jahren kam, verstört, ich wieder her;
der alten Gassen manche sind nicht mehr,
der Ringturm kantig sich zum Himmel stemmt:
erst in der Heimat bin ich ewig fremd.”
Theodor Kramer – Wien, 28.11.1957
Wiedersehen mit der Heimat, GA III/590
Mit diesen Zeilen beschreibt der große österreichische Exildichter Theodor Kramer, dessen Andenken der Jugendfreund und Exilgenosse Fritz/Frederick Brainin sein literarisches Werk, den Gedichtband ,,Das siebte Wien”, widmet, die Zeichen seiner Heimkehr.
Es ist nicht ein momentanes Gefühl der Verzweiflung, das sich im letzten Satz dieser Verse manifestiert, keine psychische Überreaktion, hervorgerufen und gesteigert durch den psychischen Streß eines lang erwarteten und herbeigesehnten Wiedersehens mit der Heimat, nein, das ist zwar die poetisch-literarische, aber doch zugleich nüchterne Formulierung einer Selbstdiagnose betreffend die nicht mehr gegebene Integrationsfähigkeit augrund des Leidens an der Krankheit mit dem Namen „Exil“.
Wie jede Krankheit hat auch diese ihre Wurzeln, ihre Ursachen, ihre Bedingungen, ihren Ausbruchsort und ihre Ausbruchszeit, ihre Eigendynamik, ihre Schübe, ihre krisenhaften Höhepunkte, ihren chronischen Status, ihre Langzeitwirkung. Wie jede Krankheit hat auch diese ihre symptomatischen Begleiterscheinungen, die der Deformation im physischen und psychischen Bereich; für einen Dichter auch in dem der Sprache. Fritz/Frederick Brainin ist dafür ein Beispiel.
Was Kramer im letzten Satz seines Gedichtes oben ausspricht, zwei Monate nach seiner Rückkehr aus dem Exil und nur fünf Monate vor seinem Tod, das ist die allgemein gültige Formel, die für viele gilt, für viele österreichische Dichter, die, wenn schon nicht am Exil zugrunde gegangen, so doch letztendlich an ihm physisch, psychisch und oft auch literarisch zerbrochen sind. Neben Kramer und Brainin nenne ich hier noch die Namen zweier anderer österreichischer Exildichter: Friedrich Bergammer (Glückselig), ein Freund Brainins, gestorben 1981 im New Yorker Exil; und Alfred Gong, ebenfalls im New Yorker Exil gestorben, 1982. Und natürlich denkt man in diesem Zusammenhang vor allem auch an Joseph Roth.
Im Herbst 1988 kommt Fritz/Frederick Brainin nach 50 Jahren Exil in den USA (New York) zu einem längeren Besuch in sein Heimatland Österreich, in seine Geburtsstadt Wien. Aber kann und darf man hier wirklich das Wort ,,Heimatland” gebrauchen, kann und darf man dieses Wien mit seiner Geschichte seit 1934 wirklich noch als die ,,Vaterstadt” des Exilanten bezeichnen? Würde er dies selber tun, dies von anderen zulassen? Ist nicht dieses ,,Heimatland“, das seine Heimatlosigkeit durch Vertreibung und Exil um den Preis des Am-Leben-Bleibens verschuldet hat, nicht längst zur Fremde geworden; und er ein Fremder in ihr? Kann man eine Vaterstadt so nennen, die einen ausgestoßen, ausgewiesen, verbannt und auch nie zurückgeholt hat; die für diese und die anderen Vertreibungen, für die Ermordungen von Tausenden ihrer Mitbürger, ihrer Kinder, nie Sühne geleistet, nie den Versuch einer wenigstens symbolhaften, an jenen, bei denen es noch möglich gewesen wäre, „Wiedergutmachung“ unternommen hat, die sich nie der eigenen Wahrheit gestellt hat.? Muß man diese so schönen Worte der Bezeichnung für Herkunft nicht auf die emotionslose Angabe ,,Geburtsort“ bzw. „Geburtsland” reduzieren? Gerechterweise, für die Betroffenen und für die Verursacher, für die Täter und für die Opfer?
Wer aber ist nun dieser Fritz/Frederick Brainin? Was war sein Leben, was ist seine Literatur? Er ist ein Vertriebener, ein Verschollener, ein Heimatloser, der in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent für fünfzig Jahre seinen Aufenthalt gefunden hat. Er ist einer, der die Heimat verloren, weil man sie ihm weggenommen hat. Auch die ursprüngliche Heimat hat damit etwas verloren, auch sein Wien. Und seine Literatur, seine Gedichte legen davon Zeugnis ab. Zeugnis von diesem Fremdsein in der Fremde, in der Welt, und nicht zuletzt im eigenen Leben. Ausgestoßen, weil ein Ausgestoßener. Vertrieben, weil ein Vertriebener. Unberührbar, weil ein Unberührbarer. Unsicher, weil ein Verunsicherter. Ein Verstörter, weil man sein Leben in einem Maße gestört hat, daß es an Zerstörung grenzte. Ein unglücklicher, weil Unrecht unglücklich macht. Ein Entwurzelter, weil man ihn aus seinem Boden ausgerissen, von seinen Wurzeln getrennt hat. Ein Liebender, dem man seine Liebe mit Bedrohung, Vertreibung, mit Vergessen beantwortet hat. Ein Dichter, dem man die Sprache, seine Muttersprache, seine Dichtersprache genommen hat.
Dieser Dichter kommt nach Wien zurück und arbeitet hier 1988 an der Zusammenstellung seines Manuskriptes ,,Das siebte Wien”. Gibt seinem Buch den Titel mit dem Namen seiner – längst verlorenen Heimatstadt. Er legt ein literarisches Lebenswerk wie ein Vermächtnis vor, als Zeugnis für seine Verbundenheit mit dieser seiner ,,Heimatstadt” ,aber auch als Zeugnis für sein Getrenntsein, für seine Trennung von ihr, für die daraus entstandene Verwundung und Deformation. Und publiziert diesen Gedichtband mit diesem Titel sechzig Jahre später in jener Stadt, wo 1929 sein erster Gedichtband ,,Alltag“ erschienen war, mit den Gedichten, die er als Sechzehnjähriger in seiner damals wirklichen Heimatstadt Wien geschrieben hatte. Und widerlegt, vielleicht nur scheinbar, jene Erkenntnis, die er resumeehaft in der ,,Ballade von den Bronx Fiestas“, einem Gedicht aus den Jahren 1960 bis 1970, folgendermaßen formuliert:
,,Ein siebentes Wien, von dessen erstem verbleibt keine Spur!”
Was hier literarisch ausgedrückt wird, stimmt jedoch existentiell nicht, jedenfalls nicht ganz. Im Gegenteil: Ein Leben lang begleiten Fritz/Frederick Brainin diese Spuren vom ersten Wien, vom Wien seiner Kindheit und Jugend, vom Wien mit seiner Familie, seinen Freunden, seinen politisch-weltanschaulichen Bindungen, von seinen ersten literarischen Versuchen und Erfolgen. Diese Spuren durchziehen sein ganzes Leben, sein ganzes literarisches Schaffen, sein ganzes dichterisches Werk. Diese Spuren sind es, die ihn immer wieder auf dem Weg der Erinnerung zurückführen in das Einst, wie in ein vergangenes Leben. Diese Spuren – sie werden zu tiefen Furchen, die sein Leben durchziehen es prägen ihm jenes Gesicht gelebten Lebens geben. Und am Ende des Weges führen sie ihn wieder zurück. Gelebte Bitterkeit weicht in der Erinnerung und manchmal dann auch im Gedicht einer wieder aufdämmernden Wärme und Zärtlichkeit, die ihn umfängt, wenn er an dieses erste Wien denkt. Die Wehmut aus dem Wissen um den bevorstehenden Abschied mischt sich ein, mildert die Trauer, die Enttäuschung, die Verbitterung; verringert die Distanz zum Schuldpotential der Verursacherstadt, verringert seine Resignation, verkürzt die einst unüberwindbar scheinenden Abstände und Gräben zu seiner Jugendstadt. Das erste Wien, das Wien seiner Kindheit rückt in diesem Alter wieder näher mit dem zusammen, das er jetzt erlebt. Geburt und Tod, frühe Kindheit und spätes Alter, liegen nahe beisammen.
Aus einem späten Gedicht Brainins aus den Achtzigerjahren, betitelt ,,Österreich – Ein kürzliches Selbstbildnis” ist dies vielleicht zu entnehmen: ,,Seit neunundvierzig Jahren hier in New York City,/ auf meiner amerikanischen Kriegsinvalidenpension, /hab ich noch immer mitten in der Nacht den Traum,/ wo unter vielen Rot und Braun-Wandschrift-Graffiti/ ich noch immer in der Lessinggassen wohn/ (noch unrasiert den Ober-Bundesrealschülerflaum!)”
In diesen sechs Zeilen sind ganz wichtige. Schlüsselwörter enthalten, mit denen uns der Autor Fritz/Frederick Brainin den Zugang auf der Ebene der Textinterpretation zu seinem Leben und zu seinem dichterischen Werk ermöglicht. Die Wortzusammensetzung „Wandschrift-Graffiti” ist eine für Brainin typische Wortverbindung aus Deutschsprachigem und Fremdsprachigem, wobei jedes der beiden Wörter eigentlich das Gleiche bedeutet, sodaß die Zusammensetzung beider Wörter nichts anderes als eine Tautologie ergibt. Hier werden also die beiden Sprachebenen, das Deutsche und das Fremdsprachige, meist Anglo-Amerikanische, auf denen die dichterische Exilsprache beruht, die so etwas ist wie eine individuelle, künstliche Kunstsprache, die mit vielen Alltagsfloskeln aus beiden Sprachen durchsetzt ist, sichtbar. Beide Sprachebenen sind im Werk Fritz/Frederick Brainins immer wieder ineinander geschoben, durchdringen und durchsetzen das literarische Werk. Die Bewußtseinsebenen, aus denen das Gedicht entsteht, diese wiederum liegen wie die verschiedenen Schichten von mehreren Graffiti übereinander. Immer wieder wird die Schicht eines soeben fertiggestellten Graffitos durch die eines neuen ersetzt, überdeckt, wobei das Bild des vorhergehenden Graffiti jeweils verändert, übermalt, zerkratzt, perforiert und zum Teil auch zerstört wird. Den verschiedenen Zeit-, Erinnerungs- und Bewußseinsebenen – unter Einbeziehung des Unterbewußten in den künstlerischen und dialektischen Prozeß -entsprechen die verschiedenen tektonischen Schichten der übereinander gelegten Graffiti, die sich am Ende als bruchstückhaftes Gesamtbild, als ein vielschichtiges Netzwerk, aufgebaut aus einer Aktionseinheit von schöpferischer Konstruktion und Destruktion, präsentieren.
Die Worte Rot und Braun haben natürlich einen realen Sprachbezeichnungscharakter als Bezeichnung für eine Farbe, darüber hinaus aber sind sie symbolhafte Metaphern für Blut, Gewalt und Tod,, aber auch für „das Rote Wien“, für die Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie, der Fritz Brainin als Mitglied der Roten Falken nahestand. Und Braun steht selbstverständlich für die Nazis, für die Braunhemden, für die SA.Farben, als Metaphern für politische Richtungen und Organisationen, als Symbole für Uniformen und Fahnen, für Gedankengut und politische Einstellung.
Und dann ist da noch das Wort „Traum“. Ein solcher Traum, von dem Brainin hier spricht, ein solcher Traum, den es ,,noch immer mitten in der Nacht…seit neunundvierzig Jahren…in New York…“ gibt, in dem eine über ein halbes Jahrhundert sich erstreckende Erinnerung gespeichert ist, die im Traum deutlich sichtbar und erlebbar wird, ein solcher Traum hat auch etwas mit dem Wort des gleichen Wortstammes zu tun, nämlich mit dem Wort „Trauma“. Laut Duden ein Begriff für Verletzung, Verwundung, Wunde,, seelischer Schock, starke psychische Erschütterung, Verletzung durch äußere Gewalteinwirkung.
Ein Traumbild also, in dem unter vielen Schreckensbildern, die wie Graffiti in verschiedenen tektonischen Schichten, aber nicht deckungsgleich, übereinander lagern, das Bild der Kindheit und Jugend in Wien in der Lessinggasse bruchstückhaft hervorleuchtet, als Spur vom ersten Wien. Ein Traumbild als Widerspiegelung des Bewußtseins: Das eigene, ursprüngliche, jetzt verletzte und zum Teil zerstörte Selbstbildnis, wie es im Titel des Gedichtes heißt.
Was war das für ein Wien, an das sich Brainin im Traum erinnert? Wie war dieses Wien, wie war die Leopoldstadt damals, dieses Viertel, das ,,Mazzesinsel” genannt wurde? War es ein Ort inmitten der ,,Insel der Seeligen”, um diese verlogene Österreichbezeichnung, diesen Inbegriff selbstgefälligen Selbstbetruges anzuführen, dessen Wurzeln in der Verdrängung und Verfälschung der Wirklichkeit liegen, gerade auch in der heutigen Gesellschaft und Zeit?
Am 22. August 1913 wird Fritz Brainin in ein Wien der zu Ende gehenden Österreichisch-Ungarischen Donaumonarchie hineingeboren. Sein Vater, aus Litauen stammend, Schüler des Bildhauers Anton Hanak, nimmt am Ersten Weltkrieg teil, wird verwundet, kehrt 1919 aus der italienischen Kriegsgefangenschaft endlich heim, wird ein kleiner Beamter im Heeresministerium. Also schon von Anfang an war die Kindheit überschattet durch unruhige Verhältnisse in der Familie, durch Krieg, durch den großen politischen und gesellschaftlichen Umbruch nach dem ersten Weltkrieg. Brainin verbringt die Jahre 1914-1919 mit seinem älteren Bruder Max und seiner Mutter bei den Großeltern. in Leipnik in Mähren. Fritz absolviert seine Schulpflicht in Wien, besucht die Realschule in der Vereinsgasse, gleich um die Ecke von der Lessinggasse. Sein Bruder und sein Freund und dichterischer Mentor, Theodor Kramer, sind einige Klassen vor ihm. Später erinnert er sich noch immer an die ,,bösartige Traumatik” (Gedicht: Ein kürzliches Selbstbildnis), die ihn mit diesem pädagogischen Institut verband. 193l legt er dort die Matura ab und beginnt anschließend ein Studium der Philosophie an der Universität Wien, das er jedoch 1932 wieder abbricht. Schon in der Realschule ist er Mitglied bei den Roten Falken, hat Kontakt zur Jugendberatungsstelle Viktor Frankls, der nicht weit entfernt, jenseits der Praterstraße in der Czerningasse wohnt, und zur ,,Gruppe der Jungen”, der auch Hermann Hakel, Fritz Hochwälder und Richard Thieberger angehören. Aus dieser Zeit stammt auch seine Freundschaft mit dem anderen österreichischen Exildichter Friedrich Bergammer, der mit seinem Familiennamen eigentlich Glückselig heißt. Unter dem Einfluß von Frankl und dessen Freund, dem Verleger Erwin von Barth-Wehrenalb, beginnt Brainin schon früh zu schreiben, erreicht schon früh eine erstaunliche Fertigkeit und eine große Reife in seinen Gedichten, die natürlich noch an großen Vorbildern (Brecht, Tucholsky, Kästner) und den herrschenden literarischen Strömungen (Spätexpressionismus, Balladenform des genrehaften Arbeitergedichtes) orientiert waren. Und doch erreicht er schon früh, mit sechzehn Jahren schon, eine starke persönliche Aussagekraft und eine literarische Gestaltungsform, wie dies das wunderschöne Liebesgedicht ,,Hauptallee”, eines der schönsten Liebesgedichte der deutschen Literatur, beweist, das er als etwa Zwanzigjähriger schrieb. Hier dieses Gedicht.
Hauptallee, an Thea S.
Kühl wirds auf der Bank. Rück nah. Dein Kleid ist dünn.-
Liebst du so wie ich den Herbst in dieser Stadt?-
Leichter gibt sich seiner Traurigkeit hier hin,-
wenn die Nacht wächst und die Tage kürzer glühn,-
einer, der wie ich jetzt keine Arbeit hat, Geliebte.
Lass dein Haar an meiner Wange ruhn, es riecht
so herb wie eine Wiese im Oktoberdunst.
Die Autos hupen fern; uns trifft kein Bogenlicht.
Mit meinen Lippen nur begreif ich dein Gesicht –
und das Sein trotzalledem als eine Gunst,
Geliebte.
Dieses Gedicht atmet noch ,,trotzalledem“ eine ergreifende, unbeschreibliche Geborgenheit aus, die noch nicht erschüttert ist von den umliegenden und später noch kommenden Ereignissen, die dann das Weltbild Brainins erschüttern, destabilisieren und das Ich- und Seinsgefühl traumatisieren und brüchig werden lassen. Gerade in der Hinwendung zu einem geliebten Du, in einer noch so jugendlichen, aber doch schon reifen Liebesbeziehung, mag der Autor eines solchen Gedichtes noch die tragfähige Brücke über die schon sich auftuenden Gräben, über den wenig später aufbrechenden Abgrund, gesehen und erlebt haben. Dieses Gedicht ist noch getragen und gezeichnet von einem Gefühl der Hoffnung und Zuversicht; als ob die Liebe etwas sei, sie allein, die den Abgrund überspannen und überwinden könnte. Aber die Gewalt spricht eine andere Sprache. Und die Gewalt ist es, die zerstört, die alles zerstören wird. auch das Urvertrauen in die Unverletztbarkeit der eigenen, ja überhaupt der menschlichen Existenz. Von dieser Zerstörung werden die anderen Gedichte Brainins, die aus den nächsten fünfzig Jahren, dann sprechen; exemplarisch und als Paradigma anhand seiner physischen, psychischen. intellektuellen und literarischen Existenz. Das ist das Zeichen seiner Exilliteratur, in der Sprache des Exils: Das literarische Zeugnis vom Zerbrechen einer ursprünglich vorhandenen und gegebenen Einheit und Unverletztheit seines Persönlichkeits- und seines Weltbildes.
Noch einmal ein Blick zurück auf das Wien der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Es ist die Zeit des großen Umbruchs nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, in der alle bisherigen Ordnungen sich aufgelöst hatten und keine tragfähigen Neuordnungen gefunden und aufgebaut werden konnten. Es ist ein Wien voller Flüchtlinge aus dem Osten, ein Wien voller Armut und Not, aber auch ein Wien, in dem neue solzialpolitische Ideen große Hoffnungen wecken, auch zu berechtigen. 1919 flüchten über 350.000 Menschen aus den ehemaligen Ost- und Südostgebieten nach Westen, darunter viele Juden. 25.000 Ostjuden, alle die Ärmsten der Armen, siedeln sich in Wien, in der Leopoldstadt, in der Mazzesinsel an; womit die Zahl der Juden in der Leopoldstadt auf über 60.000 ansteigt: Jeder zweite Leopoldstädter ist ein Jude. Insgesamt gibt es in Wien an die 120.000 Juden, jüdische Mitbürger, wie es seit dem Toleranzpatent Kaiser Joseph II. sprachamtlich heißt. Über 120 jüdische Vereine regeln das Alltagsleben der Juden in Wien. Das Ansteigen der jüdischen Bevölkerung steigert auch – provoziert durch die Hetzpropaganda der Deutschnationalen und der Christlichsozialen und durch gezielte antijüdische Aktionen wie die vom ,,Deutschösterreichischen Schutzverein Antisemitenbund”, der Progromaufrufe in der Leopoldstadt verteilt, den Antisemitismus unter der nicht-jüdischen Bevölkerung, sowohl in der Leopoldstadt als auch im gesamten Wien, sowie überhaupt in Österreich. Keine politische Partei, auch nicht die Sozialdemokraten, keine kirchlichen oder sonstige Organisationen treten offen und geschlossen gegen den aufflammenden Antisemitismus auf. Seit 1925 agieren Nazis und andere Völkische gemeinsam gegen die Juden. 1929 wird von ihnen das Café Produktenbörse überfallen, die Einrichtung wird zertrümmert, die Juden werden mit Gewalt bedroht. 1932 stürmen sie am jüdischen Neujahrsfest das provisorische jüdische Bethaus im Café Sperl in der Großen Sperlgasse und schlagen auf die Betenden mit Stahlruten ein (Ruth Beckermann in „Die Mazzesinsel“, Seite 20). Und die Menge schaut zu. Den Tätern passiert nichts. Es ist wie eine Generalprobe zur Reichskristallnacht am 9. November 1938, in der alle Synagogen und jüdischen Geschäfte zerstört und die jüdischen Mitbürger mißhandelt wurden; voll Zynismus, voll Verachtung, voll Haß, mit Gewalt.
Eine Anmerkung zum sozialen Hintergrund dieser Zeit, die nichts entschuldigt, sondern nur veranschaulichen soll, auf welchem Boden und vor welchem Hintergrund sich diese Ereignisse abspielen. 1925 gewinnen die italienischen Faschisten die Wahl mit 65% Mehrheit. Mit dem ,,Schwarzen Freitag” an der New Yorker Börse beginnt 1929 die Weltwirtschaftskrise mit der Folge einer ungeheuren Inflation in ganz Europa und ca. 30% Arbeitslosen und Ausgesteuerten in Deutschland und in Österreich. Zwischen 1929 und 1937 begehen allein in Wien 27.000 Menschen Selbstmord, weil ihnen ihre Lage unerträglich und ausweglos erscheint. Hoffnung für viele und die breite Masse ist der Kommunismus, ist auch die Sozialdemokratie, ist die nationale Bewegung, die 1934 in Österreich zur Diktatur, zum Bürgerkrieg, zum Ständestaat führt. Und vor allem die erstarkende die Nationalsozialistische Partei, die 1932 in Deutschland stimmenstärkste Partei wird, 1933 an die Macht kommt und mit Zustimmung des Reichstages zum ,,Ermächtigungsgesetz” die Parteidiktatur der NSDAP mit ihren Organisationen einführt. 1938 kommt es zum Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich, unter dem frenetischen Jubel der Mehrheit der Österreicher. Darauf folgen sogleich die planmäßigen Verhaftungen und Deportationen in die Konzentrationslager, folgt die systematischen Judenverfolgung, folgt die Ermordungen der Juden sowie der Roma und Sinti und anderer Menschen im Holocaust. Insgesamt eine Ausrottung und Auslöschung von über sechs Millionen Menschenleben, was heute noch viele Zeitgenossen leugnen. Der Neonazismus erblüht zu neuem Leben. Und wird noch da und dort geschützt.
Zurück zu Brainin! Am 1. Juli 1938 verläßt Fritz Brainin, zum Exil gezwungen um den Preis, am Leben zu bleiben, seine Vaterstadt Wien, sein Heimatland Österreich, das aufgehört hatte, für ihn und für viele noch Heimat zu sein. Damit endete nicht nur ein Lebensabschnitt für ihn und seine so hoffnungsvoll begonnene literarische Karriere. Im Jahr 1929 war sein erster Gedichtband „Alltag“ erschienen, dem 1934 noch sein Gedichtband „Die eherne Lyra“ ,folgte, was seinen Namen nicht nur in literarischen Kreisen, sondern durch die Veröffentlichung seiner Gedichte in der Arbeiterzeitung auch einem breiteren Publikum bekannt machte, sodaß er 1936 seinen ersten und einzigen Literaturpreis, den „Julius-Reich-Preis“, zugesprochen erhielt. Die Emigration ins Exil war für ihn der Beginn eines zweiten Lebens, einer anderen Existenz, die – ein halbes Jahrhundert dauernd – mit seinem ersten Leben in Wien nichts mehr gemeinsam hatte, ihn von seinem eigenen Ursprung und auch von seiner ersten und eigentlichen Literatursprache für ein ganzes weiteres Leben trennte.
In dieser zwanghaften Vertreibung, in dieser erzwungenen Emigration, in diesem Begreifen des plötzlich Ausgesetzseins, des Vogelfreiseins, des Andersseins, des Nicht-mehr-Dazugehörens, des Mit-dem-Tode-Bedrohtseins, liegt der ganze gewaltige Schock, das Trauma seines Lebens, von dem er stigmatisiert wird und stigmatisiert bleibt, sein Leben lang. Sein weiteres literarisches Schaffen – in der ersten Zeit der Emigration schreibt er noch in seiner Muttersprache Deutsch, später, als aus der als vorübergehend gedachten Emigration längst ein lebenslanges Exil geworden war, schreibt er in Anglo-Amerikanisch – und die Sprache der Literatur erweisen sich nicht als die therapeutisch geeigneten Instrumente, diesem schweren Trauma beizukommen, es mit Hilfe der Literatur zu überwinden. Je länger die Emigration, das Exil dauert, insbesondere nach 1945, da vielleicht eine Rückkehr nach Österreich wieder möglich gewesen wäre, ihm aber nicht mehr möglich war oder möglich schien, ihm wie so vielen anderen Exilanten auch nicht möglich gemacht wurde, umso tiefer versinkt er in dieses Trauma, immer mehr wird er sein eigener Gefangener, immer mehr – und dies in ,,Schüben” – erfolgt eine Deformierung und Destabilisierung seiner psychischen Existenz, was sich auch in seinem literarischen Schaffen abzeichnet. Immer größer und bedrohlicher wird die Brüchigkeit seiner inneren Lebensgrundlage, immer deutlicher und schmerzhafter, auch für ihn spürbar, ablesbar wiederum am Stil und Sprachgestus seiner Gedichte. Der äußere Zwang erzeugt inneren Zwang, Beklemmung. Zwangsreime und Klammernsetzung sind Zeichen dafür, nicht für einen literarischen Manierismus. Aus Brainin und seinen Gedichten spricht das Gefühl in der Sprache des Vertriebenen, des Entwurzelten, des Ausgestoßenen, des Heimatlosen, des Verbannten; eben genau die Sprache des Exils. Sich selbst als physische Person vermochte er zu retten, seine ursprüngliche Sprache nicht.
Weitere Stationen seines Lebensweges: Von 1939 bis 1942 arbeitet er als Kabelbote bei verschiedenen deutsch-amerikanischen Zeitungen. 1943 wird er zum amerikanischen Militär eingezogen, bewacht österreichische Kriegsgefangene. Eine schwere Krankheit, welcher Art geht aus keinen Aufzeichnungen hervor, bringt eine neue Krise, einen neuen „Schub” an psychischer Destabilisation; bedingt sein Ausscheiden aus der Armee 1945. Die ersten Nachkriegsjahre verbringt er im Kiegsveteranen-Krankenhaus im New Yorker Stadtteil Bronx. 1949 heiratet er die gebürtige Russin Florence Priluk, 1959 kommt ihr Sohn Perry Isak zur Welt. Die Familie übersiedelt im gleichen Jahr in einen New Yorker Gemeindebau für Kriegsverletzte, Brainin arbeitet in den nächsten Jahrzehnten als Patentübersetzer im technischen Bereich und als Redakteur. Gleichzeitig schreibt er Gedichte und Prosa in englischer bzw. amerikanischer Sprache, übernimmt mit der neuen Sprache, die er als nunmehrige zweite Literatursprache für sich adaptiert, auch deren Sprachduktus und Sprachgestus, was sich später, als er wieder zum Deutschen als Literatursprache zurückkehrt, in einer Anhäufung von Amerikanismen und gängigen Kürzeln niederschlägt, ein literarisches Sprachgebilde erzeugt, das oft so sehr verklausuliert und mit Chiffren durchsetzt ist, daß der verschlüsselte Sinn und die Bedeutung oft nur mehr ,,Eingeweihten” zugänglich ist. Fast so etwas wie eine reine Ich-Sprache, eine geheime Tagebuchsprache entsteht: die Exilsprache Frederick Brainins. Eine neue literarische Gattung, eine neue ,spezifische Form innerhalb der Lyrik scheint entstanden zu sein, eine die mit anderen Kriterien der Ästhetik und Formalkritik behandelt werden muß, als man sonst gewohnt ist und dies tut, und die sonst üblich sind in der Wissenschaftsmethode der Germanistik. Um die Literatur Frederick Brainins verstehen, beurteilen und bewerten zu können, muß man sein Leben, seinen Lebensbruch, sein Bruchleben verstehen, es richtig einordnen, auch wertschätzen, wenn man es würdigen will.
Äußerlich scheint in diesen dreißig Jahren, von 1950 bis 1980, alles soweit in Ordnung zu sein, soweit man mit solchen Beurteilungsbegriffen überhaupt operieren kann und darf. Ein zweites Leben scheint über das erste drübergelegt zu sein, es zu überdecken, die Wunden zu Verschleißen. So etwas wie eine künstlich-technische Stabilisierung scheint dem Leben Brainins Halt zu geben, es zu umschließen, vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren.
Bis der nächste große, schwere Schock kommt: Durch einen tragischen persönlichen Schicksalsschlag. Am 3.6.1981 wird sein Sohn Perry Isak von einem ,,faschistisch angehauchten” (Thunecke) Puertorikaner, der Hitlers „Mein Kampf“ in einer Übersetzung ins Amerikanische gelesen hatte (Konstantin Kaiser), in seinem Studio in Brookly ermordet. Die Folge: Brainins Frau wird wahnsinnig, wird als unheilbar krank in eine Heilanstalt eingeliefert, verbleibt für immer dort. Das ist der dritte große Schock, nach dem ersten der Zwangsvertreibung aus Wien und dem zweiten nach seiner schweren Erkrankung, den er erleidet und der ihn wahrscheinlich an einer Rückkehr nach Österreich gehindert hat, sodaß er ein Exilant auf Lebenszeit geworden ist. Jetzt bricht auch die mühsam aufgebaute zweite Welt zusammen. Brainin ist wieder ein Zurückgebliebener, ein Ausgesetzter, zum zweiten Mal ein Heimatloser. So etwas wie ein inneres Exil beginnt für ihn. Er zieht sich zurück, in ein kleines Jungesellen-Apartment im 18. Stock eines modernen Hochhauses in New York (Thunecke). Er wird isoliert, isoliert sich selbst und vereinsamt.
Seine Gedichte, die er nun wieder in Deutsch schreibt oder die er aus dem Amerikanischen rückübersetzt, weisen jetzt nicht nur zwei verschiedene Sprachebenen auf, sondern auch zwei divergente Mitteilungsebenen. Immer wieder geschieht es, daß er neben der im Gedicht publizierten „offiziellen Mitteilung“, nun in Klammern gesetzt und angefügt, noch ,,private” Anmerkungen dazugibt, ganz als wolle er irgendeinem Vertrauten, dem einzigen, den er noch hat, nämlich sich selber, oder einem unbekannten Leser, das geschilderte Geschehen auf einer ganz persönlicher Basis erläutern. Die Ich-Identität des Autors bricht auseinander in zwei verschiedene Worte-Verwender und Sprecher. Der Zweite interpretiert – und ironisierend, oft aus einem Gefühl der Bitterkeit heraus, ja der Verbitterung, und aus einer Haltung zwanghafter Vertraulichkeit die Aussage des literarischen Autors durch eine persönliche Aussage des privaten Ichs. Die künstliche, oft krampfhaft wirkende Distanz zum Geschehen und seiner Schilderung, die in den vorherigen Zeilen vom literarischen Ich des Autors aufgebaut werden, wird wie in einem verzweifelten und somit aussichtslosen Versuch des persönlichen Ichs des Autors zu einem letzten personalen Mitteilungsgespräch wieder aufgehoben und eliminiert. Die Brücke vom Ich zum Du, auch die im Gedicht, ist nicht mehr tragfähig, nicht mehr wirklich begehbar; das spürt auch Brainin.
,,Doch einmal im Herbstlicht (ihr Kinder werdet schon sehn!)
wann ihr stoppt für einen Alten wie mich,
da steh ich wartend (ihr drosselt und hupt zehn
Mal!) auf Godot wie ein dummes Viech,
das nichts von Geheimnis-Labors braucht zu verstehn:
Er stoppt, GANZ STOPP, bei der Verkehrskleeblatt-Kurv,
für mich allein, seinen Passagier….
Das Gridlock senkrecht hinauf durchbricht er für mich!
Er lächelt, und meint meinen Zeitmaschinen-Entwurf,
wir fliegen nach Viennas Hauptquartier.”
(VIENTIANE, LAOS; Vienna, Virginia, 2, S.110)
Im Herbst 1988 kommt Brainin wieder nach Wien, nur zu Besuch, um an der Zusammenstellung des Manuskriptes für sein nun vorliegendes Buch „Das siebte Wien“ zu arbeiten.
Was ist das für ein Wien, was ist das für ein Österreich, in das er, wenn auch nur für kurze Zeit, zurückkehrt? Welche Erfahrungen macht er hier, wie schlagen sie sich, wenn überhaupt, literarisch nieder? Wie wissen es nicht.
Im Herbst des gleichen Jahres, als er hier weilt, gibt es einen Vorfall, der keinen Aufschrei der breiten österreichischen Öffentlichkeit hervorruft, sondern nur zum Rücktritt des betreffenden, aber nicht betroffenen Parteifunktionärs als Parteisekretär der ehemals christlich-sozialen Partei führt. Dieser Politiker, ein Rechtsanwalt und Parlamentsabgeordneter zieht die Grenzen für politische und moralische Verantwortung im Zusammenhang mit dem Holocaust und dem damaligen Wehrmachtsoffizier und späteren Bundespräsidenten der Republik Österreich, Dr. Kurt Waldheim, etwa folgendermaßen: „Solange jemand nicht mit eigenen Händen sechs Juden erwürgt hat, kann man nicht von persönlicher Schuld sprechen.” Das also ist es! Das ist die Lehre, die aus der Geschichte, um es so wertfrei und distanziert zu formulieren, in Österreich gezogen wurde und wird. Das ist das Ergebnis der nicht geleisteten ,,Trauerarbeit“, von deren Verpflichtung und Notwendigkeit -von Sühne sei ohnedies nicht gesprochen – ein in Österreich sehr bekannter Starkolumnist einer in jeder Hinsicht kleinformatigen Zeitung als einem unzumutbaren ,,Aberwitz” und ,,Hirngespinst” spricht. Und von einem ,,sogenannten Bedenkjahr” im Jahre 1988 als einer – den erweiterten Bedeutungsradius im Wienerischen miteinbezogen – ,,absoluten Unnötigkeit”.
Ein weiterer Schock wird das für den amerikanischen Staatsbürger, den ehemaligen Wiener, den Wiener Juden, nicht mehr gewesen sein. Eine solche Haltung ist hier bereits wieder etwas Alltägliches, gehört zum politischen und gesellschaftlichen Alltag, wird protestlos akzeptiert.
Mit Erschütterung jedoch entnehme ich, daß in der vorliegenden Endfassung des druckreifen Manuskriptes bei den biographischen Angaben über Fritz/Frederick Brainin entgegen der vorherigen Fassung der Passus „geboren als Sohn jüdischer Eltern” – wahrscheinlich auf Anordnung des Autors – gestrichen ist. Womit der letzte Faden zum ersten Wien durchgeschnitten, die letzte Spur zum ureigensten Ich von diesem Ich selbst zerstört worden ist. Es ist der letzte Versuch dieses Menschen, sein zweites Leben anzunehmen, auch um den letzten Preis der Verleugnung seiner Herkunft, seiner Identität. Ein Verzweiflungsakt, eine Art psychischen Suizid. Es ist die letzte Äußerung, die letzte Handlung des Exilanten. Es ist das Opfer eines Opfers. Es ist die Sprache des Exils. Diese mündet – in einem Akt des Verschweigens – nun endgültig ins Schweigen.
PS: Während der Zeit, da ich an diesem Essay schreibe, fahre einmal ich in einer Nachdenkpause mit dem Fahrrad zum Geburtshaus Brainins in der Lessinggasse Nummer 8 in der Leopoldstadt (2. Wiener Bezirk). Ich trete vor das Haus, hinein kann ich nicht, das Haus ist verschlossen. Ich sehe an der linken Ecke des Hauses im Parterre ein vergilbtes, vielleicht mit einem Messer oder einer Rasierklinge in der Form eines Judensternes zerschnittenes Plakat, vermutlich vor langer Zeit, zur Zeit des Wahlkampfes, der mit der Wahl des früheren Deutschen Wehrmachtsoffiziers und späteren UNO-Generalsekretärs Dr. Kurt Waldheim zum Bundespräsidenten der Republik Österreich endete, von einer linken Organisation achiffiert. Die Headline des Plakates lautet: „Das hat Österreich nicht nötig!” Darunter angeführt sind die persönlichen Bekenntnisaussprüche des österreichischen Gerichtspsychiaters, des Arztes und ehemaligen Parlamentariers Dr. Scrinzi, des früheren SA-Sturmbannführers, den die NDP (Nationaldemokratische Partei) als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl unserer Republik Österreich aufgestellt hatte, unterstützt von vielen öste
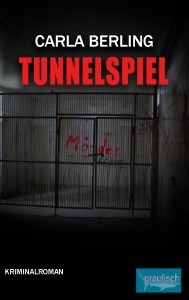 Ein grausiger Mord. In einem verfallenen Schlachthof wird ein nackter Toter angekettet aufgefunden. An seinen Klöten baumeln Christbaumkugeln.
Ein grausiger Mord. In einem verfallenen Schlachthof wird ein nackter Toter angekettet aufgefunden. An seinen Klöten baumeln Christbaumkugeln.