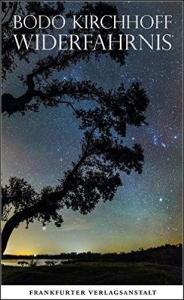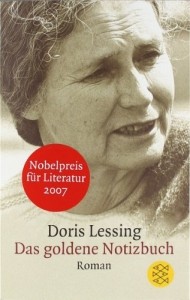
Existenzerhellung nach Karl Jaspers
Spät wurde der dieser Tage verstorbenen, englischen Schriftstellerin Doris Lessing im Jahre 2007 der Nobelpreis zuerkannt, «der Epikerin weiblicher Erfahrung, die sich mit Skepsis, Leidenschaft und visionärer Kraft eine zersplitterte Zivilisation zur Prüfung vorgenommen» habe, wie das Komitee etwas gestelzt formuliert hat. Und wie so oft gab es auch hier Stimmen, die sich skeptisch geäußert haben, Marcel Reich-Ranicki gehörte dazu. Ihr literaturwissenschaftlich als Hauptwerk angesehener Roman «Das goldene Notizbuch» erschien 1962, in Deutschland dann erst 1978, ein Klassiker des Feminismus, wie behauptet wird. Lessing hat sich vehement gegen dieses Etikett gewehrt, schon im Vorwort von 1971 schreibt sie, sie wolle sich nicht feministisch vereinnahmen lassen.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Anna, eine erfolgreiche, politisch engagierte, intellektuelle und emanzipierte Schriftstellerin (sic!) mit temporärer Schreibblockade. Sie ist geschieden, hat eine schulpflichtige Tochter, ist alleinerziehend, zeitweise Mitglied der Kommunistischen Partei, versteht sich als «Ungebundene Frau», und so lauten denn auch die Überschriften der fünf Hauptkapitel, die in vier ebenfalls gleichnamige Unterkapitel gegliedert sind, betitelt das rote, schwarze, gelbe und blaue Notizbuch. Im Roten schreibt sie über ihr politisches Leben, das in Afrika begann, und über ihre allmähliche Desillusionierung, was den Kommunismus anbelangt. Das Blaue ist mehr ein Tagebuch, dort hält sie ihre Gefühle fest, es dient aber auch als literarische Stoffsammlung, im Gelben sind vorläufige Texte und Geschichten enthalten, im Schwarzen finden sich eher praktische, alltägliche Notizen, alles das aber ziemlich überlappend, also nicht immer streng abgegrenzt, wie sie selbst anmerkt. Diese Protagonistin erlebt allerlei Abstürze, nicht nur was ihre Schriftstellerei anbelangt, sondern auch bei ihrem politischen Engagement, vor allem aber in ihren problematischen Beziehungen zu Männern. Wobei schnell klar wird, dass alle diese persönlichen Debakel zusammenhängen, sich sogar gegenseitig bedingen.
Man kann von Geschlechterkampf sprechen, der da stattfindet in diesem Roman, die Gleichberechtigung, die Emanzipation der Frau ist sein Generalthema. «Ungebundene Frauen» aber, der neue weibliche Typus, wie Lessing ihn nennt, scheitern darin grandios, sind aber unverdrossen immer wieder erneut auf der Suche nach einem beständigen Partner, nach wahrer Liebe. Sie finden stattdessen Liebhaber auf Zeit, schnellen Sex mit verheirateten Männern, sie müssen immer wieder erkennen, dass sie, anders als die Männer, nicht in der Lage sind, Liebe und Sexualität zu trennen. Beide Geschlechter, Frauen wie Männer, wirken nicht gerade glücklich bei diesem Spiel, Lösungen für deren Probleme bietet die Autorin jedoch nicht, – wie denn auch, die gibt es ja selbst heute noch nicht, nicht mal ansatzweise! Nur der berühmte erste Satz – hier lautet er «Die beiden Frauen waren allein in ihrer Londoner Wohnung.» – eröffnet zum Schluss hin, im Kapitel «Das goldene Notizbuch», einen kleinen Lichtblick.
Doris Lessing erzählt ihre Geschichte strikt aus weiblicher Perspektive, ist dabei aber absolut fair und unparteilich. Sie entwickelt in ihrem voluminösen Roman ein facettenreiches Szenario der archetypischen Mann/Frau-Problematik, wie es in der Weltliteratur ohne Beispiel ist. Ihr Text ist sprachlich auf hohem Niveau, aber unkompliziert, leicht lesbar mit einfacher Syntax, ohne sprachliche Mätzchen. Der Roman ist in Teilen unübersehbar autobiografisch, über das Fiktionale hinaus aber sicher auch oft dokumentarisch – und damit den Horizont erweiternd. Schon vom Umfang her setzt der Roman die Bereitschaft beim Leser voraus, sich dem komplexen Thema geduldig zu stellen, sich in die virtuos erzählte Geschichte zu vertiefen und deren Aussagen intensiv auf sich wirken zu lassen. Das Ergebnis dieser Lektüre dürfte dann eine «Existenzerhellung» sein, ganz im Sinne von Karl Jaspers.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
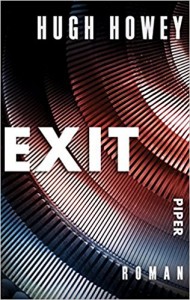 Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass das Schicksal aller in deinen Händen liegt? Juliette Nichols, die neue Herrin in Silo 18, bricht mit den jahrhundertealten Regeln der unterirdischen Gemeinschaft – und lässt den riesigen Bohrer demontieren, um ihn für einen neuen Zweck einzusetzen. Denn Juliette weiß, dass ihr Freund Lucas und die anderen sterben werden, wenn sie nicht sofort handelt. Doch sie weiß nicht, dass ihr die größte Überraschung noch bevorsteht…
Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass das Schicksal aller in deinen Händen liegt? Juliette Nichols, die neue Herrin in Silo 18, bricht mit den jahrhundertealten Regeln der unterirdischen Gemeinschaft – und lässt den riesigen Bohrer demontieren, um ihn für einen neuen Zweck einzusetzen. Denn Juliette weiß, dass ihr Freund Lucas und die anderen sterben werden, wenn sie nicht sofort handelt. Doch sie weiß nicht, dass ihr die größte Überraschung noch bevorsteht…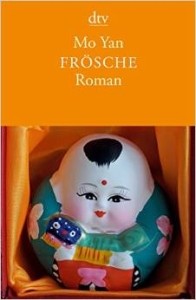 Halluzinatorischer Realismus
Halluzinatorischer Realismus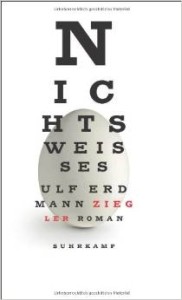 Dingbat
Dingbat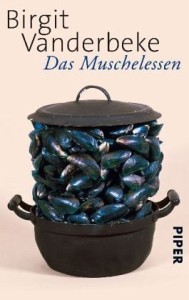 Demontage einer verlogenen Idylle
Demontage einer verlogenen Idylle
 Wenn die Kinder aus dem Haus sind
Wenn die Kinder aus dem Haus sind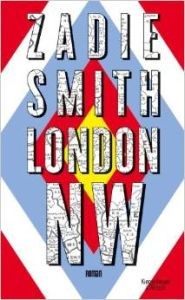 Bewundert und ungeliebt
Bewundert und ungeliebt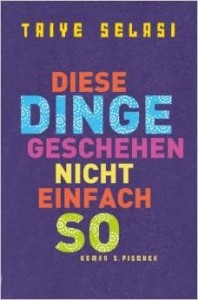 Quantität versus Qualität
Quantität versus Qualität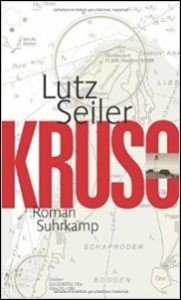 Magischer Realismus
Magischer Realismus Wahrlich nichts Neues
Wahrlich nichts Neues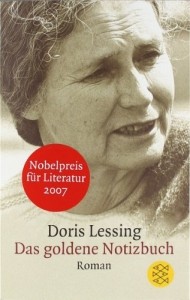
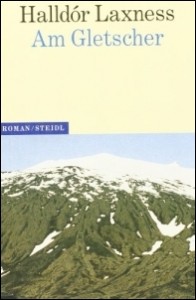 Deshalb lesen wir doch Romane
Deshalb lesen wir doch Romane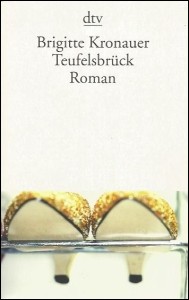 Im Prinzip Ja
Im Prinzip Ja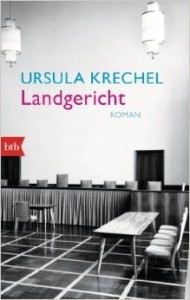 Auch posthum eine tragische Gestalt
Auch posthum eine tragische Gestalt