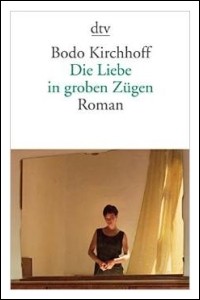 Nichts für faule Leser
Nichts für faule Leser
Ein schwieriges Unterfangen, auf das sich Bodo Kirchhoff mit seinem gewichtigen Roman eingelassen hat, der Titel schon eine Untertreibung. Denn nicht in groben Zügen wird hier über die Liebe erzählt, das ewige Thema wird vielmehr in vielen Facetten sehr detailliert beschrieben, in unserer Zeit spielend, alles hochaktuell. Aber nicht nur die Liebe ist ein Thema, auch unsere Nöte mit dem Altwerden sind scharfsichtig geschildert, und das Sterben einer noch jungen, krebskranken Frau schließlich ist hier so eindringlich dargestellt, wie ich es noch nie erlebt habe in einem Buch. Der Autor ist ein sprachgewaltiger Erzähler, der manch Autobiografisches verarbeitet hat und dem man gerne folgt durch seine lange, ausführlich geschilderte Geschichte, denn der Weg ist das Ziel, und dieser Weg ist einfach immer wieder schön.
Protagonisten sind ein Ehepaar mittleren Alters mit erwachsener Tochter, beide beim Fernsehen tätig, durchaus wohl situiert mit großer Altbauwohnung in Frankfurt am Main, Haus am Gardasee, mit eigenem Boot natürlich, und auch der Jaguar V8 darf nicht fehlen. Man lebt also gut, immer nach dem Motto: Was lacostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. Renz, einige Jahre älter als seine Frau, hat öfter Affären, und Vila ist auch kein Kind von Traurigkeit. Aber man findet sich immer wieder, hat sich fugenlos angepasst an den Partner, lebt fast schon symbiotisch miteinander. Bis beide einen Jüngeren kennenlernen, er eine agile Kollegin vom Fernsehen, sie einen vergeistigten ehemaligen Lehrer, der ein Buch über Franz von Assisi schreibt.
Der historische Stoff über Franz, ganz aktuell durch den neugewählten Papst, der bekanntlich dessen Namen angenommen hat, und die heilige Klara, 1958 von Papst Pius XII zur Schutzpatronin des Fernsehens (sic!) erklärt, dieser Stoff also bildet einen zweiten Handlungsstrang, der einen unüberbietbaren Gegensatz darstellt zu den Helden unseres Alltags. Köstlich zu lesen ist dazu Kirchhoffs beißende Gesellschaftskritik, Talkshow-Politiker, die gegen ihr fieses Gesicht anreden, ein Ministerpräsident und späterer Bundespräsident mit Schulsprecherhabitus, das absurde Völkchen der Fitnessstudios mit Porsche und Pulsmesser, und vieles andere mehr.
Das alles aber nur am Rande. Dieser Roman beleuchtet nüchtern, sachlich, klug und detailreich, aber auch feinfühlig und unterhaltsam die Liebe von den frühen Stadien der prickelnden Verliebtheit bis zur abgeklärten, wohligen Gemeinsamkeit zweier Partner, deren verborgene Bindungskräfte immer wieder obsiegen, allen Versuchungen zum Trotz. Die ewige Jagd nach dem berauschenden Liebesglück mit dem dazugehörigen tollen Sex, in unserer nimmersatten Gesellschaft kräftig angeheizt von den Medien, wird behutsam zwar, aber unerbittlich und zwingend als letztendlich unhaltbare Illusion vorgeführt. Jüngere werden das womöglich nicht akzeptieren wollen, Ältere werden eher verständnisvoll nicken, sich tatsächlich wiederfinden in dieser Beschreibung. Allen aber sei gesagt, dieser ausschweifende Gegenwartsroman ist nichts für faule Leser, eher für geschichtensüchtige Genießer.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
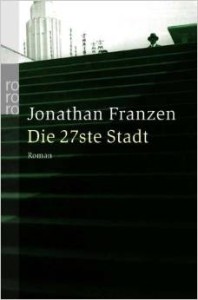 Die uninteressante Natur war uninteressant
Die uninteressante Natur war uninteressant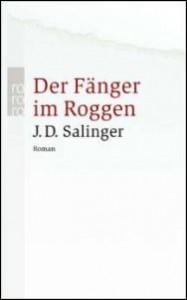 Null Bock
Null Bock Eine fragwürdige Konditionierung
Eine fragwürdige Konditionierung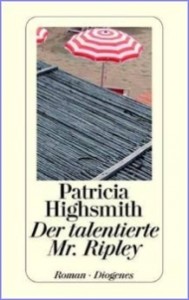 Wenn das Böse obsiegt
Wenn das Böse obsiegt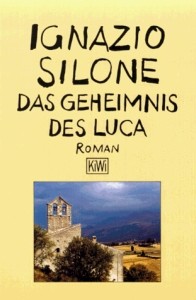 Vierzig Jahre Schweigen
Vierzig Jahre Schweigen Ein Roman mit Zugabe
Ein Roman mit Zugabe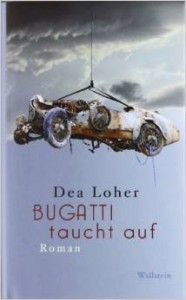 Lektüre mit Bonus
Lektüre mit Bonus Gestern wird sein, was morgen gewesen ist.
Gestern wird sein, was morgen gewesen ist.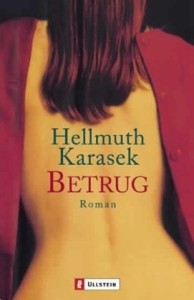 Così fan tutte
Così fan tutte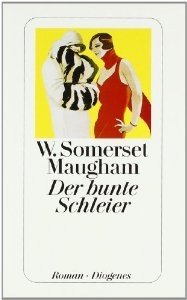 In der ersten Reihe zweitklassiger Autoren?
In der ersten Reihe zweitklassiger Autoren?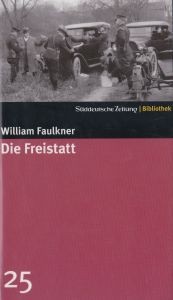 Ein sperriges Prosawerk
Ein sperriges Prosawerk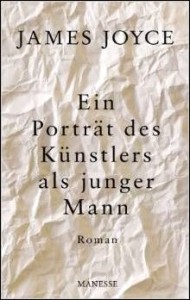 Per aspera ad astra
Per aspera ad astra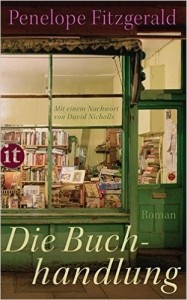 Ein Lehrstück über das Scheitern
Ein Lehrstück über das Scheitern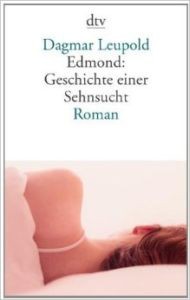 Eine Nabelschau
Eine Nabelschau