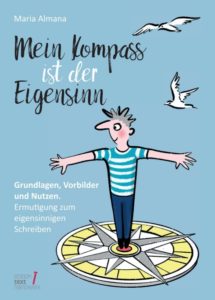 Eigensinn – was ist das eigentlich, fragt Autorin Maria Almana. Gelegentlich hören wir von eigensinnigen Kindern, auch eigensinnige Jugendliche sind vor allem in der Pubertät keine Seltenheit. Der »Trotzkopf« galt lange als Standardbegriff für aufbegehrende junge Menschen, die erst geformt und dann gebrochen werden sollten. Erwachsene, die eigensinnig sind, werden hingegen weit seltener erwähnt. In der Altersgruppe der Senioren spricht man dann wohl eher abwertend von »seltsam« oder »verschroben«. Weiterlesen
Eigensinn – was ist das eigentlich, fragt Autorin Maria Almana. Gelegentlich hören wir von eigensinnigen Kindern, auch eigensinnige Jugendliche sind vor allem in der Pubertät keine Seltenheit. Der »Trotzkopf« galt lange als Standardbegriff für aufbegehrende junge Menschen, die erst geformt und dann gebrochen werden sollten. Erwachsene, die eigensinnig sind, werden hingegen weit seltener erwähnt. In der Altersgruppe der Senioren spricht man dann wohl eher abwertend von »seltsam« oder »verschroben«. Weiterlesen
Archiv
Mein Kompass ist der Eigensinn
100 Jahre Bukowski: Short Stories

100 Jahre Bukowski
100 Jahre Bukowski. Der Meister der Kurzgeschichte wäre dieses Jahr, am 16. August, 100 Jahre alt geworden. Warum er es nicht schaffte, erzählen u.a. seine hier vorliegenden Short Stories, die in den Siebziger Jahren auch in Deutschland veröffentlicht wurden. Die beiden hier vorliegenden Bukowski Short Story Sammlungen „Pittsburgh Phil & Co. Stories vom verschütteten Leben“ und „Ein Profi. Stories vom verschütteten Leben“ erschienen 1973 erstmals im amerikanischen Original unter dem Titel „South of North“ bei Black Sparrow Press. 1977 wurden sie auf Deutsch bei Zweitausendeins als „Das ausbruchsichere Paradies. Stories vom verschütteten Leben“ veröffentlicht. Der Deutsche Taschenbuchverlag dtv hat 1983 die Zweiteilung vorgenommen, die bis zur 18. Auflage 2016 beibehalten wurde.
Bukowski und die Frau des Lebens
„Finanziell gesehen war man mit einer Möse eindeutig besser dran als mit einem Schwanz. Um das zu verdienen, was sie ihn zehn Minuten anschaffte, mußte ich einen ganzen Tag arbeiten und noch einige Überstunden dranhängen.“ (In. Zwei Trinker) Schon in der ersten Story, „Die Stripperinnen von Burbank“, macht Bukowski klar wo der Hammer hängt. Acht Stunden lang schlägt er auf einen Konkurrenten ein, bis auch er begreift, dass „wenn man acht oder neun Stunden lang aufeinander eingeschlagen hat“, sich ein ganz „eigenartiges Gefühl der Verbundenheit“ entwickelt. Zumal es eigentlich um gar nichts geht, denn wer verliebt sich schon in eine Stripperin, die Rosalie heißt? Bukowski macht sich Gedanken über das Zusammeleben mit Frauen oder beschreibt den Größenwahnsinn des Halbschwergewichtlers Jack, der nach seinen Kämpfen trinkt und raucht, obwohl seine Ann ihn belehrt, es nicht zu tun. Zumeist hat sich ohnehin alles gegen seine Protagonisten verschworen: „Frauen, Jobs, keine Jobs, das Wetter, die Hunde“. In „Das ausbruchsichere Paradies“ hält eine Frau, Dawn, sich vier Homuncoli, die sie auf einem Bartresen kopulieren lässt, wovon sie selbst so angetörnt wird, dass sie mit der Barbekanntschaft, dem Erzähler, mit nach Hause nimmt. In „Liebe für 17,50“ wendet sich Robert von seiner Flamme Brenda ab und verliebt sich in eine Schaufensterpuppe, Stella, die er einem alten Juden abluchst und in seine Bude mitnimmt. „Eine gute Frau, das ist das Größte auf der Welt“, lässte er einen seiner Protagonisten sagen. Aber wo soll Henry Chinaski so eine finden?
Im Ring mit Hemingway

100 Jahre Bukowski
Egal in welche Rolle Charles Bukowski schlüpft, es sind immer sympathische Verlierer, die er beschreibt und die sein Herz erwärmen, denn er hält nichts von dem „gutrasierten Boy mit der Krawatte und dem guten Job“, wie er in „Mumm“ freimütig bekennt. In dem zweiten Band „Ein Profi. Stories vom verschütteten Leben“ befreit er den leibhaftigen Teufel aus einem Käfig, bis er merkt, dass dieser ihm seine Frau ausspannt. Aber Chinaski schlägt selbst dem Teufel ein Schnippchen. „Ich interessiere mich mehr für Perverse als für Heilige“, schreibt er, „Ich kann relaxen in Gesellschaft von Pennern, denn ich bin selber einer. Ich habe nichts übrig für Gesetze, Moral, Religion, Vorschriften. Ich mag mich nicht von der Gesellschaft trimmen lassen.“ Mit Worten wie diesen machte Charles Bukowski sich in den Siebzigern zum Anti-Helden einer ganzen Generation. Er erzählt von seinen Lesereisen und was Dylan Thomas umgebracht hat. Oder steigt mit Ernest Hemingway in den Ring. Innerhalb eines Absatzes schreibt er sich vom Grashüpfer zum unbestrittenen King, um dann wieder in Selbstmordgedanken zu versinken. Oft geht er mit dem Gefühl ins Bett, das alle Säufer kennen, schreibt er an einer Stelle: „Ich hatte mich lächerlich gemacht, aber zum Teufel damit.“
Charles Bukowski
Pittsburgh Phil und Co. Stories vom verschütteten Leben
Zusammengestellt und ins Deutsche übertragen von Carl Weissner
ISBN: 978-3-423-12391-4
dtv
7,90 EURO
Charles Bukowski, Carl Weissner (Hrsg.)
Ein Profi. Stories vom verschütteten Leben
Zusammengestellt und ins Deutsche übertragen von Carl Weissner
ISBN: 978-3-423-10188-2
dtv
8,90 EURO
Wien zum Verweilen
 „Zum Verweilen“ ist eine neue Reihe beim Reclam Verlag die es in den Formaten „Notes“ – zum eigenen Aufschreiben, „Magnet“ und als Buch mit Textnachweisen gibt. Dieses neue Format ist bisher zu den Städten Wien, Berlin und Hamburg in allen drei Varianten erschienen.
„Zum Verweilen“ ist eine neue Reihe beim Reclam Verlag die es in den Formaten „Notes“ – zum eigenen Aufschreiben, „Magnet“ und als Buch mit Textnachweisen gibt. Dieses neue Format ist bisher zu den Städten Wien, Berlin und Hamburg in allen drei Varianten erschienen.
Original oder ursprünglich: Sachertorte?
Der deutsche Reisejournalist Ralf Nestmeyer widmet sich in der „Wien zum Verweilen“ Variante dem literarischen Wien. Gemeinsam mit Dichterinnen und Denkern strawanzt er durch die Straßen Wiens und sieht alles Dargebotene mit deren und eigenen Augen. So besichtigt er etwa mit Stefan Zweig das Wiener Konzerthaus, mit Ingeborg Bachmann das Ungargassenland (der 3. Bezirk) und Ralf mit Friedrich Torberg geht er gar auf eine Sachertorte ins Sacher. Damals wurde sich noch so zubereitet, wie man sie heute nur noch im Demel bekommt. Denn die Marmeladenschicht war nicht in der Mitte angebracht, sondern nur am Rand. Dennoch ist die Sacher aus dem Sacher die „Original-Sachertorte“, wie unlängst ein Gerichtsurteil (II. Instanz) amtlich feststellte. Dennoch ist die eigentlich originale Sachertorte heute als „Sachertorte“ nur im Demel zu verköstigen, wie Nestmeyer recherchierte.
Orignal und ursprünglich: Wien
Aber ursprünglich und original ist in Wien halt nicht dasselbe, wie auch viele der folgenden von Ralf Nestmeyer zusammengetragenen Geschichten beweisen. Einer kurzen Einführung zum jeweiligen Thema durch Nestmeyer stellt der Herausgeber eine Textstelle eines berühmten Autors hintan. So erfährt der Leser u.a. über Graham Greenes in der Kanalisation Wiens versteckten dritten Mann, Klaus Manns Wendepunkt im Hotel Bristol oder auch Robert Seethalers Freud-Hommage im „Trafikant“. Dem „längsten“ Bauwerk Wiens, dem Karl Marx Hof wird durch eine Textpassage aus Claudio Magris’ Donaubuch gewürdigt. Weitere Themen sind der Stephans- und Michaelerplatz in Wiens Mitte, der Zentralfriedhof am Rande der Stadt und natürlich der Prater, Wiens Lunge. Ein Textverzeichnis und Stadtpläne auf der Coverinnenseite haben die 17 beschriebenen Sehenswürdigkeiten miteingezeichnet. Ursprünglich hatte Wien ja nur einen Bezirk (die Innere Stadt), aber inzwischen gilt auch alles außerhalb der Stadtmauer als „Original“. Nicht nur die Sachertorte!
Ralf Nestmeyer
Wien zum Verweilen
Mit Geschichten die Stadt entdecken
Ill.: Reinke, Katinka
Klappenbroschur. Format 11,4 x 17 cm
112 S.
ISBN: 978-3-15-020566-2
Reclam Verlag
Der Schnee auf dem Kilimandscharo
 Schnee auf dem Kilimandscharo: „Karawong! Karawong! Karawong!“, kracht das Gewehr des Francis Macomber als er auf einen Löwen anlegt. Mit seiner Frau Margot hat er bei Robert Wilson eine Safari gebucht, die ihn verwandelt, aber auch beflügelt. Afrika ist eben kein Land für Feiglinge. Aber als er seine Angst verliert, verliert er auch seine Frau. Oder sein Leben.
Schnee auf dem Kilimandscharo: „Karawong! Karawong! Karawong!“, kracht das Gewehr des Francis Macomber als er auf einen Löwen anlegt. Mit seiner Frau Margot hat er bei Robert Wilson eine Safari gebucht, die ihn verwandelt, aber auch beflügelt. Afrika ist eben kein Land für Feiglinge. Aber als er seine Angst verliert, verliert er auch seine Frau. Oder sein Leben.
Der Schnee auf dem Kilimandscharo
In „Das kurze glückliche Leben des Francis Macomber“, der letzten Geschichte dieser Short Stories Sammlung von Ernest Hemingway, verachten sich alle drei Protagonisten gegenseitig. Margot ist nur mit Francis zusammen, weil er Geld hat und er mit ihr nur, weil sie schön ist. Robert wiederum verachtet beide, aber er bekommt Geld dafür, dass er sie auf wehrlose Tiere schießen lässt. Der Jäger als Prostituierte. Afrika als Wildpark für besitzende Weiße. Diese Zeiten sind lange vorbei, aber als Hemingway seine Geschichten schrieb, schien die Macht des weißen Mannes noch ungebrochen. Nicht nur in Afrika. Auch „Schnee auf dem Kilimandscharo“, der titelgebenden Story dieses Sammelbandes, spielt in Afrika, nahe dem Ngaje Ngai, Haus Gottes, wie die Masai den westlichen Gipfel des höchsten Berges Afrikas nennen. In dieser Geschichte geht es auch um ein Paar, diesmal ist sie die Reiche und er der Mittellose. Harry, der Schriftsteller, der sein eigenes Talent verrät, weil er die ganze Zeit trinkt, statt zu arbeiten. „Es gab so viel zu schreiben. (…) Er war dabei gewesen, und er hatte es beobachtet, und es war seine Pflicht, darüber zu schreiben; aber jetzt würde er das nie mehr tun.“ Kann seine Frau ihn noch retten?
Die Sorgen eines Boxers vor seinem letzten Kampf
Mr. Frazer, der Spieler in „Der Spieler, die Nonne und das Radio“, findet sein Opium in der Revolution: „Revolution ist eine Katharsis; eine Ekstase, die nur durch Tyrannei verlängert werden kann“. Nicholas Adams, der gleich in zwei Geschichten vorkommt, wiederum tingelt mit seinem Sohn durch Amerika und schießt auf Eichhörnchen und Wachteln. Er hatte bei den Ojibwa gelernt, aber sein Sohn will seinen Großvater besuchen. Auch in „Die Killer“ ist Nick Adams ein Protagonist, der eine unheilschwangere Botschaft an Ole Andersen überbringt. Und in „Wie Du niemals sein wirst“ dient Nick an der Front in Italien, auf dem Weg nach Fornaci. „Fünfzigtausend“ wettet der Boxer Jack Brennan in der gleichnamigen Story gegen sich selbst. Vor seinem letzten Kampf denkt er an seine Sorgen, seine Immobilien, seine Aktien, seine Kinder, seine Frau. 11 Runden hält er durch, bis sein Trainer ihm zuruft: „Jimmy, pass auf!“.
Ernest Hemingway schreibt über Paare, Soldaten, Boxer und Jäger. Aber auch über Frauen. Stets ist sein Ton distanziert und dennoch voller Einfühlungsvermögen. Denn er kennt auch die Gedanken seiner Protagonistinnen. Alle Stories in diesem Band: Schnee auf dem Kilimandscharo; Ein sauberes, gut beleuchtetes Café; Ein Tag Warten; Der Spieler, die Nonne und das Radio; Väter und Söhne; In einem anderen Land; Die Killer; Wie du niemals sein wirst; Fünfzigtausend; Das kurze glückliche Leben des Francis Macomber.
Schnee auf dem Kilimandscharo. Storys.
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
1939, 1950, 1977, 2015;
ISBN: 978 3 499 27286 8
Rowohlt Taschenbuch Verlag
Buenos Aires literarisch
 Buenos Aires. Eine literarische Einladung: Timo Berger hat für den vorliegenden literarischen Spaziergang Autorinnen und Autoren ausgewählt, die sämtlich in Buonos Aires geboren oder beheimatet sind. Für Wagenbach hat Timo Berger auch Anthologien zu argentinischer und brasilianischer Literatur herausgegeben. Die vorliegenden Ausschnitte aus längeren Texten stammen aber natürlich von jeweils anderen Übersetzern.
Buenos Aires. Eine literarische Einladung: Timo Berger hat für den vorliegenden literarischen Spaziergang Autorinnen und Autoren ausgewählt, die sämtlich in Buonos Aires geboren oder beheimatet sind. Für Wagenbach hat Timo Berger auch Anthologien zu argentinischer und brasilianischer Literatur herausgegeben. Die vorliegenden Ausschnitte aus längeren Texten stammen aber natürlich von jeweils anderen Übersetzern.
Die Stadt der Gegensätze
Buenos Aires das ist Tango, Fußball, die höchste Psychoanalytiker-Dichte der Welt und: …Cartoneros. Die Müllsammler von Buonos Aires fingen nach der Krise von 2001 damit an, Kartons und Papier zu sammeln und wurden bald zum bleibenden Symbol der krisengeschüttelten argentinischen Hauptstadt. Drei Millionen leben in ihr und 12 Millionen um sie herum. Denn die Viertel der Mittelschicht werden von den Marginalisierten in ihren Villas Miserias quasi umzingelt, wie Martín Caparrós in seinem Beitrag, „Die bedrückte Stadt“, schreibt. Auch der Himmel habe sich verdunkelt, denn eine Menge Kabel, durch die gestohlener Strom fließt, hängen über den Gassen der Elendsviertel. Die nach Fett riechende Luft, das Geschrei der Verkäufer und der Lärm der Cumbias und anderer in den Villas populärer Lieder erfreut aber alle „porteños“ – ob arm oder reich. Aber vielleicht gibt es ja bald Roboter. Nur wohin dann mit den Armen, frägt der Autor provokant?
Die Farben der Avenida Corrientes
Robert Arlt beschreibt eine lebendige Straße, die Corrientes, bei Nacht, „die Straße des Tangos, der Schwärmerei; Straße, an die sich bei Tagesanbruch bläulich färbt und dunkel wird, weil ihr Leben nur im künstlichen Methylenblau, Kupfersulfatgrün und Pikrinsäurengelb möglich ist“. Auch Gabriela Cabezón Cámara schwärmt von ihrem Viertel, kämpft sie als Hausbesetzerin doch für den Erhalt der alten Bausubstanz und die Schönheit des ursprünglichen Buenos Aires, das nicht umsonst übersetzt „gute Luft“ bedeutet. Ob es ein Fehler war, frägt sich wiederum Martín Kohan in seinem Beitrag mit dem Titel „Der Fehler“. Seine Geliebte verlässt ihn Richtung Uruguay mit einem Schiff, das in einer knappen Stunde Fahrzeit das andere Ufer erreicht. Der Protagonist leidet so sehr unter seiner Sehnsucht, dass er sich den Nordwind herbeisehnt, der selbst den Río de la Plata (den Fluss aus Silber) trocken legt. Aber was tun, wenn man mit den Füßen mitten im Schlamm des Flussbettes feststeckt und die Flut wieder zurückkommt?
Europa in Lateinamerika
Buenos Aires hat für alle etwas zu bieten. Europa und Lateinamerika treffen sich hier wie nirgends anders: Das Spanische klingt hier italienisch; englische, polnische oder deutsche Namen sind so häufig wie Empanada-Stände neben eleganten Kaffeehäusern und Art-déco-Gebäuden nach Wiener oder Pariser Vorbild. Wer die vorliegende „literarische Einladung annimmt“, erlebt eine lebhafte linke Protestkultur und frenetische Fußballfans, die bildschönen Buchhandlungen auf der Avenida Corrientes oder den Schelmenroman eines Hausmeisters und das intime Tagebuch eines Flaneurs.
Mit zahlreichen erstmals ins Deutsche übersetzten Texten von César Aira, Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Martín Caparrós, Julio Cortázar, Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero, Pola Oloixarac, Alan Pauls, Ricardo Piglia, Samanta Schweblin, Tamara Tenenbaum u.v.a.m.
Timo Berger (Hg.)
Buenos Aires
Eine literarische Einladung
SALTO [245]. 2019
144 Seiten. Rotes Leinen. Fadengeheftet. Gebunden mit Schildchen und Prägung
18,– €
ISBN 978-3-8031-1344-3
Wagenbach Verlag
Kafkas Wien

Eine ganz besondere Beziehung: Kafka und Wien
„Portrait einer schwierigen Beziehung“ lautet bewusst der Untertitel dieser reich bebilderten und umfassenden Publikation des Kafka-Experten Hartmut Binder, das sich mit Kafkas Verhältnis zur Hauptstadt der österreichisch-ungarischen Monarchie beschäftigt, zu der ja auch Kafkas Prag zählte.
Portrait einer schwierigen Beziehung
Hartmut Binders „Untersuchung“ behandelt die Reisen, die Kafka in die Habsburgermetropole gemacht hat, seine Kuraufenthalte oder als Patient in den in der Umgebung liegenden Sanatorien in Pernitz und Kierling. Außerdem werden kulturelle Einflüsse aus Wien und Budapest thematisiert, denen er auch in seiner Heimatstadt durch den Besuch von Cafés oder Varietés und Kabaretts ausgesetzt war. Auffallend an seiner persönlichen Biographie ist ja auch die Tatsache, dass sowohl er selbst als auch seine Geschwister Namen von bekannten Habsburgern trugen. Wohl wollte Kafkas Vater, Hermann Kafka, damit auch seine Kaiserfreundlichkeit ausdrücken, was wirtschaftlich gesehen für den Einzelhandelskaufmann sicherlich nützlich und opportun erschien.
Kafka und die “Hauptstadt”
Schon als Knabe wurde er Zeuge der Besuche Franz Josefs in seiner Heimatstadt, wie Hartmut Binder eindrucksvoll mittels Zeitzeugnissen belegt. „Kafkas Wien. Portrait einer schwierigen Beziehung.“ liest sich nämlich wie ein Bilder buch oder ein Familienalbum und ist so detailreich und unterhaltsam gestaltet, dass man sich schnell in der guten, alten Zeit verliert. So erfährt man etwa auch, dass der Autor eines der wichtigsten Werke der Weltliteratur zwar in Geographie und Geschichte stets gute Leistungen brachte, im Abitur in Deutsch aber nur die Note „befriedigend“ erhielt. Wien dürfte Kafka zum ersten Mal in der Endphase seiner Gymnasialzeit gesehen haben, da ihn sein Lieblingsonkel, Dr. Siegfried Löwy, dorthin mitnahm. Die Metropole habe aber nur einen „zwiespältigen und unkonturierten Eindruck“ hinterlassen, so Binder und an seine Freundin Hedwi soll er einmal geschrieben haben: „In dieser großen mir ganz undeutlichen Stadt Wien bist nur du mir sichtbar.“
Hartmut Binder schöpft aus einem schier unendlichen Quellenmaterial, das er zu einer lesenswerten und unterhaltsamen Lektüre über Kafkas Wien zusammenstellt und mit Fotos von Personen und Stadtansichten sowie Dokumenten der damaligen Zeit reichhaltig illustriert. So entsteht ein lebendiges Bild einer vor 100 Jahren untergegangen Epoche, an die man heute oft reumütig zurückdenkt, wenn man von der „guten, alten Zeit“ spricht. „Kafka kam nicht als Tourist nach Wien, sondern als Durchreisender, als Kongressteilnehmer, als Liebender, als Schwerkranker und schließlich als Sterbender.“ Er kehrte in einem Zinnsarg der Wiener Städtischen Bestattungsanstalt an die Moldau zurück. „Kierling bei Klosterneuburg ist durch ihn in die Literaturgeschichte gekommen“, wie Anton Kuh prophetisch-ironisch zusammenfasst.
Hartmut Binder
Kafkas Wien. Portrait einer schwierigen Beziehung.
Durchgehend farbig bebildert
19 x 25 cm, 456 Seiten
Deckenband, Fadenheftung, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN 978-3-89919-282-7
€ 49,90 (D)€ 51,40 (Ö)
Vitalis Verlag




