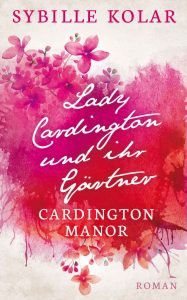 Der Titel »Lady Carington und ihr Gärtner« erinnerte mich anfangs an »Lady Chatterley’s Lover« aus dem Jahre 1928. Der Roman von D. H. Lawrence wurde vor allem wegen seiner erotischen Szenen berühmt, in den USA als »obszön« verboten und auch von Deutschlands Katholiken unterdrückt. Kolars Roman ist jedoch anders. Weiterlesen
Der Titel »Lady Carington und ihr Gärtner« erinnerte mich anfangs an »Lady Chatterley’s Lover« aus dem Jahre 1928. Der Roman von D. H. Lawrence wurde vor allem wegen seiner erotischen Szenen berühmt, in den USA als »obszön« verboten und auch von Deutschlands Katholiken unterdrückt. Kolars Roman ist jedoch anders. Weiterlesen
Archiv
Lady Cardington und ihr Gärtner
Und Johnny zog in den Krieg
Nach den ersten Seiten blättere ich irritiert zurück, das Lesen fällt mir aufgrund fehlender Satzzeichen im ersten Moment schwer. Ist dieses Buch vielleicht keinem Korrektor begegnet? Hasst der Verlag Kommata? Oder hat der Verzicht auf Interpunktion, von Satzschlußzeichen einmal abgesehen, Methode?
Eine Rückfrage beim Verlag klärt auf: Dalton Trumbo, der Verfasser des Werkes, setzte in seinem Original die fehlende Interpunktion als bewusstes Stilmittel ein, und die Herausgeber der deutschen Übersetzung wollen diesem entsprechen. Und tatsächlich geht es recht schnell, bis ich in einen permanenten Gedankenfluss eintauche, der von dem US-Autor ausgebreitet wird. Wie ein Mahlstrom zieht mich der ungewöhnliche Text tief in das unheimliche Grauen, das seinen Er-Erzähler umgibt.
Aus dieser ungewöhnlichen literarischen Erzählperspektive belichtet Trumbo nämlich einen grausigen Film: Johnny Bonham, ein blutjunger amerikanischer Soldat, der in den Krieg gelockt wurde, erwacht in einem Krankenhaus. Nach und nach realisiert er, dass ihm Arme und Beine amputiert wurde, dass er taub ist und sein halber Kopf weggesprengt wurde. Er vegitiert als Torso und fühlt sich bald wie ein Embryo im Mutterleib – Felix Gebhart hat es anschaulich in der Titelvignette gezeichnet. Der Mann, der bewegungsunfähig auf seinem Krankenbett liegt, kommt sich vor, als sei er als ausgewachsener Mensch wieder in den Mutterleib zurückgestopft worden. Doch anders als ein Kind, das ins Leben wächst und eines Tages den Kokon in die Freiheit verlassen darf, wird ihm diese Freiheit nie mehr vergönnt sein. Er ist für den Rest seines Lebens ans Bett gekettet!
Lediglich Erinnerungen sind ihm geblieben, und so blendet er in Analepsen nach und nach Szenen aus dem Leben eines glücklichen jungen Mannes ein, der in den Krieg zog, um zweifelhafte Werte und Freiheiten zu verteidigen, die nicht die eigenen waren. Als hätte er einen zweifelhaften Lotteriegewinn gezogen, zählt er jedoch nicht zu den Millionen Opfern, die auf dem Schlachtfeld blieben. Er hat überlebt, und doch ist sein Leben vorüber. Irgendwo in seinem Bauch steckt ein Schlauch, der ihn mit Nahrung versorgt. Lediglich sein Bewusstsein ist noch vorhanden und aktiv, obwohl das niemand registriert. Sein Körper ist unfähig, mit seiner Umwelt zu kommunizieren, und er spürt nur am Vibirieren des Bettes, wann sich eine Pflegerin nähert, um seinen jämmerlichen Rest zu waschen und seine Stümpfe zu versorgen.
Drei Jahre oder noch länger versucht er, anhand der wenigen Möglichkeiten, die ihm seine eingeschränkte Wahrnehmung erlaubt, die Nacht vom Tag zu unterscheiden, den Stand der Sonne zu erkunden, die unterschiedlichen Schwestern zu erkennen. Er spürt, dass ihm im Nebel seines Zustandes ein schwerer Orden an die Brust geheftet wird und möchte am liebsten laut herausschreien, dass ihm nicht einmal die Freiheit der Entscheidung zugebilligt wird, das Blech aus dem Fenster zu werfen.
Als er schließlich eine besonders feinfühlige Schwester erspürt, nimmt er mit ihr Kontakt auf, indem er mit seinem Hinterkopf Morsezeichen auf das Kopfkissen klopft. Tatsächlich versteht sie sein Bemühen und mit Hilfe eines Funkers kann er sich mühsam äussern. Johnny schlägt den Ärzten im Funkkontakt vor, seinen verstümmelten Körper als Mahnmal gegen den Krieg auszustellen. So gewänne sein Leben einen Sinn. Doch das verstößt gegen die »Vorschriften« und sicherlich auch gegen alles, was Kriegstreiber und Militärs für wertig halten. Sein Vorschlag wird abgelehnt.
Dalton Trumbos Anti-Kriegsroman ist neben seiner stilistischen Kunstfertigkeit schon aus dem Grund wichtig, weil die Generationen, die den letzten Krieg überleben durften, inzwischen nahezu ausgestorben sind. Dies mag auch einer der Gründe sein, warum in der jüngsten Geschichte wieder viel von Krieg und Völkerschlacht die Rede ist. Dass dabei die USA, die den bekennenden Kommunisten Trumbo wegen »unamerikanischer Umtriebe« ins Gefängnis warf und ihn als gefragten Hollywood-Regisseur mit Berufsverbot belegte, wieder einmal die führende Rolle spielt, wundert wenig.
Während also die Amis A-10-Thunderbolt-Kriegs»Warzenschweine« über meinem Kopf nach Deutschland einschweben lassen, lese ich diesen Roman und schaue betroffen in die Zukunft …
Akte 12/12/08-AO1-16. Alles in Ordnung. Ein Poetry-Roman
Leider ist mir dieses Buch erst jetzt bei meiner letzten Poetry-Slam-Tour in Hannover in die Hände gefallen. Ich hab’s gleich mit großer Freude gelesen und möchte andere potentielle Leser an diesem Spaß teilhaben lassen …
Ja, es geht gleich ziemlich verrückt los: ein Typ, der aus dem Rahmen fällt, dieser Finanzcontroller einer Versicherung, der mir als Leser da begegnet, wie er, mit seiner Armbanduhr in der Hand, der Stadtbahn 5 Minuten Verspätung zum Vorwurf macht und ihr, als Fahrgast endlich ganz hinten eingestiegen, mit Blick auf seine Nettolebenszeit diese Rechnung aufmacht:
„Ich benutze immer den hinteren Waggon, da ich berechnet habe, dass dies die Wegstrecke von meiner Zielhaltestelle bis zu meiner Wohnungstür um bis zu 50 Meter verkürzt. Auf diese Weise kann man 30 Sekunden Netto-Lebenszeit einsparen. Das sind 2,5 Minuten pro Woche, 10 Minuten pro Monat, 2 Stunden pro Jahr. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 77 Jahren erhöht sich meine Netto-Lebenszeit um 154 Stunden. Bei meinem Brutto-Stundenlohn von 21 Euro 43 und dem zu erwartenden Anstieg des Renteneintrittsalters entspricht das einem Gegenwert von 3.300 Euro und 22 Cent.“
Da ein Roman von der Spannung lebt, trifft der Protagonist, der interessanterweise nie einen Namen abkriegt und die ganze Zeit über als namenloses Ich (als Ich-Erzähler) agiert, auf Sibido, einen nicht minder abgefahrenen Typen, sein Gegenbild, weniger vom Beruf her (Sibido ist Vertriebsmitarbeiter in einem Technologiekonzern) als dem Oufit, dem Lebensstil und Lebensentwurf nach: (nach-)lässiges Äußeres, (im Gegensatz zu ihm) ein „Frauenflüsterer“, (nach-)lässig im Umgang mit Geld, aber: „Ein eigenes Atelier für meine künstlerische Arbeit wäre noch toll. Weißt du, ich will irgendwann mal davon leben können.“
Gegensätzlicher geht’s eigentlich nicht: für den einen sind Zahlen „was Wunderbares“, sie „bringen Ordnung in die Welt“, der andere hat „Probleme mit dem Finanzamt“. Der Protagonist sagt sich: „Sibido ist schon sonderbar, aber in Ordnung … Ich beschließe, dass Sibido mein soziales Projekt wird.“ So kommen die beiden zusammen. Und Sibido hilft beim Frauenproblem etwas nach: Auch wenn es laut Ich-Aussage „für Frauen keine Bedienungsanleitung gibt … keinen funktionstüchtigen Gesprächsleitfaden zur Reproduktionsanbahnung“ sorgt der neue Kumpel dafür, dass er bereits am Ende des 1. Aktenvermerks („First Contact“) nach durchzechter Nacht an der Seite einer „feuerroten“ Schönheit aufwacht: „Ich hatte ungeplanten Geschlechtsverkehr, den ersten in meinem Leben.“
So bewegt und spannend geht’s dann weiter. „Um diese widernatürliche Symbiose zu dokumentieren, hat unser Protagonist seine Begegnungen mit Sibido …gewissenhaft mit dieser Akte archiviert“ (rückwärtiger Buchdeckel), ja, ein Roman, wie der Teil-Titel schon erahnen lässt, in Form von „Aktenvermerken“ 1-16, über 1 Jahr lang, von Januar des einen bis Mai des folgenden Jahres. Und was in dieser Zeit nicht alles passiert, oft unverhofft, kurios, grotesk – echt abgefahren! Eine Buchbesprechung darf nicht alles vorweg nehmen. Deshalb als Leseanreiz nur dies: da taucht im Leben des Protagonisten eine Tara auf, anfangs fast gerichtsvollziehermäßig als Mitarbeiterin der GEZ-Gebühreneinzugszentrale, später als erhoffte Lebenspartnerin umworben mit einer Folien-Präsentation zu „Strategischem Vermögensaufbau“, „Risikolebensversicherung“, „Altersvorsorge“ und dem schlagenden Argument „Wenn du alt bist, bist du nicht nur grau und faltig, sondern auch wohlhabend! Na, was sagst du dazu?“ Und Sibido zieht alle Register bei den Streifzügen der beiden Freunde (natürlich meist begleitet von den Frauen) durch die Stammkneipe, das Fitnessstudio, den Supermarkt, den Sommerschlussverkauf, das Schwimmbad usw. In „Vernissage“ und „Mein neuer Chef“ wird’s unverhohlen zeitkritisch. In „Six Feet Under“ geht’s grotesk zum Bestatter zur „Todesplanung“. Aktenvermerke wie „Sibidos Traumwandel“, „Der Kühlschrank“, „Mein Traumwandel“ verlassen die fiktive Realität des Hier und Jetzt des Romans; da wird’s surreal. Und was wird am Ende der Geschichte(n) aus den beiden Hauptdarstellern? Wird nicht verraten …
Der Untertitel „Ein Poetry-Roman“ deutet das Genre an, mit dem der Leser es zu tun hat. Gerrit Wilanek ist seit Jahren beim „Poetry Slam“ unterwegs, bei diesem modernen Dichterwettstreit, wo die Autoren auf der Bühne selbst verfasste Texte vortragen, sie mit Mimik, Gestik und Körperhaltung „performen“ (wie es Slammer-Szene-mäßig korrekt heißt) und sich dabei dem Urteil des Publikums als Jury stellen. Wilanek gehört zu den bekanntesten Slammern der Slamily-Familie in Deutschland. Seinen Roman präsentiert er in einzelnen Kapiteln („Aktenvermerken“) auf zahlreichen Lesebühnen. Und aus der Szenerie im Schwimmbad geht dann z.B. auch schon mal eine typische Poetry-Slam-Nummer über den Bademeister von früher hervor, ähnlich dem, was der Protagonist im Roman zu Tara sagt: „Schau mal da drüben! Siehst du ihn? Einst deutscher Bademeister, wurde er durch grausame Fort- und Weiterbildungen zum Wellness-Berater dequalifiziert … Aber kann er eigentlich noch eine anständige Arschbombe? … Die deutsche Arschbombe läuft Gefahr, in Vergessenheit zu geraten.“
Über weite Strecken also ein Lesevergnügen. Dieser „Poetry-Roman“ lebt wie alle Komik von der Übertreibung, der Karikatur, der Satire – und dies hier mal in wirklich differenzierter Art und Weise, völlig anders also, als man’s leider heute oft in der Comedy-Szene geboten bekommt. Aber es geht nicht nur ums Lachen, um das sich schnell verflüchtigende Spaß-Haben. Man wird beim Lesen schon bald auch nachdenklich. Dafür sorgt bereits der Titel „Alles in Ordnung“. Mehrdeutig ist er. Und man fragt sich irgendwann: Was ist denn hier eigentlich alles (womöglich nicht) in Ordnung? Der Lebensentwurf des Protagonisten? der seines Gegenspielers Sibido? Geht’s hier vielleicht um Aus- und Aufbruch? Sehnsüchte werden beim Lesen geweckt. Ja, wo soll’s eigentlich (noch) hin gehen? Was für eine „Endzeit“? Nun, lest ihn selbst, diesen (letzten) Aktenvermerk 16 vom Mai …
(Das Buch ist bestellbar über https://m.shop-asp.de/de/decius-hildesheim/, Preis: 10 €)
Eberhard Kleinschmidt
Die Zärtlichkeit des Geldes
Kann Geld zärtlich sein? Kann Geld zärtlich machen? Hinter dem philosophisch anspruchsvoll anmutenden Titel und einem toll gemachten Cover verbirgt sich ein leicht lesbarer Roman um Liebe, Geld und Leidenschaft.
Der Schauspieler Rante Kleinknecht sucht eine Rolle, da seine Kasse leer ist. Zwar hat der naive junge Mann Glück in der Liebe, so stolpert Mannequin Anima Frank zwischen Theke und Toilette einer Bar in seine Arme. Aber in beruflicher Hinsicht wartet er noch auf den Traumjob, der ihm den Weg in den Bühnenhimmel ebnet.
Da wird ihm über einen Freund ein gut bezahltes Angebot gemacht: Er soll für einen dänischen Pornoverlag Magazine durch den Zoll in verschiedene Länder schleusen, Bücher übersetzen und Filme begleiten. Das Geld scheint leicht verdient, allerdings wird er gleich beim ersten Auftrag erwischt. Die Gattin des dänischen Verlegers hat indes längst ein Auge auf ihn geworfen und befördert den jungen Mann zu ihrem persönlichen Assistenten.
Zeitgleich erhält Rante ein Angebot für eine Hauptrolle in einem Film, den ein schwuler Regisseur dreht. Auch der hat an dem Mann Gefallen gefunden, jedenfalls verliebt er sich in ihn und fördert ihn, bis er erfährt, dass sein Hauptdarsteller auf Frauen steht.
Es entspinnt sich eine turbulente Dreiecksgeschichte. Der Naivling lässt sich von seiner Chefin verführen, fällt auf die Annäherungsversuche einer eigens bezahlten Schönheit herein und schwört seiner Anima gleichzeitig ewige Treue. Dabei hat er die Leidenschaft der Verlegerin unterschätzt, der es leicht fällt, ihn von seiner Traumfrau zu trennen.
Das wiederum erbost Rante, der Dame und Job aufkündigt und sich in erneute Armut stürzt. Doch der Ruf des Geldes treibt ihn in die Arme einer potthässlichen Studentin, die als einzige Tochter eines steinreichen Bauunternehmers hinreichend qualifiziert scheint, seine wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Irgendwer ist also immer da, wenn es um sein Überleben geht, und Skrupel sind dem gescheiterten Schauspieler weitgehend fremd. Überhaupt macht er jäh eine vollständige Verwandlung durch, bald interessiert ihn nur noch Gelderwerb, und er nutzt Frauen dabei schamlos aus.
Rante heiratet des lieben Geldes wegen Baunternehmers Töchterlein, bekommt von ihr ein Kind, unterhält parallel eine Liason mit der Chefsekretärin und baut im Rücken seines Schwiegervaters ein eigenes Unternehmen auf. Dass dies alles irgendwann nicht mehr funktionieren kann, liegt auf der Hand. Der Leser wartet bald nur noch darauf, welchen Fehler der Frauenheld als nächsten begeht und wie er seinen Kopf aus den vielen selbst gelegten Schlingen zieht. Ob alles im Fiasko endet oder zum Happyend führt, darf der Leser selbst herausfinden und bewerten. Erstaunlich ist jedenfalls die Leidensfähigkeit der von Gardner geschilderten Damen wie ihr enormes Verständnis für Herrn Kleinkecht.
Gardners Roman spielt (warum eigentlich?) in den Jahren 1968-70. Der Autor wählte die Perspektive des Ich-Erzählers um das emotionale Erzählen in Lesernähe zu betonen. Allerdings erscheinen die Figuren eigenartig farblos, und der stark dialogorientierte Erzählstil gestaltet die Denk- und Handlungsweisen des Protagonisten nur streckenweise nachvollziehbar. Insbesondere der starke Bruch Rantes, anfänglich der großen Liebe zu vertrauen und ihr eine gewisse Treue zu erklären, um dann zu einem Frauenhasser zu werden, der das andere Geschlecht lediglich benutzt, kommt unvermittelt und wird lediglich intellektuell aus der Handlung nachvollziehbar.
Wie steht es nun mit der im Titel behaupteten Zärtlichkeit des Geldes? – Gardners Roman spielt in vermögenden Schichten, in die sich sein Hauptdarsteller hinauf»arbeitet«. Ob dies mit ausgesuchter Zärtlichkeit geschieht oder ob er vielmehr dem Lockruf des Goldes erliegt, vermag der Leser am Ende des lesenswerten Romans selbst beantworten. Der Autor lässt die Beantwortung der Frage jedenfalls offen.
Der Allesforscher
 Steinfest beginnt seinen genremäßig phantastischen Roman mit einer gewaltigen Explosion: Manager Sixteen Braun beobachtet im südlichen Taiwan, wie ein toter Pottwal auf einem Schwertransporter durch die Straßen gefahren wird. Augenblicke später wird er im Koma liegen, die im Inneren des riesigen Tieres metabolisierenden Gase lassen den Meeresriesen explodieren, Braun wird hart von Innereien getroffen und verliert das Bewusstsein.
Steinfest beginnt seinen genremäßig phantastischen Roman mit einer gewaltigen Explosion: Manager Sixteen Braun beobachtet im südlichen Taiwan, wie ein toter Pottwal auf einem Schwertransporter durch die Straßen gefahren wird. Augenblicke später wird er im Koma liegen, die im Inneren des riesigen Tieres metabolisierenden Gase lassen den Meeresriesen explodieren, Braun wird hart von Innereien getroffen und verliert das Bewusstsein.
Er erwacht in einem Krankenhaus und macht dort – Glück im Unglück – Bekanntschaft mit der sexuell eigenwilligen Ärztin Lana. Der Dame will er treu sein, doch daheim bricht trotz guter Vorsätze das fremd bestimmte Leben über ihn herein. Er heiratet seine von ihm ungeliebte Verlobte, steigt in der Firma des Schwiegerpapas auf und lebt ein frustriertes Dasein. Zwei Jahre darauf wird er davon per Scheidung erlöst, schult vom Manager zum Bademeister um und beginnt, Lana zu suchen. Die ist jedoch zwischenzeitlich überraschend verstorben, und so könnte die Geschichte eigentlich schon zu Ende sein.
Doch da klingelt das Telefon, und mit diesem kleinen Kunstgriff, dessen sich manch ein Autor bedient, der aus der Sackgasse des Handlungsgefüges ausbrechen will, erfährt Sixteen Braun von einem Sohn. Diesen hat er angeblich mit Lana gezeugt, der Waise soll seinem leiblichen Vater zugeführt werden. Nach anfänglichem Sträuben akzeptiert er die Vaterschaft. Die körperliche Zuwendung der Botschaftsangestellten, die ihm das Waisenkind vermittelt, leistet dabei zusätzliche Überzeugungsarbeit. Allerdings wundert sich der frisch gebackene Papa, dass der Knabe ein kleiner Chinese ist, den er mit der Europäerin gezeugt haben soll. Zudem spricht der Knabe eine vollkommen eigene Sprache, die keinem verständlich ist und ist offensichtlich in einer eigenen, geheimnisvollen Welt gefangen und dort zurückgeblieben. Dafür kann er meisterhaft zeichnen und klettert wie eine Bergziege.
Der Leser als Allesforscher
Es soll nun nicht zu viel verraten werden, aber Sixteen begegnet in Träumer seiner Schwester, die beim Bergsteigen tödlich verunfallte und deren Unfallort die frisch verkuppelte dreiköpfige Familie aufsuchen will. Zwischen Wahn und Wirklichkeit, getrieben von Albträumen und Fantasien geht der ehemalige Businessman und jetzige Bademeister nun mitsamt Sohn und Freundin auf die Reise. In den Alpen begegnet er einem Chinesen, der eigentlich mit der Geschichte eng verwoben ist …
Spätestens hier nun ist es am Leser, im Sinne des Buchtitels zum Allesforscher zu werden und die verschiedenen Fäden und Handlungsstränge aufzunehmen und zu verweben. Das wirkt im ersten Augenblick verwirrend surreal, liest sich aber äusserst geschmeidig, denn Steinfest ist ein Autor, der zumindest im Steinbruch der Worte gewandt zu klettern versteht.
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2014 hätte dieses Werk durchaus verdient, gekrönt zu werden. Doch dazu hätte der 1961 geborene Verfasser seinen Roman wohl auf die Insel Hiddensee statt nach Taiwan verlegen müssen …
Ruprecht Frieling
Diskussion dieser Rezension im Blog der Literaturzeitschrift
Blechmenagerie
Elaine Greenstein bereitet sich auf ihren Lebensabend vor. Als Witwe mag sie nicht mehr alleine in dem großen Haus wohnen, in dem sie ihre Kinder großzog und mit ihrem Mann Paul glücklich war. Auf sie wartet eine seniorengerechte Wohnung in der “Rancho Manana”, von ihr gewohnt spitzzüngig “Ranch ohne Morgen” genannt. Vorbereitend sichtet sie gemeinsam mit dem jungen Archivar Josh Papiere aus ihrem langen Leben als Anwältin. Natürlich sind darunter auch private Papiere und einige davon wecken die Aufmerksamkeit des eifrigen Archivars. Es sind Briefe vom zu seiner Zeit berühmten Detektiv Philip Marlowe, die sich mit einer in der Vergangenheit liegenden Tragödie befassen.
Vor mehr als 60 Jahren hat Elaines Zwillingsschwester Barbara ihre Familie verlassen, seitdem gibt es von ihr nicht ein einziges Lebenszeichen. Elaines und Barbaras Familie lebte damals in Boyle Heights, dem jüdischen Stadtteil von Los Angeles. Elaines Eltern waren aus Rumänien emigriert, ihr Leben sowie das der Gemeinde war überschattet von den Judenverfolgungen in Europa. Es gelang ihnen, sich in Amerika eine neue Existenz aufzubauen und sich in die dortige Gemeinde zu verwurzeln. Dennoch – es gab Ungereimtheiten in der Geschichte der Eltern, vieles blieb ungesagt. Die Wirtschaftsdepression tat ein Übriges, der Familie und auch deren Freunden das Leben zu erschweren. Die Seniorin Elaine hat mit all dem eigentlich abgeschlossen, das redet sie sich zumindest ein. Dennoch stellt sie sich nach anfänglichem Widerstreben den Schatten und begibt sich mit Josh auf eine Reise in die Vergangenheit und auf die Suche nach Barbara.
Jedes Familienmitglied wächst in einer anderen Familie auf, so sagt man. Oder auch, dass man nur das wahrhaben will, was in die eigene Biographie passt. So können die Erinnungen von Geschwistern ganz unterschiedliche sein. Dies ist das Kernthema von Janice Steinbergs groß angelegter Familiensaga “Blechmenagerie”. So ist es in der Familie Greenstein gewesen, namentlich bei den “übrig gebliebenen ” Schwestern Elaine, Audrey und Harriet. Und Barbara? Wo war sie all die Jahre? Welche Erinnerungen hat sie? Und warum hat sie die Familie verlassen und sich nie mehr gemeldet? In den Rückblenden erschließt sich sowohl die einst innige Verbundenheit der Schwestern als auch deren erbitterte Rivalität, die sich sowohl an der ungleich verteilten Zuneigung der Mutter als auch an der Liebe zu einem Mann entzündete.
Als alte Frau wirkt Elaine zunächst sehr selbstbezogen und nörglerisch, doch das ändert sich in dem Maße, wie sie sich selbst ändert. Sie läßt alte Erinnerungen zu und erinnert sich mitunter auch liebevoll an ihr Aufwachsen in ihrer temperamentvollen Familie. Vor allem an den Großvater mit seinen hochfliegenden Ideen, seinen schöngefärbten Geschäften (soooo groß ist der Unterschied zwischen Buchhandel und Buchmacher ja nun auch wieder nicht….. ) und vor allem an seine Geschichten aus dem alten Land. Die Blechmenagerie – eine kleine Sammlung von Blechtieren, die der Großvater den Kindern anfertigte – wird in großen Ehren gehalten. Eins von ihnen – das Blechpferd (so auch der Originaltitel: Tin Horse) wird am Ende des Buches noch eine kleine, aber sehr wichtige Rolle spielen. Doch erst als Elaine alle Geheimnisse gelüftet hat, offenbart sich ein Verrat. Ein Verrat, den sie nie wird vergessen können, aber vielleicht verzeihen. Die Verzeihung gefördert durch liebevolle Erinnerungen. So hat sie es ihr Leben lang gehalten: “Wenn Eier zerbrechen, macht man am besten ein Omelett”.
Die Blechmenagerie zeichnet eine satte, bunte Familiengeschichte über mehrere Generationen. Sie erzählt von tiefer Geschwisterbindung, aber auch von den Träumen und Sorgen der amerikanischen Einwandergeneration im zweiten Weltkrieg. Gepflegt recherchiert und sorgfältig erzählt entsteht so ein Bild von einer hierzulande weitestgehend unbekannten, in Amerika fast vergessenen Welt: der eigene kleine Mikrokosmos des einstigen Boyle Heights, dem früher rein jüdischen Stadtteil von Los Angeles. Es entsteht ein anderes als das gemeinhin bekannte Bild der kalifornischen Metropole, das tiefe Einblicke in das Sittenbild dieser Epoche gewährt.
Die “Blechmenagerie” ist ein sehr ruhig erzählter Roman, der durch liebevolle Charakterzeichnung und eine lebendige Darstellung überzeugt. Im Kern ist es ein Buch über die Frage: Wie können wir wissen, wer wir sind? Für manche sind Familie, Herkunft und ererbte Kultur ein komfortabler Weg, um ihre Identität zu finden. Für andere jedoch kann dieser Weg ein Gefängnis sein, und die Flucht um jeden Preis eine verzweifelte Notwendigkeit. Es ist ein Buch nicht nur über die Geschichten, die wir erzählen, sondern über die Geschichten, die wir glauben wollen, um uns selbst zu erkennen.
Janice Steinberg lebt in San Diego, sie ist Kunstkritikerin u.a. für die “Los Angeles Time “und lehrt an verschiedenen Universitäten. Die “Blechmenagerie” ist ihr literarisches Debüt und ihr erster Roman, der auf Deutsch erscheint und im Übrigen ganz wunderbar in die Tradition des Eichborn Verlags passt.
Diskussion dieser Rezension gerne im Blog der Literaturzeitschrift
Töchter des Nordlichts
 Finnmark 1915: Abrupt endet das friedliche, naturverbundene Nomadenleben des Sami-Mädchens Áilu. Auf der Wanderung zu den Sommerweiden ihres Stamms wird sie von norwegischen Beamten mitgenommen, die sie in ein Internat stecken. Dort und später in einem Waisenhaus soll sie zu einem “zivilisierten” Mädchen geformt werden. Nach langem Widerstreben ergibt sie sich in ihr Schicksal und wird die Vorzeige-Schülerin Helga. Doch der Tag kommt, an dem sie ihre Herkunft nicht länger verleugnen will – koste es, was es wolle.
Finnmark 1915: Abrupt endet das friedliche, naturverbundene Nomadenleben des Sami-Mädchens Áilu. Auf der Wanderung zu den Sommerweiden ihres Stamms wird sie von norwegischen Beamten mitgenommen, die sie in ein Internat stecken. Dort und später in einem Waisenhaus soll sie zu einem “zivilisierten” Mädchen geformt werden. Nach langem Widerstreben ergibt sie sich in ihr Schicksal und wird die Vorzeige-Schülerin Helga. Doch der Tag kommt, an dem sie ihre Herkunft nicht länger verleugnen will – koste es, was es wolle.
Oslo 2011: Die Erzieherin Nora erfährt mit Mitte dreißig endlich den Namen ihres Vaters: Ánok, ein samischer Student der Medizin. Er verschwand damals plötzlich aus dem Leben ihrer Mutter. Nora ist schon lange nicht wirklich glücklich in ihrem Leben, sie spürt, dass ihr etwas Entscheidendes fehlt, um sich selbst und das, was sie vom Leben wünscht, zu verstehen. Sie reist hoch in den Norden, auf den Spuren ihres Vaters in seine Heimat. Sie lernt die Sami und ihre Kultur kennen, ist fasziniert davon, doch es bleibt ihr lange fremd. Bis sie ihre Oma findet, mit ihr einen Teil ihrer Wurzeln und durch sie Mielat kennenlernt, einen Wissenschaftler und Hundezüchter, der in beiden Welten zu Hause ist und ihr hilft, über Generationen hinweg den Kreis zu Áilu zu schließen.
“Töchter des Nordlichts” ist ein erstaunliches Buch. Anders als bei manch anderem Werk weckt die Beschreibung zunächst einmal Interesse, aber keine allzu hohen Erwartungen. Diese werden dafür dann aber um ein Vielfaches übertroffen. Man erwartet gediegene Unterhaltung, die bekommt man auch, aber – man sieht sich plötzlich mit einem Stück Geschichte konfrontiert, von dem man wenig wusste und das nun tief betroffen macht und den Leser ganz schnell ganz tief in den Sog dieser Geschichte zieht. Einerseits. Andererseits ist man aber erstaunt ob der Unwissenheit, die man bisher über dieses Kapitel europäischer Geschichte hatte. Wem ist das schon klar, dass es auch in Europa Ureinwohner gab, deren Kultur schändlich geschmäht und auszumerzen versucht wurde. So ergeht es auch Nora. Am Beginn ihrer Reise ist ihr Àilu sehr ferne, am Ende aber wird es auch Áilus Geschichte sein, die sie in der Zukunft leiten wird.
Die in Vergessenheit geratene Kultur der Samen ist durchaus geeignet, nicht nur Nora unser heutiges Wertesystem in Frage stellen zu lassen. Die Autorin Christine Kabus untermalt dies eindringlich mit wunderbaren Landschaftsbeschreibungen, ehrlichen Eindrücken über das Leben im rauen Norden, gerne auch bezugnehmend auf die Sagen und Traditionen der alten Völker. Bei aller Eindringlichkeit erzhlt die Autorin in einem unaufregten, angenehm zurückgenommenen klassischen Stil. Die Zeitebenen wechseln, aber der Roman bleibt durchweg gut strukturiert, dabei hilft enorm, dass die Autorin die Technik des Cliffhangers routiniert beherrscht. Ihre Cliffhanger kommen gar nicht immer so spektakulär daher, bleiben aber lange genug in Erinnung, um beim Wechsel der Zeitebenen gut wieder an die jeweilige Geschichte anzuknüpfen und keine Fragen offen zu lassen. Ihren Charakteren bringt sie viel Verständnis und Wärme entgegen, gerade auch denen, die zunächst als stur und uneinsichtig vorgestellt werden. Deren Beweggründe werden gut erklärt in die Geschichte gewoben, ihre Entwicklung und überhaupt die aller Charaktere ist nachvollziehbar und wird gerne begleitet.
Die Töchter des Nordlichts heben sich sehr angenehm ab von den leider oft genug einfach so dahingehudelten Romanen in diesem so einfach anmutenden und doch so schwierig zu schreibenden Genre des Gesellschaftsromans. Christine Kabus hat sorgfältig und aufwändig recherchiert, man merkt es gut, dass diese Fleißarbeit ihr letzten Endes das Erzählen leicht gemacht hat. Schön, dass diese Recherchen auch in Form von sorgfältig erstellten Stammbüchern und Karten mit dem Leser geteilt werden. Schon daran merkt man direkt zu Beginn, dass man hier nicht einfach so eine Familiensaga vorgesetzt bekommt, die jemand mal eben so zusammengeschrieben hat. Da hat sich eine Autorin viel Mühe und Gedanken gemacht. Auch wenn es manchmal den berühmten Tacken zuviel ist. Die Liebesgeschichte zwischen Mielat und Nora hätte auch eine Wendung weniger vertragen, auch Àilu hätte man gut und gerne den ein oder anderen Schicksalsschlag ersparen können. Dennoch nimmt man als Leser dieses kleine bißchen zuviel gerne hin, muss man sich doch dadurch nicht so schnell von den liebgewonnenen Charakteren trennen. Und letzten Endes weckt das Buch nicht nur Verständnis und Interesse, sondern auch Sehnsucht. Nach dem Nordlicht, der Landschaft, aber auch nach den Menschen, die dort leben und deren Kultur man gerne kennenlernen würde.
Die Töchter des Nordlichts knüpfen lose an den Debütroman “Im Land der weiten Fjorde” der deutschen Autorin Christine Kabus an, der in den vergangenen zwei Jahren viele begeisterte Leser fand. Teil drei dieser Norwegen-Trilogie soll folgen, aber es ist kein Muss, diese Bücher zusammenhängend zu lesen, da es keine Fortsetzungsromane im eigentlichen Sinne sind. Die studierte Germanistin Christine Kabus arbeitete vor ihrer Autoren-Karriere als Drehbuchautorin und Regieassistentin. Heute betreut sie als Dramaturgin noch Projekte anderer Autoren und lehrt bei einer Drehbuchwerkstatt. Obwohl sie gebürtige Norwegerin ist und immer nur zu Besuch in diesem Land war, erzählt sie mit viel enthusiastischer Liebe zum Norden.
Zudem freut es durchaus, dass eine deutsche Autorin sich so couragiert an das Genre des klassischen Gesellschaftsromans wagt und dieses Feld nicht nut den versierten Britinnen und Französinnen überlässt. Allzu oft trauen sich deutsche Autoren/Autorinnen das ja leider nicht und wenn, dann wird das gerne in einem kriminalistischen oder humoristischen Mantel verbrämt.
Fazit: Für alle Liebhaber nordischer Welten und Kulturen ein Muss, aber auch sonst uneingeschränkt empfehlenswert. (Man lasse sich da nicht vom weniger gelungenen, leicht kitschigen Cover abschrecken)
Diskussion dieser Rezension gerne im Blog der Literaturzeitschrift
Die Frauen von Tyringham Park
 Irland im Jahr 1917: Die Familie Blackshaw residiert im Anwesen Tyringham Park mit allem Prunk und allen Privilegien des beginnenden 20. Jahrhunderts. Es herrscht eine gefühlskalte, egozentrische Mutter, der Vater glänzt meist durch Abwesenheit. Dazu bieten wir noch die lieben Töchterlein, eins hübscher als das andere, eine Dienstbotenriege, die das gesamte dramaturgische Spektrum von liebevoller Köchin bis hin zur grausamen Nanny abdeckt. Und jede Menge Pferde.
Irland im Jahr 1917: Die Familie Blackshaw residiert im Anwesen Tyringham Park mit allem Prunk und allen Privilegien des beginnenden 20. Jahrhunderts. Es herrscht eine gefühlskalte, egozentrische Mutter, der Vater glänzt meist durch Abwesenheit. Dazu bieten wir noch die lieben Töchterlein, eins hübscher als das andere, eine Dienstbotenriege, die das gesamte dramaturgische Spektrum von liebevoller Köchin bis hin zur grausamen Nanny abdeckt. Und jede Menge Pferde.
Eines Tages verschwindet die jüngste Tochter der Familie spurlos. Entführung, Ermordung, Unfall? Das Schicksal der Kleinen bleibt lange Jahre ungeklärt. Eine Spur führt nach Australien – klar, bißchen Fernweh und eine Prise Aussiedlerromantik schadet nie. Die andere Spur verläuft sich am nahegelegenen Fluß. Die Jahre gehen ins Land, Ungereimtheiten und heimliche, nicht standesgemäße Liebschaften kommen ans Licht, alleine das Kind bleibt unauffindbar. Sein Verschwinden wirft einen Schatten über das Leben aller, die das Kind gekannt haben. Nur mit der Wahrheit, die sich nach Jahrzehnten offenbart, hat laut Klappentext keiner gerechnet. Mit der Banalität dieser Wahrheit wohl auch der bis dahin tapfer durchhaltende Leser nicht.
Die Auflösung des Plots um die verlorene Schwester ist so flach wie nur eben geht. Das fiel mutmaßlich auch der Autorin auf, so dass sie sich ohne Vorwarnung und ohne vorherigen Bezug dazu schnell in ein esoterisches Geschwurbel rettet. Doch der Roman krankt nicht nur an dieser schon sensationell mißglückten Auflösung. Auf dem Cover steht tatsächlich: Wenn Sie Downton Abbey mögen, werden Sie diesen Roman lieben. Markige Worte. Man kann den Vergleich mutig nennen, anmaßend trifft es allerdings besser. Drehen wir es um: Wer Downton Abbey liebt, kann Tyringham Park allenfalls ansatzweise freundliches Wohlwollen entgegenbringen.
Die Handlung an sich ist gar nicht so schlecht. Ein bißchen zu konstruiert, ein bißchen zu vorsehbar, aber – aus diesem Kaleidoskop an Schicksalschlägen, die unzweifelhaft einer blühenden Phantasie entspringen, hätte man was machen können. Hat man aber nicht. Es wird eher lieblos erzählt, die Sprache ist hölzern, manche Sätze wirken wie abgebrochen und Faden verloren. Manche Szenen scheinen wie zufällig in der Entwürfe-Schublade gefunden und schnell in den Roman hineingewürfelt. Wiederholungen sind das Stilmittel der Wahl, die Charaktere sind mit der Schablone gezeichnet, Hauptsache, es entspricht den Klischees. Und wenn nicht, dann wird ganz schnell mal überzeichnet. Schwarz-weiß klappt ja immer. Nirgendwo findet sich ein Charakter, mit dem sich identifizieren oder den man wenigstens mögen könnte. Es werden weder Sympathien geweckt, noch Mitleid. Der Leser bleibt ratlos und weiß nicht, ob die wie hingeschludert wirkende Erzähltechnik Absicht ist und wenn ja warum nur? Die Autorin ist gebürtige Australierin, lebt aber schon seit Jahrzehnten in Irland. Es nimmt schon Wunder, dass die Schauplätze derart lieblos und oberflächlich gezeichnet sind.
Die größte sich an diesem Buch zeigende Begabung hat zweifelsohne der Verfasser des Klappentextes, der auf den Zug des Erfolges von Downton Abbey aufspringend es tatsächlich geschafft hat, Neugierde auf dieses Buch zu wecken. Noch einmal: Es mag ja sein, dass es in Downton Abbey auch oft nur um den British Tea zu jeder Stunde des Tages geht. Aber dieser Tee ist wenigstens erlesen und elegant, der von Tyringham Park ist allenfalls ein schaler Aufguß. So geschickt der Klappentext ist, man sollte ihn überdenken. Selbst wenn das Buch besser gewesen wäre – im Vergleich mit Downton Abbey kann man nur verlieren.
Diskussion dieser Rezension im Blog der Literaturzeitschrift
Sehnsucht ist ein Notfall
 “Mit Tobias geschlafen. Mit Johannes geschlafen. Und mit Oma jetzt auf der Flucht nach Italien” So sieht’s doch mal aus. Tjanun. Passiert. Eva hat sich verheddert in ihrem Leben, da kann sie sich ebenso gut mit der Oma auf den Weg nach Italien machen.
“Mit Tobias geschlafen. Mit Johannes geschlafen. Und mit Oma jetzt auf der Flucht nach Italien” So sieht’s doch mal aus. Tjanun. Passiert. Eva hat sich verheddert in ihrem Leben, da kann sie sich ebenso gut mit der Oma auf den Weg nach Italien machen.Diese Flucht hatte die Oma 10 Minuten vor der SMS so beschlossen. Schließlich ist Sehnsucht ein anerkannter Notfall und Spontanität Omas neues Markenzeichen. Hat sie doch mit 79 Jahren den Opa verlassen und wenn nicht jetzt, wann sonst ist die Zeit, endlich das Meer zu sehen? Für Oma trifft es sich ganz gut, dass auch der geliebten Enkelin, die gerade im “Chaos de luxe” steckt, der Sinn nach Flucht steht. Eva ist als Physiotherapeutin zwar beruflich angekommen, aber ansonsten plagt sie sich mit den typischen Problemen der Thirtysomethings herum. Heirat und Kinder? Wenn ja, wann? Und noch viel wichtiger mit wem? Ihr Lebenspartner Johannes hält sie zwar noch, aber leider auch für selbstverständlich. Da lernt sie den geschiedenen Vater Tobias kennen und verbringt mit ihm eine Nacht, die ebenso zauberhaft ist wie die Nachrichten, die er ihr anschließend schreibt. Eva braucht Luft, Licht und Zeit zum Nachdenken. Die will sie sich allerdings erst nehmen, wenn sie angekommen ist. Am Meer, mit der Oma. Einer Oma, wie viele ‘anne Ruhr’ sie haben. Die Oma, die sie nach dem frühen Tod der Eltern so liebevoll im alten Zechenhäuschen aufgezogen hat und die jetzt die Enkelin braucht. Nicht nur, um zu lernen, wie man diese kleinen smarten Alleswisser-Dinger bedient, um Eva damit bis zum Meer zu navigieren.
Es gibt ziemlich genau zwei Radio-Moderatorinnen, die ich schon an der Stimme erkenne. Die in der Grauzone westliches Westfalen/ östliches Ruhrgebiet geborene Sabine Heinrich ist eine davon. Beim WDR-Radio eins live ist Frau Heinrich mittlerweile eine Institution, auch Fernsehzuschauern dürfte sie bekannt sein. Sie gehört zum Team der Kultsendung “Zimmer frei” und hat seit Ende 2013 ihre eigene Talkshow “Frau Heinrich kommt”. “Und jetzt schreibt se auch noch” könnte man nun genervt aufstöhnen ob der Flut der selbstdarstellenden Möchte-Gern-Schriftsteller. Im Falle der Frau Heinrich war ich aber schon begeistert, bevor ich nur eine Zeile gelesen hatte. Denn wenn Frau Heinrich auch nur annähernd so charmant romanciert wie sie plaudert oder twittert, können es keine verlorenen Stunden werden, die man mit diesem Buch verbringt. Und ich hatte Recht.
Ihr Roman-Debüt “Sehnsucht ist ein Notfall” erzählt zwei miteinander verwobene Geschichten mit ganz unterschiedlichen Enden. Eine Geschichte endet offen, die kann sich der Leser so ausmalen, wie er es gerne hätte. Letzere ist die Geschichte von Eva zwischen zwei Stühlen Männern. Noch am Meer erstellt Eva sich eine dieser beliebten und nichts bringenden Listen, auf der sie festhält, was für den einen oder den anderen Mann spricht. (Wobei sie auf Tobias Seite der Liste vergessen hat, dass Tobias derjenige ist, der versteht, dass Sehnsucht ein Notfall ist. Vielleicht fällt ihr das ja noch ein und sie entscheidet sich für Tobias. Das wäre mein persönliches Lieblingsende.)
Aber zunächst einmal vertagt Eva diese Entscheidung, denn das Ende der anderen Geschichte, der Geschichte von der Oma, verdrängt alles andere. Diese Geschichte endet nach zu Herzen gehenden Szenen am Meer traurig mit einer Prise Trost. Und egal, wie Eva sich für ihre Zukunft entscheidet, eines wird sie immer mitnehmen: die Gewißheit, der Oma etwas immens Wichtiges ermöglicht zu haben. Eine Erinnerung wird sie ihr Leben lang tragen: “An einem sonnigen Tag im Januar gingen wir ins Meer und schrien vor Glück”
“Sehnsucht ist ein Notfall” stellt die Fragen, die uns alle bewegen, egal, wie alt wir sind. Was ist Liebe, was will ich von ihr, was will ich von meinem Leben, von meinem Partner? Sabine Heinrich erzählt offen, ehrlich, ungeschminkt, wie man sie eben kennt. Manchmal melancholisch, aber oft genug blitzt auch die flapsige Art der Moderatorin durch. Sätze wie “Jetzt ist die Welt dunkelgrau und die Sterne bauen Überstunden ab” klingen allerdings vielleicht auch nur deswegen nicht kitschig, weil man ein Bild von der Autorin hat und ihre Stimme im Ohr.
Fazit: Ein Romandebüt, dass ein Glücksfall statt Notfall ist. Traurig und tröstlich zugleich. Gerne mehr davon, Frau Heinrich.
Der Garten über dem Meer
Ein alter Garten. Ein verlorener Ring. Ein schockierendes Familiengeheimnis. Zwei Frauen auf unbeirrbarer Suche nach dem Glück. Hört sich nach Schmonzette an? Oder doch eher nach gut gemachter Unterhaltungsliteratur? Ganz klar letzteres. Mit dem Roman “der Garten über dem Meer” legt die englische Autorin Jane Corry eine spannende Familiensaga in der guten Tradition englischer Erzählerinnen vor. Der Garten über dem Meer erzählt die Lebensgeschichten zweier Frauen, die durch den Ring und das Geheimnis verbunden sind. Die Geschichte vollzieht sich vor der Kulisse des malerischen Süden Englands auf zwei Zeitebenen, zum einen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zum anderen in der Gegenwart.
Da ist zunächst die junge Mary Rose Marchmont, deren Mutter ihr 1866 auf dem Totenbett einen Rubinring anvertraut. Dieser Schutz gebende Ring wird seit Generationen über die Mütter an ihre Töchter weitergegeben. Doch gerät er in die falschen Hände, wird er Unglück über alle nachfolgenden Generationen bringen. Mary Rose ist noch sehr jung, als sie den Ring erhält. Zu jung. Sie kann weder verhindern, dass ihr Vater den Ring seiner zweiten berechnenden Frau gibt, noch kann sie das Unglück, welches über sie und ihre Familie kommt, verstehen oder gar aufhalten. Ihr innig geliebter Stiefbruder wird noch als Baby mit zertrümmertem Schädel aufgefunden, Mary Rose des Mordes beschuldigt und für 20 lange Jahre eingekerkert. Der einzige Halt in ihrem trostlosen Dasein werden bis zu ihrem Tod Sticktücher sein, die mit beachtlichem künstlerischen Talent angefertigt ihre Erinnerung an ihr verlorenes Zuhause wachhalten und in die sie kleine geheimnisvolle Botschaften einarbeitet.
130 Jahre später glaubt Mary Rose’ Ururenkelin Laura ihr Glück gefunden zu haben. Auch ihr Leben ist von einem tragischen Unglück überschattet. Lange hat sie sich in eine selbst gewählte Einsamkeit geflüchtet, bis sie sich Hals über Kopf in den Architekten Charles verliebt und diesen überstürzt heiratet. Sie wagt mit ihm einen Neuanfang in Devon in einem wunderbarem Haus mit einem alten Garten direkt über dem Meer. Doch Lauras Glück ist fragil. Es wird nicht nur von ihrem beharrlich gehütetem Geheimnis bedroht, sondern auch von Charles’ Töchtern aus erster Ehe, die sich mit der ganzen Raffinesse zweier pubertierender Mädchen gegen Laura stellen. In dieser Situation erbt Laura von ihrer Großmutter ein Sticktuch, auf dem sie ihren jetzigen Garten erkennt. Doch auf dem Sticktuch ist noch mehr zu finden (die Botschaften! ) und Laura beginnt zu recherchieren. Schon bald erkennt sie die Verbindung zu Mary Rose und zu ihrem eigenen Geheimnis. Sie ist fest entschlossen, Mary Rose’ Unschuld zu beweisen. In der Vorahnung, dass dieser Beweis auch die Schatten aus ihrem Leben vertreiben kann.
So verschieden Mary Rose und Laura selbst als auch ihre Lebensumstände sind, beide eint ihre Hartnäckigkeit und der unbedingte Wille, für sich, ihre Nachkommen und ihr Glück zu kämpfen. Und so wiederholt Geschichte sich manchmal doch. Wenn auch in diesem Roman unter umgekehrten Vorzeichen. Während Mary Rose das Unglück der verstoßenen Stieftochter erleidet, ist in der Gegenwart Laura in der undankbaren Rolle der Stiefmutter und läuft Gefahr, ihre Stieftöchter von sich zu stoßen. Durch ihre Recherchen schließt sich nach Generationen ein Kreis und es erwächst aus dem tief Bösen der Vergangenheit etwas Gutes. Laura erwirkt eine späte Wiedergutmachung, mehr noch eine Würdigung ihrer Urahnin und schafft es dadurch, ihre eigene Patchwork-Familie zusammenzuhalten.
Jane Corry, die schon mit ihrem Debüt “Perlentöchter” nicht nur in Großbritanien sehr erfolgreich war, erzählt ihre Saga bemerkenswert gut recherchiert und mit viel Liebe zu ihren beiden Protagonistinnen. Erfreulich unsentimental lässt sie beiden Geschichten ihr jeweils eigenes Tempo. Sie verzichtet auf billige Effekthascherei und baut ihre Spannung langsam, unaufgeregt, aber unausweichlich auf. Somit hat jede Geschichte, jede Zeitebene ihren ganz eigenen, ganz speziellen Reiz. Geschickt widersteht sie der Versuchung, ihre Heldinnen allzu rosarot zu malen und bringt sie gerade dadurch ihren Lesern nahe. So kann man Laura durchaus ansatzweise hysterisch finden, aber jede besorgte Mutter wird sich ehrlicherweise in ihr wiederfinden.
Der Garten über dem Meer erhebt den Anspruch, gute Unterhaltungsliteratur zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Schwierig genug. Selten genug. Doch der Roman erfüllt diesen Anspruch durchaus. Auf beiden Zeitebenen kommt man schnell gut rein in die Geschichte. Die Atmosphäre ist dicht gezeichnet, ohne überladen zu langweilen. Die Handlung ist nicht zu vorsehbar und interessant genug, um dem Leser an das Buch zu fesseln. Einiges mag in der Zusammenfassung klischeehaft anmuten, doch Corrys unsentimentale und pragmatische Ader hält die Geschichte vom Kitsch fern. Kurz – das Buch ist perfekt für den, der sich gerne von einer gut erzählten Geschichte in ein anderes Leben ziehen lassen möchte und gleichermaßen historische wie Gegenwartsromane mag.
Jane Corry war nach ihrem Englischstudium für The Times, The Daily Telegraph und andere Medien tätig. Eine Zeitlang arbeitete sie als Gefängnisreporterin in einem Hochsicherheitsgefängnis für Männer, was wohl ihren unsentimentalen Blick auf die Welt geschult hat. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern an der Küste im englischen Devon. Die Liebe zu ihrer Heimat ist ganz sicher ein Teil des Geheimnisses der Jane Corry, ihre Leser so tief mit in die Atmosphäre ihres Romans zu ziehen.
Diskussion dieser Rezension gerne im Blog der Literaturzeitschrift
Soap
 Einer meiner Bekannten hat sämtliche Folgen der »Lindenstraße« gesehen – und zwar von der ersten Sendung im Dezember 1985 an – und er schaltet immer noch ein. Es scheint da einen Suchtfaktor zu geben, der mich bislang verschonte, obwohl mir Süchte alles andere als fremd sind. Bislang habe ich jedenfalls noch keine Episode dieser Endlos-Reihe, die unter ihren Fans Kult-Status genießt, gewidmet. Schlimmer noch: Ich schaue mit gewisser Hochnäsigkeit auf diejenigen, die keine Tele Novela auslassen. Weiterlesen
Einer meiner Bekannten hat sämtliche Folgen der »Lindenstraße« gesehen – und zwar von der ersten Sendung im Dezember 1985 an – und er schaltet immer noch ein. Es scheint da einen Suchtfaktor zu geben, der mich bislang verschonte, obwohl mir Süchte alles andere als fremd sind. Bislang habe ich jedenfalls noch keine Episode dieser Endlos-Reihe, die unter ihren Fans Kult-Status genießt, gewidmet. Schlimmer noch: Ich schaue mit gewisser Hochnäsigkeit auf diejenigen, die keine Tele Novela auslassen. Weiterlesen
Der Distelfink
“Ich nehme an, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich eine beliebige Anzahl von Geschichten gewußt, aber jetzt gibt es keine andere mehr. Dies ist die einzige Geschichte, die ich je werde erzählen können.” Zwanzig Jahre ist es her, dass dieser Satz den Prolog von Donna Tartts geheimer Geschichte beendete, zwanzig Jahre, in denen von der Autorin außer einem kleinen, schmalen Band nichts zu lesen war und man zu fürchten begann, dieser Satz wäre zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden.
Die geheime Geschichte. Viele werden sich erinnern, als Anfang der 90er Jahre dieses wortgewaltige Debüt wie aus dem Nichts auftauchte und unzählige Leser in seinen Bann zog. Es war eines der nachdrücklichsten Werke des ausgehenden 20. Jahrhunderts, ein Buch, das auch Jahrzehnte später unvergessen und präsent im Gedächtnis seiner Leser ist. Immer verbunden mit dem Wunsch, diese Autorin möge noch einmal so ein monumentales, berührendes, verstörendes Werk schreiben. Zwanzig Jahre Zeit hat sie sich dafür gelassen, zehn Jahre davon verbrachte sie damit, das so sehnlich erwartete zweite Meisterwerk zu verfassen. Zehn Jahre nicht nur für die Entstehung des Buches, zehn Jahre ist auch genau die Zeitspanne, den das Buch umfasst. Spannend, sich vorzustellen, wie die Autorin zehn Jahre in genau diesem Zeitraum mit ihrer Geschichte gelebt hat.
Der Distelfink. Genauso verstörend, genauso begeisternd, genauso meisterhaft und monumental wie die geheime Geschichte. Noch bevor ich die erste Seite aufschlug, hatte ich meine ganz eigene Geschichte mit diesem Buch. Die geheime Geschichte gehört ganz sicher zu den “Büchern meines Lebens”, meine Erwartungshaltung an ein nachfolgendes Werk war enorm und meine Aufregung groß, als ich vor 2 Jahren in einer holländischen Buchhandlung “het puttertje” sah. Mein Wunsch nach einem zweiten, ebenso epochalen Werk schien endlich erhört zu werden, doch ich musste mich noch lange gedulden, bis das Werk endlich auch dem deutschen Markt zugänglich war. Der Distelfink wurde zeitgleich in den USA und den Niederlanden veröffentlicht, was schon nach kurzer Lektüre nicht mehr verwundert. Ein entscheidender Teil des Buches spielt in Amsterdam, der Ich-Erzähler bezeichnet die Stadt als sein persönliches Damaskus und noch vor der Lektüre schien es mir eine gute Wahl. Das Bild, das ich mir von der Autorin und ihren Geschichten gemacht hatte, passt außerordentlich gut in diese Stadt.
Der titelgebende Distelfink ist ein kleines, auf den ersten Blick unscheinbares Bild des holländischen Malers Carel Fabritius. Fabritius war ein Rembrand-Schüler, der 1654 bei einer Explosion der Delfter Pulvermühle ums Leben kam. Bei dieser Explosion ging auch ein Großteil seiner Werke verloren. Der bis heute erhaltene Distelfink ist ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert und im den Haager Mauritshuis zu besichtigen. In Donna Tartts Roman wird dieses Bild wiederum durch eine Explosion bedroht. Im Roman ist das Bild eine Leihgabe im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Der junge Theo Decker besichtigt es mit seiner Mutter, als sich die (fiktive) Explosion ereignet. Die Mutter verliert ihr Leben, das Kind Theo überlebt und nimmt im Chaos und der Panik der Explosion das Bild von der Wand und flieht mit diesem in eine ungewisse Zukunft. Das verstörte Kind wird von einem Ort zum anderen gereicht, seine einzige Konstante ist der Distelfink. Das kleine Bild ist Millionen wert, was ihm aber (noch) nicht klar ist. Für ihn ist es die letzte Verbindung zur Mutter, sein Trost inmitten seines von Einsamkeit und Verlassenheit geprägten Lebens.
Einen Teil seiner Jugendjahre verbringt er in der surrealen Wüste unweit von Las Vegas. Dort lernt er den charismatischen, furchtlosen aber auch unzuverlässigen Ukrainer Boris kennen. Durch Boris erfährt Theo erstmals wieder ein Gefühl der Zugehörigkeit und Anerkennung, allerdings um den Preis einer nicht mehr endenden Sucht nach der Welt halluzinierender Drogen, in die Boris ihn mitnimmt. Es entwickelt sich eine Freundschaft, die Theos Leben bestimmen und überschatten wird. Boris Hang zur selbstverliebten Selbstzerstörung führt trotz mancher Wendungen, die die Handlung noch zurück ins Gute hätte führen können, zur Katastrophe. Wenn überhaupt etwas die mittlerweile erwachsenen Männer aus dieser Katastrophe herausholen kann, wird es die Liebe zur Kunst und zu Geschichten sein. Nur dieser “polychrome Rand zwischen Wahrheit und Unwahrheit” macht es ihnen “überhaupt erträglich, hier zu sein.” “Unheil und Katastrophen sind diesem Gemälde durch die Zeiten gefolgt, aber auch die Liebe.” Und so fügt Theo Decker seine Geschichte den “Geschichten der Menschen hinzu, die schöne Dinge geliebt und auf sie geachtet haben, […] die sie buchstäblich von Hand zu Hand weiterreichten, strahlend singend aus den Trümmern der Zeit zur nächsten Generation von Liebenden und zur nächsten.”
Wie schon die geheime Geschichte ist auch der Distelfink getragen von Donna Tartts einzigartigen, unverwechselbaren Art zu erzählen. Sie erzählt leichtfüßig, manchmal bewusst lakonisch, um ihrer Erzählung das Schwere, die Tiefe zu nehmen. Doch so leicht man das Buch auch liest, so schwer hallt es nach, so schwer ist es zu ertragen. Auf der einen Seite ist es ein trauriges Buch, das auf die so banale wie bittere Wahrheit “aus diesem Leben kommt keiner lebend raus” hinausläuft. Auf der anderen Seite vermag das Buch auch Hoffnung geben. Nie wurde schöner klar, warum die Unsterblichkeit der Kunst solch ein Trost sein kann. Die Kunst zeigt uns “dass das Schicksal grausam ist, aber nicht beliebig” und dass das unausweichliche Gewinnen des Todes nicht bedeuten muss, dass “wir um Gnade winseln müssen. Es ist unsere Aufgabe, geradewegs hindurchzuwaten, mitten durch die Jauchegrube und dabei Augen und Herz offen zu halten” damit die “Gegenwart eine strahlende Scherbe der Vergangenheit in sich tragen kann”. Schlussendlich sind es die buntesten Exzentriker aus dem Distelfinken, die den Leser mit der tröstlichen Gewissheit entlassen, “dass es zwischen der Realität auf der einen Seite und dem Punkt, an dem der Geist die Realität trifft” “eine mittlere Zone, einen Regenbogenrand”,gibt, “wo die Schönheit ins Dasein kommt, das ist der Raum, in dem alle Kunst existiert und alle Magie.” Kunst als Magie, die den Tod und allem Kummer überwindet.
Der Distelfink ist aber nicht nur eine Reflexion über den Trost der Kunst, es ist auch ein Buch über Verlust, Obsession, Lebenskraft und die gnadenlose Ironie des Schicksals und vor allem über die Freundschaften, die all das mit sich bringen. Theo Decker hat sich nie von dem frühen, seine Welt erschütternden Ereignis der Explosion im Museum erholt, und es sind seine Freundschaften gewesen, die ihn bei aller zerstörerischen Kraft überhaupt am Leben erhalten haben. Und so endet dieses Buch in einem schon fast pilosophischen Diskurs nicht nur über die Macht der Kunst und der Freundschaft, sondern auch übergeordnet in der Frage, ob aus Gutem Böses erwachsen kann und umgekehrt.
Der Distelfink ist ebenso wie die geheime Geschichte eine uralte, sich über die Jahrhunderte immer wieder wiederholende Geschichte, aber trotzdem ein klarer Gegenwarts-Roman. Der Vergleich mit einem anderen Buch der jüngeren Zeit drängt sich auf und es bleibt nur ein Schluss: Der Distelfink ist das, was Bonita Avenue gerne gewesen wäre. Anders als Peter Buwalda traut Donna Tartt ihren Lesern aber einiges zu. Risikofreudiger als sie kann man keine Bücher schreiben. Angefangen davon, wie unbeeindruckt sie sich die Zeit nimmt, die sie für ihre Bücher braucht bis hin zum Anfang des Buches, wo sich ein völlig kaputter Erzähler schon bald als Mörder entpuppt. Donna Tartt schreibt nicht, um Erwartungen zu erfüllen, sie schreibt, um ihre Geschichten zu erzählen. Man möge ihr folgen oder es lassen.
Ich empfehle dringend: Folgen und sich auf die Geschichte einlassen, auch wenn es nicht einfach ist. Und wer die geheime Geschichte noch nicht kennt: Dringend nachholen.
Sehr dringend.
Diskussion dieser Rezension im Blog der Literaturzeitschrift.
Die Analphabetin, die rechnen konnte

Die Analphabetin die rechnen konnte von Jonas Jonasson
Gibt es ein besseres Konzept für einen Autor, als ein überaus erfolgreiches Konzept – in diesem Fall das des Welt-Bestsellers »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand« – zu wiederholen? Dan Brown macht es, John Grisham zelebriert es bis zur Perversion, und auch Jonas Jonasson strickt seinen zweiten Roman über eine Analphabetin so wie seine überaus erfolgreiche Nummer Eins.
Jonasson schildert den sagenhaften Aufstieg von Nombeko, einem kleinen schwarzen Mädchens aus Soweto. Die Analphabetin startet als Latrinenausträgerin, wird bald Chefin aller Scheiße-Schlepper, dann eine Art wissenschaftliche Hilfskraft und beendet schließlich ihre wundersame Laufbahn als Botschafterin Schwedens in Südafrika. Ihre besten Freundinnen sind drei chinesische Schwestern, die Kunst fälschen und Hunde vergiften.
Die Schicksalsgeschichte der pfiffigen Schwarzen wird mit viel Humor und diversen satirischen Seitenhieben auf politische Konstellationen erzählt. Parallel beschreibt der Autor das Leben eines schwedischen Zwillingspaares. Dies wiederum wird von einem schwärmerisch monarchistisch eingestellten Vater erzogen, der irgendwann anfängt, den König als Objekt seiner Anbetung zu hassen und zum Republikaner umschwenkt.
Natürlich laufen die beiden Erzählstränge ineinander und die Geschichte kulminiert in Schweden. Mordende Agenten vom Mossad sind auf ihren Spuren, denn Nombeko hat eine Atombombe im Gepäck, die in Südafrika vom Laster fiel. Sie gilt es, loszuwerden. Die tumbe schwedische Polizei bekommt dabei ebenso ihr Fett ab, wenn sie ein angeblich besetztes Haus stürmt wie das Schwedische Königshaus und die herrschende Politik.
Insgesamt beschert es erneut großes Vergnügen, Jonas Jonasson zu lesen. Es ist dabei müßig, lange abzugleichen, ob sein zweiter Roman an die Stärke seines weltbekannten Erstlings heranreicht. Nein, er reicht nicht daran, denn schon die Ausgangsgeschichte ist sehr viel ernster und sozialkritischer als die Slapstick-Komödie des »Hundertjährigen«.
Der Autor versteht es dafür ausgezeichnet, Realitäten ins Abstruse zu überdrehen und Situationen derart zu überzeichnen, dass der Leser sich vor Lachen schütteln kann, ohne dabei den politischen Wahnsinn beispielsweise des afrikanischen Apartheid-Regimes zu übersehen.
Ein amüsantes, flott geschriebenes Buch für intelligente Leser.
WERBUNG[amazon_link asins=’3328100156′ template=’ProductCarousel’ store=’literaturzeit-21′ marketplace=’DE’ link_id=’fa038598-af71-11e8-bdd5-cdc24497d9ab’]
F
F. Ein einziger Buchstabe. So viele Interpretionsmöglichkeiten. So viele Fehlinterpretationsmöglichkeiten. So viele wie das Leben. F – mit diesem simplen Buchstaben ist Daniel Kehlmanns neuer Roman betitelt.
 F wie Familie? Wie Fatum (lateinisch für Schicksal)? Wie Fälschung, wie Fiktion oder doch F für das berüchtigte, mittlerweile aber selbst in US-Diplomatinnen-Kreisen gebräuchliche Fuck? Vielleicht aber auch nur für den Namen Friedland, den Namen der Familie, die im Mittelpunkt des Romans steht.
F wie Familie? Wie Fatum (lateinisch für Schicksal)? Wie Fälschung, wie Fiktion oder doch F für das berüchtigte, mittlerweile aber selbst in US-Diplomatinnen-Kreisen gebräuchliche Fuck? Vielleicht aber auch nur für den Namen Friedland, den Namen der Familie, die im Mittelpunkt des Romans steht.
Daniel Kehlmann jedenfalls steht nach seinem Sensationserfolg “Die Vermessung der Welt” sofort im Mittelpunkt des Interesses, wenn er einen neuen Roman veröffentlicht. Die Ansprüche, die an ihn gestellt werden, sind immens. Man möchte nicht in seiner Haut stecken, wenn man liest, wie sich die Kritikerszene mit ihm auseinandersetzt. Für die Feuilletonisten muss es bei Kehlmann ja unbedingt der ganz große Wurf sein, der nächste Welterfolg, die nächste Sensation. Dass auch Daniel Kehlmann vielleicht einfach nur erzählen möchte, wird nicht goutiert. Umso bemerkenswerter, dass er es tut. Einfach nur erzählen.
In F erzählt er zunächst von Arthur Friedland, einem bisher glücklosen Autor, der auf den ganz großen Wurf wartet. Erst die Begegnung mit einem Hypnotiseur verändert sein Leben und das seiner Söhne gleich mit. Arthur entzieht sich allen Erwartungen und Verantwortlichkeiten und schafft fernab von diesen seinen großen Wurf. Doch um Arthur geht es in F nur am Rande. Erzählt wird im weiteren Laufe des Romans die Geschichte seiner Söhne.
Diese treffen wir im Sommer vor der Wirtschaftskrise wieder. Jeder der drei Brüder ist auf seine eigene Weise ein Betrüger, Lügner, Fälscher. Wirklich Großes werden sie nicht leisten in ihrem Leben. Weder der ungläubige Priester Martin, weder Eric, der als Vermögensberater den Versuchungen eines Schneeballsystems erliegt und dem die Krise als willkommene Ausrede dient, noch Iwan, der Kunstkenner, der das Falsche im Echten verwaltet.
Kehlmann erzählt vom üblichen Leben, vom Mittelmaß, über das so viele nicht hinauskommen. Und wenn, dann nur in seltenen Momenten wie der Hypnotiseur, der auch noch ausgerechnet den Namen Lindemann trägt. Ein Name, der seit Loriot der Inbegriff spießigen Mittelmaßes ist. Dieser Hypnotiseur ist eigentlich der sprichwörtliche Ritter von der traurigen Gestalt. Einzig im Zusammentreffen mit Arthur und seinen Söhnen läuft er zur Hochform auf und so bleibt wenigstens ihm in fremden Leben der zweifelhafte Ruhm des Schicksal-Auslösers.
Daniel Kehlmann erzählt manchmal lakonisch, manchmal empathisch von den Schicksalen seiner Protagonisten, immer aber elegant, leicht und kraftvoll zugleich. Manchmal funkelt listige Bosheit durch, gehässig aber wird er nie. Wie sein Titel ist der Roman vielfältig deutbar, nur zwei Dinge sind am Ende des Romans klar: Das Leben ist und bleibt ein unlösbares Rätsel und Daniel Kehlmann ist ein Autor, der Unterhaltung auf höchstem Niveau bietet.
F wie Familie? Wie Fatum? Wie Fälschung, wie Fiktion, wie Fuck? Letztendlich ist es völlig egal, wofür das F nun steht. Jeder mag in diesen kleinen Buchstaben selbst hineinprojezieren, was ihm wichtig ist. Genauso wie in sein eigenes kleines Leben. Und mit etwas Glück bleibt jeder selbst von all diesen Projektionen so unbeeindruckt wie Daniel Kehlmann. Ihm und seinen Lesern ist es zu wünschen.
Montags sind die Eichhörnchen traurig
 Happy End. Die Guten haben ein verdient gutes, die Bösen ein verdient böses Ende bekommen. Alle sind glücklich.
Happy End. Die Guten haben ein verdient gutes, die Bösen ein verdient böses Ende bekommen. Alle sind glücklich.Bis auf die Eichhörnchen und den Leser.
Nachdem wir 2011 die Welt mit den gelben Augen der Krokodile sahen und 2012 den langsamen Walzer der Schildkröten tanzten, ist der Leser in diesem Jahr nun mit den Eichhörnchen traurig. Traurig aus nur einem einzigen Grund: Weil er sich mit dem dritten Band der Josephine-Trilogie, mit der sich die französische Überraschungs-Erfolgsautorin Katherine Pancol in die Herzen von Millionen Lesern geschrieben hat, von liebgewonnenen Charakteren und wundersamen Geschichten verabschieden muss.
Aber vor die Trauer hat die Autorin das Lesen gestellt. Und zum dritten Mal in Folge enttäuscht sie nicht, wird den mittlerweile hoch geschraubten Erwartungen gerecht. Die ersten Rezensionen des dritten Teils, die im letzten Jahr aus Frankreich rüberschwappten, waren nicht eindeutig positiv. Keine Ahnung warum, vielleicht ist auch einfach mein Französisch zu schlecht. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall wiederum keine 20 Seiten Lektüre gebraucht, um vollends in den Bann der Geschichte gezogen zu sein und am liebsten die ganzen 823 Seiten in einem einzigen Rutsch zu lesen. Eichhörnchen sind zwar keine Schildkröten, aber Walzer tanzen können sie auch.
Einmal noch dürfen wir ein Wiedersehen mit der ganzen verrückten Sippschaft feiern. Diesmal steht kein einzelner Protagonist im Vordergrund, allen Charakteren wird gleichberechtigt Raum gegeben, alle Handlungsstränge werden zusammengeführt – schließlich ist es ja auch eine erkleckliche Menge an Geschichten, die zu Ende erzählt werden wollen, auf deren Inhaltsangabe hier aber aus Gründen des Lesevergnügens weitestgehend verzichtet wird.
Zu Beginn des dritten Teils spürt man die Nachbeben der schrecklichen Ereignisse, mit denen Band zwei endete. Die Wogen sind noch lange nicht geglättet, aber sie sind dabei, abzuebben. Josephine durchquert noch einmal ein Tal der Tränen, bevor sie zu sich selbst und ihren Bedürfnissen findet, als Vorbild dient dabei durchaus ihre ehrgeizige Tochter Hortense, der der Erfolg Recht gibt. Shirley muss sich von ihrem Sohn Gary abnabeln und umgekehrt, ihre verrückte Geschichte und das, was diese Geschichte mit ihr gemacht hat, bekommt breiten Raum. Nicht fehlen darf natürlich auch der naseweise Junior, seine knuddeligen Eltern und schon mal gar nicht die abgrundtief böse Mutter Josephines.
Es bleibt beim Charakter eines modernen Märchens. Ausgiebig wird wieder Stellvertreter-Gerechtigkeit geübt, die böse Hexe wird zwar nicht auf den Scheiterhaufen, aber immerhin aus ihrer Wohnung gezerrt. Einige wenige neue Figuren werden sparsam eingeführt, gerade diese tragen aber zur Katharsis bei. So wie Josephines ehrgeizige Tochter Hortense unermüdlich auf der Suche nach dem gewissen Etwas ist, so ist es auch die Autorin. “Manche Menschen leben wie hinter einem Nebelschleier und dieser Schleier muss sich erst heben. Aber alle haben – auch ohne es zu wissen – einen Platz hinter dem Nebel.”
Katherine Pancol hat ihren ganz eigenen, sehr besonderen Stil. Sie liebt Sprache und behandelt diese genauso sorgfältig wie ihre Charaktere und Geschichten. Man merkt, dass die Autorin sich viel Arbeit mit ihren Büchern macht. Bei aller Phantasie sind ihre Bücher immer sorgfältig recherchiert, die Geschichten an keiner Stelle hingeschludert. Wohlgemerkt, viel Arbeit! Keine Mühe. An den Worten, die sie Josephine über das Schreiben in den Mund legt, merkt man deutlich, wie viel Freude die Autorin an ihren Figuren und ihrer Erzählung hat. Genau dieses Fehler jeglicher Last zeichnet Pancols Schreibstil aus. Die Bücher – insgesamt fast zweieinhalbtausend Seiten – wirken an keiner Stelle bemüht, ihre Sätze sind mit leichter, froher Feder geschrieben. An keiner Stelle gibt sie dem heute üblichen Drang, alles zu verdichten, nach und gibt ihrer Geschichte Raum und Zeit. Ich bleibe dabei: eine Scheherazade im besten Sinne.
Fazit: Alle drei Bände dieser außergewöhnlichen Trilogie sind ein seltener Glücksfall für alle, die Schmöker lieben. Selten noch hat man so mitreißend über Erfolg, Demut, Lügen, Verrat, Familien, die Liebe und das Leben gelesen.
Kleine Bemerkung am Rande: Meiner Meinung nach eignen sich alle drei Bände außerordentlich gut für Lesekreise. Ich habe alle Bände zeitgleich mit einer Freundin gelesen und sich über die verschiedenen Charaktere und ihre Entwicklung auszutauschen, war noch einmal ein Extra-Vergnügen für sich.
Diskussion dieser Rezension im Blog der Literaturzeitschrift


