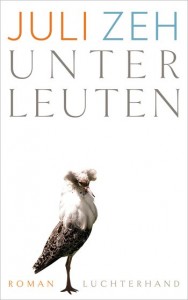 “Mit Unterleuten habe ich alles gegeben, was ich konnte, um einen Gesellschaftsroman für unsere Zeit zu schaffen.”* – So die hochgelobte, hochdekorierte Schriftstellerin Juli Zeh über ihren Roman “Unterleuten“. Keine Frage: so eine Ankündigung – demütig und selbstbewusst zugleich – macht neugierig. Ungemein neugierig. Auch wenn man bisher nicht gerade als großer Fan der Autorin aufgefallen ist. Das Fazit vorab: Juli Zeh hat das Genre Gesellschaftsroman zwar nicht neu erfunden, aber sie hat es neu belebt. “Unterleuten” ist ein großartiger Gesellschaftsroman, einen besseren hat es in Deutschland lange nicht gegeben.
“Mit Unterleuten habe ich alles gegeben, was ich konnte, um einen Gesellschaftsroman für unsere Zeit zu schaffen.”* – So die hochgelobte, hochdekorierte Schriftstellerin Juli Zeh über ihren Roman “Unterleuten“. Keine Frage: so eine Ankündigung – demütig und selbstbewusst zugleich – macht neugierig. Ungemein neugierig. Auch wenn man bisher nicht gerade als großer Fan der Autorin aufgefallen ist. Das Fazit vorab: Juli Zeh hat das Genre Gesellschaftsroman zwar nicht neu erfunden, aber sie hat es neu belebt. “Unterleuten” ist ein großartiger Gesellschaftsroman, einen besseren hat es in Deutschland lange nicht gegeben.
Nicht weniger als 11 Hauptpersonen gönnt sich Juli Zeh für ihren Roman, die einzelnen Kapitel sind aus den unterschiedlichen Perspektiven dieser Personen erzählt. Dazu kommt die übergeordnete Erzählerin, die sich erst im letzten Kapitel zeigt und die Geschehnisse resümiert. (Dies im übrigen die einzige Meta Ebene, die sich im Buch selber findet. Aber nicht die einzige Meta Ebene im Zusammenhang mit diesem Buch, wie sich nach Veröffentlichung zeigte. Doch dazu später.)
Das Geschehen spielt im fiktiven Dorf mit doppeldeutigem Namen: “Unterleuten” in Brandenburg, gar nicht weit weg von Berlin, aber doch eine ganz andere Welt. Unberührte Natur, seltene Vogelarten, Pittoreske pur, aber die Idylle täuscht. Das Dorf wird beherrscht von einem unsichtbaren und nur den Alteingesessenen verständlichen und für sie logischen Beziehungsgeflecht, welches die Geschicke der Dorfbewohner maßgeblich bestimmt. Sie wissen genau, wer wem einen Gefallen schuldet, nutzen diese als die eigentliche Währung, die in Unterleuten zählt und schaffen so eine Art rechtsfreien Raum. So haben sie es in der DDR gehalten, so halten sie es heute.
Zugezogene Stadtflüchtige wie der Vogelschützer Gerhard Fließ und seine kleine Familie haben es da schwer. Dabei wollen sie doch eigentlich nur der Tochter ein unbeschwertes Leben auf dem Lande ermöglichen und der ihnen “heilige Aufgabe” nachgehen, “das Bestehende gegen die psychotischen Kräfte eines überdrehten Fortschritts zu verteidigen“. Sie wollen ihr bisheriges Leben hinter sich lassen, anstatt an ihm zu verzweifeln. Kaschieren durch geschickte Deko aber lediglich, dass sie in diesem Leben noch nichts wirklich auf die Beine gestellt haben. Nun sitzen sie bei Tag und Nacht hinter runtergelassenen Rollos, weil ihr Nachbar unablässig giftigen Müll auf seinem Schrottplatz verbrennt. Sie wissen weder, warum er es tut – vielleicht als Strafe für etwas, das sie getan haben, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein – noch, wie sie es stoppen können.
Besser arrangiert sich da die Pferdeflüsterin Linda Franzen, die in Unterleuten ein Gestüt von internationalem Renommee aufbauen will, widerwillig unterstützt von ihrem Lebensgefährten, der eigentlich lieber in der Küche eines Berliner Start-Ups sitzt und Computerspiele entwirft. Linda orientiert sich am Werk des Motivators Manfred Gortz “Mein Erfolg” und handelt ganz nach der Maxime “Wer eine Situation inszeniert, ist ihr Herr”. Die Widerstände um sie herum lassen sie völlig unbeeindruckt, ihre Nachbarn hält sie für Menschen, die noch während des Weltuntergangs die Ellenbogen auf die Gartenzäune stützen und Sätze wie “irgendwas ist immer” sagen.
In diese fragile Gesellschaft fällt eines Tages eine der gefürchteten “Heuschrecken” ein. Einen Windpark will der Investor errichten, für einige winkt schneller Reichtum. Schnell bekommen die potentiellen Verkäufer der geeigneten Grundstücke den Hass der Dorfbewohner gratis dazu. Die Zugezogenen erkennen die schon in der Großstadt verhassten Mechanismen wieder und stellen sich gegen diese “sich selbst subventionierende Gutmenschenbürokratie“, die Alteingesessenen wehren sich dagegen, dass die Randgebiete “zur Rumpelkammer der Zivilisation” verkommen.
“Unterleuten” stellt die große Frage unserer Zeit: Gibt es noch, kann es noch ein Miteinander, eine Moral geben jenseits von Eigeninteresse? Das Dorf dient dabei als komprimierter Mikrokosmos, die handelnden Personen sind examplarisch und lassen sich überall beobachten – ebenso wie die immer größere Geringschätzung von Prinzipien und moralischen Werten. Sie alle sind getrieben von Verlustängsten, sie fürchten ihre Tradition, ihre Heimat zu verlieren und haben doch allzu oft einfach nur Angst vor Veränderung. Für sie bedeutet Veränderung in erster Linie “Ungeheuerlichkeiten in immer neue Gewänder zu kleiden“. Am Ende kämpft in Unterleuten jeder für sich – allen geschlossenen Allianzen zum Trotze. Sie alle wollen immer nur “das Beste”, doch alleine die Frage danach, was denn “das Beste” sei, bringt das Schlimmste in den Menschen hervor. Es geht in “Unterleuten” nur vordergründig darum, wie schnell der Traum vom Landleben zum Albtraum wird oder um den ewig schwelenden Konflikt zwischen Wendegewinnern und Wendeverlierern. Juli Zeh zeigt mustergültig, wie ungeheuer fragil ein Miteinander ist und wie schnell es bedroht wird, ja sogar in Gewalt zu eskalieren droht, wenn Einzelne ihre Interessen bedroht sehen.
Die Thematik und die Handlung erscheinen auf den ersten Blick als Lesestoff schwer verdaulich. Doch weit gefehlt: Selten so gut auf so hohem Niveau unterhalten worden. Juli Zeh hat einen formidablen Rundumschlag geschafft. Kaum ein Thema unserer Zeit, welches nicht Eingang in den Roman gefunden hat. Umso bewundernswerter die Leichtigkeit, mit der Juli Zeh all das komprimiert und spannend erzählt. Trotz der dauernden Perspektivwechsel treibt die Autorin ihre Handlung entschlossen voran. Überhaupt – diese Perspektivwechsel. Sie gelingen Juli Zeh außerordentlich gut, mit einer ganz erstaunlichen Konsequenz zeigt sie kompromisslos die Sichtweise jedes einzelnen Charakters. Jedes Kapitel, jede Perspektive ist in sich schlüssig, der Leser bringt all ihren Protagonisten das gleiche Verständnis und gelegentliche Unverständnis entgegen. Was den Leser zum Schluss in sicher gewollter Verwirrung verharren lässt. Jeden konnte man verstehen in seinen Beweggründen und man selbst kann die Frage nicht beantworten, zu wem man gehalten hätte. Aber man kann die verstehen, die sich scheuen, die “toxische Frage nach Schuld oder Unschuld” zu stellen. Juli Zehs Kunstgriff ist, sich selbst sich jeden Urteils zu enthalten. Sie wertet nicht, weder Charakterzüge noch Beweggründe, sie erzählt es “nur”. Dies aber anteilnehmend, mitfühlend, verständnisvoll, keine menschliche Neigung ist ihr fremd.
Wenn man überhaupt etwas an “Unterleuten” richtig schlecht findet, dann dies: Der Roman ist so rund in sich abgeschlossen, dass eine Fortsetzung wohl undenkbar ist. Leider. Aber – um nun zurückzukommen auf die auf den ersten Blick und bei bloßer Lektüre des Buches nicht erkennbaren Meta-Ebenen – man kann sich ganz prima noch eine Weile nach Lektüre in den Weiten des world wide web und in diversen Feuilletons amüsieren ob der Frage nach Schein oder Sein oder Nichtsein: Denn natürlich muss man als begeisterter Leser nach Lektüre erstmal schauen, ob es das von Linda Franzen so episch zitierte Werk des Manfred Gortz überhaupt gibt. Es gibt es. Irritiert fragt man sich aber doch, ob Juli Zeh neben all ihren anderen Fähigkeiten auch das Talent zur Zeitreise entdeckt hat. Ist “Mein Erfolg” doch erst 2015 erschienen und Juli Zeh hat nach eigenem Bekunden über 10 Jahren mit Unterbrechungen an “Unterleuten” gearbeitet. Wie kann sie da dauernd dieses Werk zitieren? Oder hat sie auf den letzten Metern alles kurzentschlossen umgeschrieben?
Und überhaupt! Ist das nicht schon nahe dran an Copy and paste? Hat Juli Zeh etwa plagiiert? Das frage nicht ich, das fragten aufgeregt diverse renommierte Feuilletonisten. Derweil twittert Manfred Gortz genüßlich vor sich hin, veröffentlicht auf Youtube eine Stellungnahme – den Schal passend zur Gesichtsfarbe – und zeigt sich ganz und gar entzückt davon, von Juli Zeh so expressiv zitiert worden zu sein. Man will ja auch den Verlagsfrieden nicht stören, ist “Mein Erfolg” doch unter demselben Dach wie “Unterleuten” erschienen. Blöd nur, dass er Interviews nur per Mail gibt, dabei auch noch mit einiger Chuzpe “Cybris” (ein Fake von Sascha Lobo und Volker Weidermann, welches für etliche Schlagzeilen sorgte) als Lieblingsbuch empfiehlt und trotz aller investigativer Bemühungen diverser Rechercheure keiner zu finden ist, der Manfred Gortz jemals kennengelernt hat, geschweige denn eines seiner Seminare besucht hat.
Dazu kommen die Webseiten des Vogelschutzbundes Unterleuten mit der Überschrift “Bei uns piept’s” und die Seite des Unterleutener Gasthauses Märkischer Landmann, der gerade Fischeintopf im Angebot hat. Ins Impressum der Webseiten guckt man dabei besser nicht. Denn – will man es wirklich so genau wissen? Will man zum “Killjoy” werden, jener Typus, den Linda Franzen und Manfred Gortz so verachten – der Typ, der anderen den Spaß verdirbt, weil er selbst keinen hat. Nein, das will man nicht. Den Spaß an Unterleuten verlängert die Websuche allemal. Zitieren wir die Autorin ein letztes Mal: “ich dachte, alles was im Internet steht, existiert auf alle Fälle“. Ein Schelm, der bei dem Ganzen an eines der frühen Werke Juli Zehs denkt: Spieltrieb.
Prädikat: Unbedingt empfehlenswert! Lesen! Stellt sogar Leute zufrieden, die die Buddenbrooks für das Maß aller (Gesellschaftsroman)-Dinge halten.
*Zitat Juli Zeh im Interview des Buchjournal eins.2016 des deutschen Buchhandels
 In »Kaffee und Zigaretten« sammelt Ferdinand von Schirach 48 Gedankenschnipsel. Diese könnten aus Tagebüchern stammen oder als kurze Beobachtungen aufgezeichnet worden sein.
In »Kaffee und Zigaretten« sammelt Ferdinand von Schirach 48 Gedankenschnipsel. Diese könnten aus Tagebüchern stammen oder als kurze Beobachtungen aufgezeichnet worden sein. Was liest du demnächst?
Was liest du demnächst? Geschichte ohne Fazit
Geschichte ohne Fazit Anspruchsvolle literarische Nische
Anspruchsvolle literarische Nische Mit Oma im Drachenhort
Mit Oma im Drachenhort Der Leser als literarischer Großinquisitor
Der Leser als literarischer Großinquisitor Auf Kolportage-Kurs
Auf Kolportage-Kurs Gescheit gescheitert
Gescheit gescheitert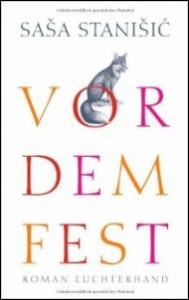 Ohne Abgang
Ohne Abgang Faszinierende Vita eines Politlyrikers
Faszinierende Vita eines Politlyrikers Mythischer Determinismus
Mythischer Determinismus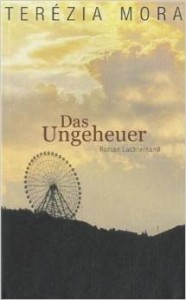 On the Road mit Urne und Laptop
On the Road mit Urne und Laptop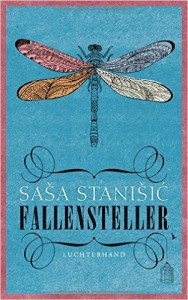 Katzenjammer inklusive
Katzenjammer inklusive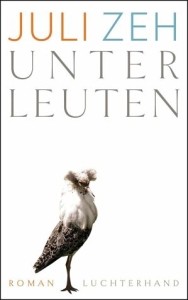 Lucy Finkbeiner lässt grüßen
Lucy Finkbeiner lässt grüßen
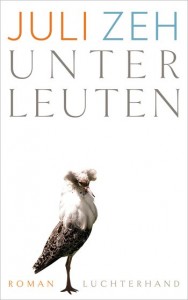 “Mit Unterleuten habe ich alles gegeben, was ich konnte, um einen Gesellschaftsroman für unsere Zeit zu schaffen.”* – So die hochgelobte, hochdekorierte Schriftstellerin Juli Zeh über ihren Roman “Unterleuten“. Keine Frage: so eine Ankündigung – demütig und selbstbewusst zugleich – macht neugierig. Ungemein neugierig. Auch wenn man bisher nicht gerade als großer Fan der Autorin aufgefallen ist. Das Fazit vorab: Juli Zeh hat das Genre Gesellschaftsroman zwar nicht neu erfunden, aber sie hat es neu belebt. “Unterleuten” ist ein großartiger Gesellschaftsroman, einen besseren hat es in Deutschland lange nicht gegeben.
“Mit Unterleuten habe ich alles gegeben, was ich konnte, um einen Gesellschaftsroman für unsere Zeit zu schaffen.”* – So die hochgelobte, hochdekorierte Schriftstellerin Juli Zeh über ihren Roman “Unterleuten“. Keine Frage: so eine Ankündigung – demütig und selbstbewusst zugleich – macht neugierig. Ungemein neugierig. Auch wenn man bisher nicht gerade als großer Fan der Autorin aufgefallen ist. Das Fazit vorab: Juli Zeh hat das Genre Gesellschaftsroman zwar nicht neu erfunden, aber sie hat es neu belebt. “Unterleuten” ist ein großartiger Gesellschaftsroman, einen besseren hat es in Deutschland lange nicht gegeben.