 In »Wackelkontakt« präsentiert der 1960 geborene österreichische Schriftsteller Wolf Haas eine raffinierte und verschachtelte Erzählstruktur, die zwei scheinbar getrennte Geschichten kunstvoll miteinander verwebt. Weiterlesen
In »Wackelkontakt« präsentiert der 1960 geborene österreichische Schriftsteller Wolf Haas eine raffinierte und verschachtelte Erzählstruktur, die zwei scheinbar getrennte Geschichten kunstvoll miteinander verwebt. Weiterlesen
Archiv
Wackelkontakt
Die Verdorbenen
 Die Verdorbenen. Eine klassische Ménage-à-trois ist die Beziehung zwischen Johann, dem Protagonisten und dem Paar Tommi und Christiane. Eigentlich beginnt alles ganz harmlos, doch dann gesellt sich zu Liebe, Lust und Spiel auch das Böse.
Die Verdorbenen. Eine klassische Ménage-à-trois ist die Beziehung zwischen Johann, dem Protagonisten und dem Paar Tommi und Christiane. Eigentlich beginnt alles ganz harmlos, doch dann gesellt sich zu Liebe, Lust und Spiel auch das Böse.
Des Vaters Liebe zum Leben
“Einmal im Leben möchte ich einen Mann töten“, sagt der junge Johann zu seinem Vater, der alles liebte. “Aber es war etwas das man nicht sagen, das man nur denken darf.” Und so schweigt Johann lieber und hofft, das sein Vater die Frage wieder vergisst. Der Dolmetscher, der mit einer Engländerin verheiratet ist, schreibt selbst und liebt das Leben über alles. “Er liebte die Bücher, er liebte die Vögel, er liebte die Musik, den Sternenhimmel, den Föhn im Frühling, frische Honigsemmeln zum Frühstück, er liebte seine Frau und er liebte seinen Sohn – er liebte, und wenn er nicht liebte, war er nicht.” Wie konnte dieser Vater einen so missratenen Sohn zeugen oder aufziehen? Lag es an der Frage, ob er jemanden habe, dass dies alles auslöste?
Liebe zu dritt: “Das ist Hippieshit“
Denn Johann fühlt sich unter Druck, eine Freundin zu haben und dringt so in die Paarbeziehung zwischen Tommi und Christiane. Aber eigentlich ist es Christiane, die sich vor ihm auszieht. Ein harmloser Spaziergang um einen Teich wird zum Beginn einer einseitigen Liebesgeschichte und der Zerstörung einer anderen. Mit 22 Jahren studiert Johann in Marburg an der Lahn und lernt, dass Freud einen Mangel an Scham als ein Zeichen von Schwachsinn bewertet habe. Dass ihm die “prächtige Herrschaft” über sein Leben entgleiten könnte, das wäre ihm nicht in den Sinn gekommen. Aber als er entdeckt, dass Tommi und Christiane ihre “Doktorspiele” schon seit sie neun sind spielen, braucht er ein Ventil und reist per Anhalter an die Nordsee. “I shot a man in Reno just to watch him die“, zitiert der Autor Johnny Cash’s Folsom Prison Blues. Gut gepasst hätte aber auch Stereo Total: Liebe zu dritt, das ist Hippieshit.
Hänsjes Krankheit
Dort geschieht plötzlich das Unbeschreibliche. Köhlmeier beschreibt es. “Wo das Leben nur mehr aus Langeweile besteht, ersetzen die Erinnerungen die Taten.” In einer Mischung aus Selbsthass, Wut aber auch Langeweile und dem existentialistischen Ennui tötet er tatsächlich einen Menschen, auch wenn es wie Notwehr erscheint. “Manchmal mitten am Tag, ergriff mich ein ungewisses Entsetzen vor dem Tod. (…) Dann Resignation, und hinter mir wartete die Langeweile.” In drei Kapiteln und einem Epilog vierzig Jahre später erzählt Michael Köhlmeier die Geschichte des unschuldigen, aber verdorbenen Johann, der sich durch die Liebe von Christiane so eingeengt fühlt, dass er einen verzweifelten Ausbruch sucht. Stets seinen “Zarathustra” in der Tasche und mit klassenkämpferischer Miene und schwarzer Lederkleidung hat er in den vom Kommunismus und der Ölkrise inspirierten Siebzigern keine Ahnung vom Klassenkampf oder von der Liebe.
Obsessive Liebe als Brutstätte des Bösen
Zu selbstbezogen und immer mit seiner eigenen Nabelschau beschäftigt, verliert er den Boden unter den Füßen und die Augen im purpurnen Meer. Michael Köhlmeier hat mit “Die Verdorbenen” einen autofiktionalen Roman geschrieben, der die Frage stellt, was aus ihm geworden wäre, wenn er der Obsession einer anderen Frau nachgegeben hätte. Eine Miniatur über die Liebe, ihre Besitzansprüche, Auswüchse und nicht zuletzt auch ihre Nestwärme der Brutalität. Denn oft erwächst das wirklich Böse aus schlecht kommunizierter Liebe. Oder Lust. Meisterlich geschrieben regt auch dieser Roman von Michael Köhlmeier zum Nachdenken an und verführt zur Rekapitulation seiner Erinnerungen. Zwischen “Die Träumer” und “Der Fremde” eine Erkundung des Bösen.
Michael Köhlmeier
Die Verdorbenen. Roman
2025, Hardcover, 160 Seiten
ISBN 978-3-446-28250-6
Hanser Verlag
23,00 €
Juli, August, September
 Juli, August, September. “Der Russe ist einer, der Birken liebt” war ihr Debüt, 2012, seither sind auch andere Bücher von dieser Autorin erschienen, die derzeit als Professorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien unterrichtet. Die in Baku, Aserbaidschan Geborene lebt abwechselnd auch in Polen, Russland, der Türkei, den USA und Israel. Ihre Werke, ein Essay und vier Romane, wurden in 15 Sprachen übersetzt, fürs Radio und die Bühne adaptiert und verfilmt. In ihrem neuen Werk geht es um die liebe Familie und die Protagonistin Lou macht sich auf die Suche nach deren Geheimnissen. Zwischen Berlin, Gran Canaria und Israel.
Juli, August, September. “Der Russe ist einer, der Birken liebt” war ihr Debüt, 2012, seither sind auch andere Bücher von dieser Autorin erschienen, die derzeit als Professorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien unterrichtet. Die in Baku, Aserbaidschan Geborene lebt abwechselnd auch in Polen, Russland, der Türkei, den USA und Israel. Ihre Werke, ein Essay und vier Romane, wurden in 15 Sprachen übersetzt, fürs Radio und die Bühne adaptiert und verfilmt. In ihrem neuen Werk geht es um die liebe Familie und die Protagonistin Lou macht sich auf die Suche nach deren Geheimnissen. Zwischen Berlin, Gran Canaria und Israel.
Die Vergangenheit der Gegenwart
Tante Maya feiert ihren 90. Geburtstag. Sie lädt ausgerechnet auf die touristische Urlauberinsel Gran Canaria ein, weil sie dorthin ein Preisausschreiben gewonnen hat. Alle Familienangehörigen – oder zumindest jene die sich noch dazu zählen – müssen sich nun dort um sie versammeln und ihrer letzten Erzählung lauschen. Denn natürlich will sie sich in ihrem betagten Alter auch verabschieden. Und einiges zurechtrücken. Geschichte wird bekanntlich von den Siegern geschrieben und auch bei Familiengeschichten ist dies nicht anders. Dort schreiben die Überlebenden die Geschichte. Bald kommt Lou nämlich einem Familiengeheimnis auf die Schliche, die ihre andere Tante Rosa, nach der sie auch ihre Tochter benannt hat, betrifft.
Juli, August, September
Die beiden Schwestern Maya und Rosa durchlebten gemeinsam den Krieg und den Holocaust und ihre Nachkommen sollen nun endlich die Wahrheit erfahren, so, wie es wirklich war. Aber die Mutter von Lou ist damit gar nicht einverstanden. Lou selbst durchlebt auf Gran Canaria ihre erste Ehekrise, von der sie selbst nicht sicher ist, ob es sie nun wirklich gibt oder nicht. Denn Sergej ist einfach nur viel unterwegs, als Konzertpianist hat er keine andere Chance. Die Telefongespräche zwischen Salzburg und Gran Canaria verlaufen unbefriedigend. Und bald fragen sie alle, ob sie sich scheiden lassen wolle. Als dann noch ein Interview von Sergej erscheint, scheint das Fass überzulaufen. Lou fliegt nach Israel und begegnet dort ihrer Vergangenheit.
Ehe, Familie und Partnerschaft im 21. Jahrhundert
Es geht viel um die russisch-jüdische Identität, denn ihre Familie stammt eigentlich von Wolgadeutschen der Sowjetunion ab. Im Ausland werden sie dann abwechselnd als Russen oder Juden wahrgenommen, beides führt zu Komplikationen. An einer Stelle spricht sie auch über die “heritazniza”. Sie spreche die russische Sprache zwar nicht perfekt, aber sie löse sehr viel mehr Emotionen bei ihr aus als das Deutsche, so Lou. Besonders für die Kinder ist das Aufwachsen durch solche Zuschreibenden nicht gerade einfach. “In meiner Familie herrschte ein rigider Wettbewerb, wer die erfolgreichsten Kinder hatte. Denn der Erfolg der nächsten Generation war der Gradmesser gelungener Elternschaft.” Aber bald wird Lou konstatieren, dass sie alle versagt hatten. Und über allem liegt dieser feine Staub von Ironie.
Judentum als “kulturelle Performance”
Nicht nur weil sie ihr erstes Kind verloren hatte, sondern auch ihre erste Ehe, fühlt Lou, dass sie keineswegs zu den “Siegern” gehört. Ihr Judentum wäre ohnehin nur mehr eine “kulturelle Performance”, die nicht mal besonders gut sei. Als Lou schließlich entdeckt, dass Hannah, ihre Großmutter, ihre beiden Kinder Maya und Rosa während des Krieges im Stich gelassen hatte und ihr Ehemann als vermeintlicher Deserteur in ein sowjetisches Gefängnis gekommen war, spitzt sich die Handlung zu: “Als ich so alte geworden war, dass mein Erinnerungsvermögen einsetzte, hatte mein Großvater seines verloren“. Olga Grjasnowa erzählt in einer sympathischen, jugendlichen Sprache vom Schicksal aller jener, die durch den Krieg in alle Welt zerstreut wurden und seither versuchen, die verlorenen Teile wieder zusammenzufügen. “Juli, August, September” ist dafür ein guter Anfang.
Olga Grjasnowa
Juli, August, September
Roman
2024, Hardcover, 224 Seiten
ISBN 978-3-446-28169-1
Hanser Berlin
Deutschland: 24,00 €
Österreich: 24,70 €
Nero Corleone. Eine Katzengeschichte
 Nero Corleone. “Es ist wie bei mir“, dachte er, “wir sind gescheite, prächtige Männer von Welt, aber jeder schleppt eben sein Mädchen hinter sich her“, denkt sich der schwarze Kater Nero Corleone und teilt sein Essen mit seiner Rosa. Der von der Schriftstellerin Elke Heidenreich erfundene und von Quint Buchholz liebevoll illustrierte Mäuseschreck ist zwar in Italien geboren, macht aber bald eine große Reise zum Kölner Dom.
Nero Corleone. “Es ist wie bei mir“, dachte er, “wir sind gescheite, prächtige Männer von Welt, aber jeder schleppt eben sein Mädchen hinter sich her“, denkt sich der schwarze Kater Nero Corleone und teilt sein Essen mit seiner Rosa. Der von der Schriftstellerin Elke Heidenreich erfundene und von Quint Buchholz liebevoll illustrierte Mäuseschreck ist zwar in Italien geboren, macht aber bald eine große Reise zum Kölner Dom.
Nero Corleone aus Carlozzo in Köln
“Die Verpflegung war gut, die Zuneigung groß, und vielleicht gab es in Köln am Rhein auch Heu, in dem man schlafen konnte“, träumt Nero und schließt sich den Urlaubern Robert und Isolde gleich mit seiner Rosa an. Denn da wo sie sind, ist es schön, “weil sie da sind“. Die lange Autofahrt gefällt zwar weder Nero noch Rosa, nur, Nero lässt es sich nicht anmerken, schließlich ist er der Kater und somit gebiert er sich als kleiner Macho, der keine Angst vor gar nichts hat. Im Haus seiner beiden neuen Besitzer gibt es viele schöne weiche Teppiche und auch geheimnisvolle Schlupfwinkel in denen man sich notfalls gut verstecken konnte, sollte man es doch einmal mit der Angst zu tun bekommen. Aber bald darf er ohnehin schon in den Garten, denn das allzulange Nachdenken liegt ihm ohnehin nicht so. Er ist ja kein Esel, der die Probleme dieser Welt durch blosses Nachdenken zu lösen versucht. In seiner Nachbarschaft ist er ohnehin bald der Mittelpunkt, der König der Vorstadtstraße. Aber dann geschieht etwas, das auch ein großer Kater wie er nicht ohne weiteres verschmerzen kann und er beginnt sich zurück nach seiner Heimat zu sehnen: Carlozzo.
Nero: Schwarzer Kater, rotes Herz
Elke Heidenreich erzählt die Geschichte des schwarzen kleinen Katers Nero Corleone mit der einen weißen Vorderpfote liebe- und lehrvoll. So weiß sie etwa, dass sein Nachname von cuore di leone herrührt, “Löwenherz” und dass Deutsche und Italiener mehr verbindet als nur die Brennerautobahn. Die gemeinsame Liebe zu den kleinen pelzigen Gefährten macht auch aus den erwachsenen Menschen Freunde und aus Nero bald einen Herzensbrecher. Denn um seiner neuen Liebe in Italien, Grigiolina, zu huldigen, kann er nicht mehr in das Auto von Robert und Isolde einsteigen. Aber wie soll er ihnen das nur erklären? Quint Buchholz hat diese Katzengeschichte mit wunderbaren farbigen Bildern versehen und eine Fortsetzung wartet auch schon beim Hanser Verlag sowie viele weitere Bücher der umtriebigen Autorin: Männer in Kamelhaarmänteln (Kurze Geschichten über Kleider und Leute, 2020) und zuletzt Ihr glücklichen Augen (Kurze Geschichten zu weiten Reisen, 2022). Im Kinder- und Jugendbuch veröffentlichte sie u.a. Nero Corleone kehrt zurück (mit Quint Buchholz, 2011)…
Elke Heidenreich
Nero Corleone. Eine Katzengeschichte
1995, Fester Einband, 88 Seiten, illustriert von Quint Buchholz, empfohlen ab 8 Jahren
ISBN 978-3-446-18344-5
Hanser Verlag
Deutschland: 20,00 €
Österreich: 20,60 €
Wie ein Himmel in uns. Meine Nacht allein im Louvre.
 „Na? Wie würdest du die Mona Lisa stehlen?“ Eine Frage, die Vincenzo Peruggia, der Kunstdieb des Gemäldes, während seines Gefängnisaufenthalts 1913 einen Mitinsassen mit einem nicht minder verschmitzten Lächeln hätte stellen können. Wie wahrscheinlich wäre es außerdem, eine ‚Leihgabe‘ des Gemäldes genehmigt zu bekommen, wie im Falle des reichen Entrepreneurs Miles Bron im Film Glass Onion? Realistischer war da schon 2019 die Chance, im Rahmen eines Gewinnspiels mit Airbnb eine Nacht im Louvre zu verbringen. Eine Aktion, die sicherlich auch von Beyonces und Jay-Zs Video zu „Apeshit“ inspiriert wurde.
„Na? Wie würdest du die Mona Lisa stehlen?“ Eine Frage, die Vincenzo Peruggia, der Kunstdieb des Gemäldes, während seines Gefängnisaufenthalts 1913 einen Mitinsassen mit einem nicht minder verschmitzten Lächeln hätte stellen können. Wie wahrscheinlich wäre es außerdem, eine ‚Leihgabe‘ des Gemäldes genehmigt zu bekommen, wie im Falle des reichen Entrepreneurs Miles Bron im Film Glass Onion? Realistischer war da schon 2019 die Chance, im Rahmen eines Gewinnspiels mit Airbnb eine Nacht im Louvre zu verbringen. Eine Aktion, die sicherlich auch von Beyonces und Jay-Zs Video zu „Apeshit“ inspiriert wurde.
In „Wie ein Himmel in uns. Meine Nacht allein im Louvre“ von Jakuta Alikavazovic, einer in Paris aufgewachsenen Autorin mit jugoslawischen Wurzeln, ist die Frage nach einem potenziellen Raub der Mona Lisa eine viel komplexere, als Popkultur und Verschwörungstheorien vermuten lassen.
Kunst als Heimatverlust
Die (gestohlene) Mona Lisa wird bei Alikavazovic zum Sinnbild des Heimatverlusts. Nicht zufällig erwähnt die namenlose Ich-Erzählerin, dass Peruggia in seinem Bemühen, das Gemälde dem ‚rechtmäßigen‘ Land seiner Zugehörigkeit zurückzubringen, bis heute als italienischer Nationalheld gefeiert wird. Eine Art Restitution also?
Das Gefühl der verlorenen Heimat wird sowohl direkt durch die Ich-Erzählerin als auch indirekt durch deren Vorgeneration, ihren Vater, empfunden. Dieser spukt in Form von Erinnerungen und Mythen wie ein Phantasma durch das Narrativ der Tochter, während sie – unter dem Vorwand der Recherche für ein Buch – eine Nacht allein im Louvre verbringt. Nach der Flucht vor dem Jugoslawienkrieg nach Frankreich wird der Louvre hauptsächlich für den Vater nicht nur zum Ort der Erkenntnis, dass sich die Erinnerung an die Heimat – Titos kommunistische Utopie vom jugoslawischen ‚Einheitsstaat‘, ähnlich wie Stalins Sowjetunion – als künstliches Konstrukt entpuppt. Genauso verhält es sich mit den zahlreichen Besuchern am ‚Tatort‘ im Louvre, in deren Erinnerung die Mona Lisa während ihrer Abwesenheit 1911-1913 originellere Züge annimmt als in ihrer Anwesenheit. Die Erinnerung an etwas, das es nicht (mehr) gibt.
Kunst als ‚wahre‘ Heimat
Gleichzeitig kann der Vater seine Identität gerade im Louvre jenseits der gesprochenen Sprache mit seiner Affinität zu Kunst(geschichte) ‚neu‘ erfinden. Wenn er seine Tochter also immer wieder fragt „Na? Wie würdest du die Mona Lisa stehlen?“, dann interessieren ihn auch die Möglichkeiten und Grenzen ihrer eigenen Neuerfindung.
Ironischerweise hat auch der ehemalige französische Präsident François Mitterrand den Louvre 1989 ‚renoviert‘, weniger revolutioniert. Der Eindruck von einem ursprünglich aus dem 19. Jhdt. stammenden Adelspalast sollte unter anderem durch den Bau einer Glaspyramide, von der sich der chinesisch-amerikanische Architekt Ieoh Ming Pei absolute Transparenz erhoffte, getrübt werden. Auch wenn Mitterrand mit dieser zur spöttischen „Grabkammer der Sozialisten“ deklarierten Pyramide eine demokratische Geste für ein modernes Frankreich tätigen wollte, wurde der moderne Zusatz vom Volk lediglich geduldet. Selbst wenn die Pyramide mittlerweile bekannter ist als das eigentliche Museum.
Jenseits von Trauma und Exilliteratur. Die Untrennbarkeit von Ästhetik und Politik
In „Wie ein Himmel in uns“ untersucht Alikavazovic mit Fingerspitzengefühl, inwiefern der Akt der ‚Neuerfindung‘, sei es in Bezug auf Kunst, Geschichte oder persönliche Identität, auch mit Scham behaftet sowie eine spielerische Verleugnung der Vergangenheit und des Selbst sein kann. Auch, wie sich das auf Liebe in zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt. Damit knüpft sie teilweise an die Vorgängerromane Corps Volatils, Le Londres-Louxor oder Das Fortschreiten der Nacht an.
In der Manier des Magischen Realismus mit metafiktionalen Elementen lässt sie die Wahrnehmung, Erinnerungen und Erlebnisse der Ich-Erzählerin, des Vaters und anderer Bekannter ineinanderfließen. So gekonnt, dass man Vater und Tochter tatsächlich zutrauen könnte, einen Raubversuch im Louvre zu wagen. Autofiktion und Autobiographie, Ästhetik und Politik gehen somit nahtlos ineinander über.
Alikavazovic lässt sich literarischen Größen wie Vladimir Nabokov (Der Museumsbesuch), David Markson (Wittgensteins Mätresse) oder Annie Ernaux (Die Scham) zuordnen. Nicht nur, aber auch deswegen gebührt der Autorin, die auch David Foster Wallace ins Französische überträgt und von der gerade einmal zwei Romane ins Deutsche übersetzt wurden, mehr Aufmerksamkeit.
Jakuta Alikavazovic: Wie ein Himmel in uns. Meine Nacht allein im Louvre.
Übersetzt aus dem Französischen von Stephanie Singh.
Erschienen bei Hanser.
Die Judenbuche
 Nicht nur morgens lesenswert
Nicht nur morgens lesenswert
Deutschlands bedeutendste Schriftstellerin des 19ten Jahrhunderts, Annette von Droste-Hülshoff, hat mit ihrer 1842 im «Cotta’schen Morgenblatt für gebildete Leser» erstmals erschienen Novelle «Die Judenbuche» ein Prosawerk geschaffen, dessen Stoff viele zum Wiederlesen anregt und das als Klassiker auch heutige Leser zu begeistern vermag. Mit dem von der Autorin ursprünglich gewählten Titel «Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen», den der Verlag seinerzeit publikumswirksam abgeändert hat, ist das literarische Genre bereits genannt, es handelt sich um eine Milieustudie in einem abgelegenen Dorf Westfalens. Der große Erfolg dieses Büchleins liegt wohl nicht zuletzt darin begründet, dass es sich um eine Kriminalgeschichte handelt, es gibt zwei Morde und noch einen weiteren tragischen Todesfall, genug Potential also, um wohligen Schauer beim «gebildeten Leser» zu erzeugen.
Protagonist dieser Novelle ist Friedrich Mergel, dessen Vater ein gewalttätiger Alkoholiker ist, der sturzbetrunken in einer Winternacht im Wald einschläft und erfriert. Der neunjährige Sohn hilft fortan seiner Mutter als Kuhhirte, bis ihn sein zwielichtiger Onkel quasi «adoptiert» und ihn bei sich beschäftigt. Dort lernt er Johannes Niemand kennen, dessen unehelichen Sohn, der ihm verblüffend ähnlich sieht und sich mit ihm anfreundet. Eine Blaukittel genannte brutale Bande von skrupellosen Holzdieben treibt in den dichten Wäldern ihr Unwesen und benutzt dabei auch Friedrich zum Schmierestehen. Als eines Nachts plötzlich der Oberförster auftaucht, warnt er die Bande und schickt den Forstmann in einen Hinterhalt, wo er später, mit einer Axt erschlagen, aufgefunden wird. Obwohl man Friedrich nichts beweisen kann, fühlt er sich mitschuldig. Auf einer Hochzeitsfeier bezichtigt ihn später der Jude Aaron vor allen Leuten des Betrugs, er habe seine teure Uhr nicht bezahlt. Kurz danach wird die Leiche des Juden im Wald unter einer Buche gefunden, der Verdacht fällt sofort auf Friedrich, zusammen mit Johannes gelingt ihm die Flucht. Der Baum wird fortan die «Judenbuche» genannt, die Juden schließen sich zusammen, kaufen dem Gutsherrn den Baum ab und ritzen auf Hebräisch den Satz «Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast». Achtundzwanzig Jahre später, der Mord ist längst vergessen, taucht an Heiligabend 1788 ein ausgezehrter Mann im Dorf auf, der verschollene Johannes Niemand. Er verdingt sich beim Gutsherrn und wird Monate später plötzlich vermisst, bis ihn der Sohn des ermordeten Oberförsters zufällig erhängt in der Judenbuche entdeckt. Bei der Untersuchung der Leiche kann der Gutsherr anhand einer Narbe den Toten als Friedrich Mergel identifizieren, der daraufhin ehrlos auf dem Schindanger verscharrt wird.
Die Autorin schreibt nach dem ergebnislosen Verhör von Friedrich, dass der Mord nie aufgeklärt wurde. «Es würde in einer erdichteten Geschichte Unrecht sein, die Neugier des Lesers so zu täuschen. Aber dies Alles hat sich wirklich zugetragen», beteuert sie. In der rückständigen, vom Gutsherrn ausgeübten, niederen Gerichtsbarkeit jener Zeit galt ein primitives Gewohnheitsrecht, und die Judenfeindlichkeit war allgegenwärtig. Das Unrecht wird in dieser Erzählung durch die Dunkelheit symbolisiert, die bei all den Schandtaten herrscht, der undurchdringliche Wald dient als finsterer Tatort.
Ein Kennzeichen dieser Novelle ist die unzuverlässige Erzählweise, die für manche Rätsel sorgt beim Leser. Die handelnden Figuren erscheinen seltsam unbehaust, sie sind unsicher und schwer zu verstehen in ihrem Handeln, ihr Seelenleben bleibt im Dunkeln. Liebe scheint ein Fremdwort zu sein, Mann und Frau finden zueinander aus dumpfem Opportunismus, selbst über der geschilderten Hochzeitsfeier schwebt drohend das Unheil. Eine stilistisch gekonnte, bereichernde Lektüre ist «Die Judenbuche» erstaunlicherweise auch heute noch, nach fast zweihundert Jahren.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Wie hoch die Wasser steigen
 Die Bohrinsel als Metapher
Die Bohrinsel als Metapher
Was literarische Debüts oft so spannend macht ist die Überraschung, die da manchmal auf den Leser wartet, eine neue Stimme, die womöglich auch neue Wege des Erzählens aufzeigt. In ihrem Erstling «Wie hoch die Wasser steigen» überrascht die bisher nur als Lyrikerin bekannt gewordene Anja Kampmann uns tatsächlich mit einer ganz eigenen Form des Prosa-Erzählens. Ihr schon vom Buchcover her an ein Roadmovie erinnernder Roman ist eine moderne Odyssee auf der Suche nach dem eigenen Ich, die sich im letzten Drittel des Buches dann auch real im Auto abspielt, der letzten Zuflucht eines total aus der Welt gefallenen Mannes. Sinnbild dieser Irrfahrt ist die Brieftaube, die hier als klug gewähltes Leitmotiv dient und deren Heimfindevermögen völlig konträr ist zur beklemmenden Unbehaustheit des ziellosen Protagonisten.
Matyás, der beste Freund eines 52jährigen polnischen Arbeiters auf einer Ölplattform vor der marokkanischen Küste, wird bei rauer See eines Nachts vermisst, – über Bord zu gehen aber bedeutet in dieser Situation nichts anderes als der sichere Tod. Ein schlimmer Schock für Waclav Groszak, denn der Ungar war geradezu symbiotisch mit ihm verbunden, vielleicht auch mehr, wie man ihre innigliche Beziehung – zwischen den Zeilen lesend – auch interpretieren könnte. Die Ölmanager schicken Waclaw daraufhin mit dem Hubschrauber aufs Festland zurück, in einen mehrwöchigen Urlaub. Er beginnt von Tanger aus eine Reise, die ihn zuerst nach Ungarn führt, um der Schwester seines toten Freundes dessen Hab und Gut zu überbringen. Im weiteren Verlauf seiner Reise, die in ihrer Planlosigkeit mehr einer Fahrt ins Blaue gleicht, wird ihm zunehmend bewusst, dass er niemals wieder zurückkehren wird auf eine Bohrplattform. Er reist nach Malta, wo er aus steuerlichen Gründen seinen Wohnsitz hat – und eine willige Seemannsbraut obendrein. Schließlich wandert er zu Fuß in die Alpen Norditaliens, wo Alois, der alte Freund des längst verstorbenen Vaters, als Rentner Brieftauben züchtet wie einst im Ruhrgebiet, wo die beiden früher als Kumpels im Bergbau gearbeitet hatten. Alois stellt ihm für die weitere Reise seinen alten Fiat Fiorino Pick-up zur Verfügung und gibt ihm im Transportkäfig Enni mit, seine beste Brieftaube, er soll sie in der alten Heimat auflassen. Aus Bottrop schließlich, wo er die Taube auf dem Gipfel einer Kohlenhalde auflässt, zieht es ihn zu Milena weiter, seiner großen Liebe, die er irgendwann verloren hat bei seinem gut bezahlten, aber einsam machenden, unsteten Bohrinselleben.
Im Epilog schildert die Autorin eine traumartige Szene, in der auch Waclav Flügel zu bekommen scheint und ebenfalls fliegt. Mit «alles war ganz leicht» endet denn auch dieser poetische Roman, dessen Figuren – der Protagonist eingeschlossen – blutleer bleiben, es baut sich jedenfalls keine Empathie auf zu ihnen. Was da auf 350 Seiten ebenso leicht wie wortreich geschildert wird, ist wenig konkret, so ziemlich alles bleibt im Vagen, Nebulösen. Immer wieder werden Szenen aneinander gereiht, die weder irgendwie miteinander verbunden sind noch irgendwo hinführen im Sinne einer stringenten Handlung. Die ausufernden, detailverliebten Schilderungen von Szenen, Orten, Landschaften, Behausungen, Haltepunkten auf dieser irrlichtartigen Reise weisen überdeutlich auf die Lyrikerin hin als Autorin, die sprachverliebt narrativ völlig Belangloses anhäuft in ihrem Prosadebüt.
Schön zu lesen ist dieser visuell kraftvolle Roman, in dem die Bohrinsel als Metapher dient, trotzdem, er wird mit den vielen Bildern, die er erzeugt, auch nie langweilig. Vieles wird in Rückblenden erschlossen, wie im Puzzle entsteht so allmählich das Gesamtbild eines im Hier und Jetzt verlorenen Mannes, der sich als Globalisierungsopfer ohne Zukunft total entwurzelt in die Vergangenheit flüchtet. Das ist durchaus berührend und bedingt wohl auch diese ungewöhnlich distanzierte, emotionslose Erzählweise, die dadurch aber bestens vor peinlichem Kitsch gefeit ist.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Unter der Drachenwand
 Zwischen Hoffnung und Horror
Zwischen Hoffnung und Horror
In seinem jüngst erschienenen Roman «Unter der Drachenwand» hat der österreichische Schriftsteller Arno Geiger, wie schon in früheren Romanen, wieder einen Antihelden in den Mittelpunkt gestellt, einen sympathischen Drückeberger diesmal, ein in Russland im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs mittelschwer verwundeter Soldat auf Heimaturlaub. Der Autor hat im Interview erklärt, dass er den Stoff für seine Geschichte einem lange zurückliegenden Zufallsfund verdankt, der umfangreichen Korrespondenz des Lagers «Schwarzindien» am Mondsee, eine Einrichtung der NS-Kinderlandverschickung. Ausgelöst durch diesen literarischen Impuls sei aus der Trouvaille nach zehnjähriger Vorbereitungszeit dann der vorliegende Roman entstanden.
Veit Kolbe ist nach Abitur und Wehrdienst lückenlos in den Zweiten Weltkrieg hineingeschlittert, er wird 1944, im letzten Kriegsjahr, nach seinem Lazarettaufenthalt, wehruntauglich geschrieben. Weil er in Wien die stupiden Naziparolen seines Vaters nicht mehr ertragen kann, flüchtet er zu seinem Onkel, der in dem kleinen Dorf Mondsee als Gendarm eingesetzt ist. Während der Krieg seinem damals schon deutlich absehbaren Ende zusteuert, genießt er, allmählich genesend, das überschaubare, ländliche Leben in seinem idyllischen Zufluchtsort am See unter der Drachenwand. Dort entwickelt sich zwischen dem sexuell noch völlig Unerfahrenen ein Liebesverhältnis mit der im gleichen Haus wohnenden «Darmstädterin». Die verheiratete Margot ist mit ihrem Baby aus der Großstadt hierher evakuierten worden, sie hatte bei Kriegsausbruch ihren Mann überstürzt geheiratet, weil der als verheirateter Soldat mit Kind dann deutlich mehr Anspruch auf Heimaturlaub hat. Trickreich, notfalls auch durch Urkundenfälschungen, gelingt es dem immer noch an seinen Verwundungen leidenden Veit mehrfach, Atteste über seine Wehruntauglichkeit zu bekommen, er will sich den Krieg so lange vom Leibe halten wie möglich. Als überzeugter Zivilist ist der 24Jährige nach fünf Jahren als Soldat nicht nur kriegsmüde, er sieht auch keinerlei Sinn mehr in den verlustreichen Kämpfen während der Endphase des aussichtslos gewordenen Krieges.
Dieser tagebuchartige Gesellschaftsroman über die Auswirkungen eines verbrecherischen Weltkriegs aus Sicht der so genannten «kleinen Leute» wird von verschiedenen Protagonisten multiperspektivisch im Ich-Modus erzählt, teilweise in abstrahierter Briefform. Außer der Hauptfigur Veit sind dies die Mutter von Margot, die glaubhaft naiv von den verheerenden Bombenangriffen auf Darmstadt berichtet, der siebzehnjährige Kurt, der aus seiner Heimatstadt Wien über seine Gefühle und die turbulenten Ereignisse an seine nach «Schwarzindien» evakuierte Freundin Nanni schreibt, ferner ein Wiener Zahnarzt, der von seinen verzweifelten Versuchen berichtet, als Jude in Österreich und später dann in Ungarn dem Zugriff der Nazi-Schergen zu entgehen.
Die titelgebende Drachenwand am Mondsee und die beinahe täglich darüber hinweg fliegenden Bomberstaffeln der Alliierten erzeugen eine beklemmende Atmosphäre, wobei die Schilderung des Alltagslebens der verschiedenen, stimmig beschriebenen Figuren des Romans sehr realistisch wirkt, ja geradezu authentisch erscheint. Abgesehen von den wenig überzeugenden typografischen Mätzchen mit Schrägstrichen als weiterem Gliederungselement des Textes und den abrupten Erzählerwechseln, bei denen der Leser zunächst mal rätseln muss, wer denn da spricht, ist der angenehm lesbare Roman sprachlich sehr stimmig seiner Erzählzeit angepasst. Zwischen Hoffnung und Horror pendelnd endet er mit der so lange befürchteten Einberufung von Veit und seinem Weg zurück zu seiner Einheit. Es schließt sich trickreich eine, gekonnt historische Authentizität vorgaukelnde, kurze Nachbemerkung an, in der Geiger mit Autorenstimme das weitere Schicksal seiner Figuren skizziert, ein versöhnender Schluss mithin, der eigenen Spekulationen des Lesers wohltuend den Nährboden entzieht.
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
Der Mann, der Verlorenes wiederfindet

Der Mann, der Verlorenes wiederfindet
„Dieser Beichtvater benötigte pro Seele nur einen Blick“, heißt es über den Heiligen Antonius, der in Köhlmeiers Novelle gleich zu Beginn schon im Sterben liegt, auf einem Platz, vor 3000 Zuhörern, bei seiner letzten Predigt. Er hätte hinunterschauen können in einen, wie in einen ausgeleuchteten Brunnenschacht, „dorthin wo die Seele hocke und bocke und leide und hoffe“. Nach seiner Predigt sei er um 3000 Blutstropfen ärmer gewesen, bemerkt Köhlmeier lakonisch, denn er habe jedem Gläubigen mit seinem punktierten Finger zum Segen ein Kreuz auf die Stirn gemacht.
Die Hölle dauert ewig
Als Kind habe er den kleinen Zehen verloren, da er abgefroren war. Wenn er sprach, blickten die Menschen auf seinen Mund, wenn er schwieg in seine Augen. Leider litt der Heilige unter Hochmut, ein “Kind des Teufels”, denn er lernte schnell und wusste viel. Der in Lissabon geborene Fernandus und Zeitgenosse Franziskus’ kam aus guter lusitanischer Familie und hatte an den Universitäten Coimbra, Toulouse, Montpellier und Bologna studiert und sogar gelehrt und sich besonders mit “dem Bösen” beschäftigt. Wie kommt das Böse in die Welt? „Satan ist nur ein Name. (…) Er ist der Name für das Nichts …das eigentlich keine Namen haben kann …Hätte es einen Namen, wäre es nicht das Nichts. (…) Das Nichts ist dort, wo Gott nicht schaut. …und wohin Gott nicht schaut, dort ist das Nichts. (…) Wohin aber Gottes Auge blickt, dort blüht die Schöpfung. Gott ist eine Himmelsrichtung.“, lautet die Antwort, die Köhlmeier seinem Heiligen in den Kopf legt. Aber Köhlmeier weiß auch eine gute Antwort auf die Definition von Hölle, denn bei ihm ist sie nicht „die anderen“, wie bei Sartre, sondern: „In der Hölle ist es wie auf der Erde. Hier wird gequält, dort wird gequält. Nur einen Unterschied gibt es: Die Hölle dauert ewig.“
Erklärung unserer Unzulänglichkeiten
„Satan ist das Es-wird.“ Und das Gegenteil? Die Liebe. Sie ist Gnade. Sie macht alle gleich, Diener und Herr. „Und das Glück gehört nie einem allein. Wenn du glücklich bist, vermehrst du das Glück auf Erden.“, glaubt auch Antonius in Anlehnung an Aristoteles. „Unsere Worte sollen sein wie die Mongolen, die über ein stummes Land herfallen, und wenn sie abziehen, ist kein Handfleck breit übrig, auf dem nicht ein Abdruck der Hufe ihrer Pferde wäre.“ Predigen und Beten. Wobei beim Beten jedes Wort durchdenkt werden sollte, als spreche man es das erste Mal. Auch die Erklärung für die Unvollkommenheit des Menschen ist aufschlussreich: Hätte Gott uns eigenhändig, jeden von uns bis ans Ende geformt, wäre jeder von uns vollkommen und nachdem Vollkommenheit einmalig ist, wären wir alle gleich und es wäre eigentlich nicht nötig gewesen, gleich mehrere von uns zu schaffen. Manchmal arbeite Gott einen Menschen perfekt aus und behalte ein Stück zurück, so wie bei Antonius. Gott habe die Zehe des Antonius als Pfand für sich behalten, damit er ein „Teilchen seines Lieblings immer bei sich trage“. Eine rührende Erklärung, auch für unsere Unzulänglichkeiten.
Alleinsein=Beten
„Die Wiederholung ist noch schwerer zu ertragen, als die Hoffnung, zugleich aber gibt sie nicht weniger Trost als diese.“ Liegt darin der Zauber des Betens? „In eines Mannes Herzen sind viele Pläne; aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn.“ Ein Mensch ist aber nicht nach dem zu beurteilen, was er weiß, sondern was er liebt. Und auch hier findet Köhlmeier wunderschöne Worte: „Auch Franziskus sprach der Seele das Recht zu, hin und wieder allein zu sein, weil die Schönheit der Schöpfung rein und klar nur aus einem Augenpaar gebührend bestaunt werden könne. Will aber die Seele sich selbst schauen, was nichts anderes bedeutet, als in das ebenbildliche Antlitz Gottes zu schauen, dann muss sie für sich allein sein.“ Dem kann auch Antonius etwas abgewinnen.
Eine Meditation über das wahre Beten und das, was einen Menschen, ganz abgesehen von der Legende, eigentlich ausmacht. Die Erklärung warum ausgerechnet der Heilige Antonius für die verlorenen Sachen zuständig ist, bleibt Köhlmeier allerdings schuldig. Ein Buch wie eine Meditation: langanhaltend und nachhaltig.
Michael Köhlmeier
Der Mann, der Verlorenes wiederfindet
2017, Hanser Verlag, 160 Seiten
Hardcover oder ePUB-Format
ISBN 978-3-446-25645-3
Trennung
 Wenn Trennung obsolet wird
Wenn Trennung obsolet wird
Der erste auf Deutsch erschienene Roman der amerikanischen Schriftstellerin Kati Kitamura mit dem Titel «Trennung» überrascht in mancherlei Hinsicht. Denn es geht um die Trennung eines Ehepaares, was in vergleichbaren Geschichten ein Gefühlschaos auslöst und zu emotionalen Ausbrüchen führt, die unter dem Motto «Herz-Schmerz» ganze Bibliotheken mit Trivialliteratur füllen. Nicht so in diesem Buch, dessen Autorin sich dieses Themas kühl sezierend annimmt, das Geschehen vielmehr sehr distanziert, geradezu gelassen schildert und damit erzählerisch überraschend dieses beliebte literarische Genre konterkariert.
Die seit fünf Jahren verheiratete, in London lebende, namenlose Ich-Erzählerin hat sich mit Christopher auseinander gelebt, er ist seit einigen Monaten ausgezogen, sie selbst wohnt inzwischen bei ihrem Freund. «Es begann mit einem Anruf von Isabella» lautet der erste Satz. Die Schwiegermutter, die nichts von ihrer Trennung weiß, erkundigt sich nach ihrem Sohn, der in Griechenland für ein Buch recherchiert, aber nicht erreichbar ist. Ob sie nicht dorthin reisen könne, um zu klären, was mit ihrem Sohn sei. Vor Ort stellt sich heraus, dass Christoph schon seit vielen Tagen nicht mehr in seinem Hotelzimmer war, niemand weiß etwas über seinen Verbleib. Bis nach drei Tagen die Polizei erscheint, er sei an einer einsamen Landstraße tot aufgefunden worden, ausgeraubt und ermordet, es gäbe den Umständen nach leider kaum eine Chance, den Mordfall aufzuklären.
Diese vom Plot her wenig originelle, in dreizehn Kapiteln erzählte Geschichte lebt von den kontemplativen Einschüben, von den gedanklichen Rückblenden und Reflexionen der Ich-Erzählerin, die in Form des Bewusstseinsstroms, oft auch mit der inneren Rede all das ergänzt, was das erzählerische Gerüst erst zu einer vollständigen Geschichte formt. So erfährt man, dass Christoph ein notorischer Schürzenjäger war, als Schriftsteller aber kaum reüssieren konnte, und auch, wie wenig seine Frau letztendlich über ihn weiß. Aus ihrem geradezu voyeuristischen Blickwinkel werden dem Leser einige weitere Figuren vorgestellt. Da ist zunächst die Hotelangestellte Maria, mit der Christoph ein Verhältnis hatte, was sie der Witwe in einem der wenigen Gespräche, die die Handlung direkt voranbringen, freimütig gesteht. Oder der Taxifahrer Stefano, der Maria liebt und als eifersüchtiger Mann zumindest vom Motiv her als Täter in Frage käme. All das Spekulation, Teil der endlosen Gedankenspiele und Projektionen der Ich-Erzählerin, und auch über sie selbst übrigens erfährt der Leser herzlich wenig. Es ist eine äußerst minimalistische Erzählweise, mit der hier Illusionen aufgearbeitet, die Realitäten in einem Prozess des ständigen Sinnierens hinterfragt werden, und in der immer wieder über die Leerstellen und Lügen einer Ehe spekuliert wird.
Geschickt bindet die Autorin die trostlose griechische Landschaft, in der erst vor kurzem ein Waldbrand gewütet hat, in Ihre nicht minder trostlose Geschichte ein, die viele Fragen bewusst offen lässt. Ihre narrative Emotionslosigkeit macht nachdenklich, es wird damit eine Betroffenheit beim Leser erzeugt, die resignativ wirkt, die die Schrecken von Trennung und Tod evident werden lässt. Eine ziemlich makabre Szene spielt sich – darauf hinzielend – im Haus einer der im ländlichen Raum noch typischen Klageweiber ab, die bei einem Besuch der jungen Witwe eine Kostprobe ihres Klagegesangs zum Besten gibt und sich dabei exstatisch in ihren Gesang hineinsteigert. Das Todesmotiv taucht übrigens bereits am Anfang des Romans auf, Christoph recherchiert nämlich für ein Buch über Trauerrituale, er war mutmaßlich auch genau deswegen dorthin gereist. Mit irritierender Distanz und gelegentlich durchschimmernder Ironie wird in diesem psychologischen Roman jenes weibliche Gefühlsleben thematisiert, das mit dem langsamen Auflösungsprozess einer Ehe einhergeht, in der paradoxer Weise die Trennung selbst schlussendlich obsolet wird.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Schlafende Sonne
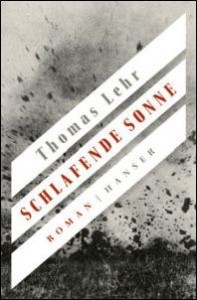 Poetologische Phänomenologie
Poetologische Phänomenologie
Mit «Schlafende Sonne» ist der erste Teil des Opus Magnum von Thomas Lehr erschienen, dem zwei weitere folgen sollen. «Wird fortgesetzt» lesen wir also am Ende, doch so mancher Leser wird spätestens da, wenn er denn überhaupt so weit gekommen ist, entnervt aufstöhnen: «Aber ohne mich!» Denn indem der Autor schon im Motto mit dem Phänomen der Spirale seinem Roman dessen formales Prinzip voranstellt, weist er auch gleich auf ein narratives Chaos hin, dem er in seinem unkonventionellen Text immer wieder vom Innern einer erzählerischen Spirale her beizukommen sucht. Es wird also nicht linear erzählt, sondern ohne erkennbare Chronologie vom stofflichen Zentrum her in sich drehenden, geradezu verwirbelten Erzählsträngen, die lesend nachzuvollziehen mehr als anstrengend, häufig gar unmöglich ist. Verliert also der arglose Leser in dieser fragmentierten Erzählung die Orientierung, was voraussehbar ist, liegt das ganz gewiss nicht an seinem rezeptiven Unvermögen, soviel vorab.
Dreh- und Angelpunkt der Geschichte mit ihren drei Protagonisten ist ein einziger Tag im August 2011, an dem die Künstlerin Milena Sonntag im Berlin ihre große Werkschau eröffnet. Ihr Ex-Geliebter Rudolf Zacharias, einst ihr Philosophie-Professor, reist extra aus Tokio an, ihr Ehemann Jonas, dessen Statement «Ich bin nur Physiker» ihn in intellektuellen Disputen der Künstlergemeinde stets aus der Schusslinie nimmt, holt ihn am Flughafen ab. Das ist auch schon die eigentliche Handlung, die wegen ihrer eintägigen Dauer unwillkürlich an Joyce erinnert. Aber anders als im «Ulysses» stehen hier nicht die Protagonisten im Zentrum der Erzählung, sondern die Geschichte Deutschlands selbst in politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher Hinsicht, und zwar über einen Zeitraum von etwa hundert Jahren hinweg. In den vielen die Seiten füllenden, aus der leitmotivischen «Spirale» heraus sich entwickelnden Erzählkreisen werden intellektuell anspruchsvoll philosophische, physikalische, kunsttheoretische, universitäre, historische, soziologische Themen behandelt. Die so entstehenden erratischen Bilder jedoch sind ohne inneren Zusammenhang, vieldeutig und kaum zu entschlüsseln, auch mit Hilfe des zweiten Leitmotivs «Sonne» nicht.
Muss man also, wie in Feuilleton zu lesen war, den Roman mehrmals lesen, um ihn wirklich zu verstehen? Man könnte den sich radikal außerhalb aller Konventionen stellenden Erzählstil Lehrs, seine eher technisch als poetologisch angelegte Sprache, als provokativ empfinden. Inwieweit der auf diese Art bewerkstelligte Einblick ins deutsche Bewusstsein wirklich Erkenntnis fördernd ist, hängt einzig vom Erfahrungshintergrund des jeweiligen Lesers ab. Der Roman schließt nach meiner Einschätzung aber weite Leserkreise von einer bereichernden Wirkung der Lektüre mit Sicherheit aus, zu akademisch hochgestochen wird hier schwadroniert, quasi nach Bildungsbürgerart. «Ich bin vielfach ungebildet» hat der Autor mit einem Musil-Zitat eine entsprechende Frage abgewiegelt, meinen Nonsens-Verdacht damit erhärtend. Denn ob das akademische Parlando des Romans einer fachlich kritischen Prüfung standhält, vermag ich zwar nicht zu beurteilen, es bleibt aber doch fraglich.
Ohne Zweifel schreibt Thomas Lehr auf höchstem Niveau, virtuos immer wieder die Erzählperspektiven wechselnd. Er erzeugt mühelos hoch assoziative Bilder in seinem breit angelegten deutschen Panorama, in dem Alltagsleben oder ökonomische Aspekte ausgeblendet bleiben und Sex als eine fast schon artistische Zweckübung behandelt wird, bei der Erotik kaum eine Rolle spielt. Die Figuren des Romans sind wenig lebensecht, zudem intellektuell maßlos überzeichnet, und manche der weit ausholenden Erzählbögen führen einfach nur ins Leere. In dem für die Shortlist des diesjährigen Buchpreises nominierten Roman ist der Inhalt der Form derart radikal untergeordnet, dass der Leser größte Mühe hat, auch nur ein Gran Sinn in das Ganze zu bringen. Schade eigentlich!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Der Tod eines Bienenzüchters
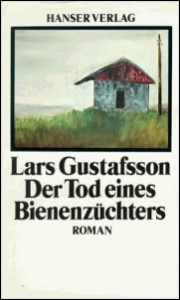 Kein Jahrhundertroman
Kein Jahrhundertroman
Der jüngst verstorbene schwedische Schriftsteller und Philosoph Lars Gustafsson hat ein vielseitiges Œuvre aufzuweisen, in dem neben philosophischen, lyrischen und literaturwissenschaftlichen Werken auch die Epik eine gewichtige Rolle einnimmt. «Ich neige dazu, mich als einen Philosophen zu betrachten, der die Literatur zu einem seiner Werkzeuge gemacht hat» lautet seine Selbsteinschätzung. Seine fünfteilige Romanreihe «Risse in der Mauer» wird durch den 1978 erschienenen Roman «Der Tod eines Bienenzüchters» abgeschlossen, der von der Süddeutschen Zeitung durch Aufnahme in ihre Bibliothek «Hundert große Romane des 20. Jahrhunderts» exemplarisch hervorgehoben wurde. Zu Recht?
Bei einem solchen Titel darf der Leser natürlich keine leichte Lektüre erwarten, und so ist man hier auch schon bald ziemlich betroffen von der emotionslosen Schilderung des Sterbens – nicht des Todes – eines erschreckend vereinsamten Menschen. Der Verfasser stellt seinen Protagonisten Lars Lennart Westin als vierzigjährigen, vorzeitig pensionierten Volksschullehrer vor, früh gealtert, geschieden, kinderlos, der allein und abgeschieden in einer einfachen Kate wohnt und seinen Lebensunterhalt unter anderem als Bienenzüchter bestreitet. Ein viel zu spät erkanntes Krebsgeschwür wird seine Todesursache sein, lässt uns der Autor in einer als «Vorspiel» bezeichneten Einleitung wissen, in der ein anonymer Erzähler sich dann schließlich direkt an die Leser wendet: «Die Stimme, die ihr von jetzt an hören werdet, ist seine, nicht meine, und deshalb nehme ich hier von euch Abschied.» Es folgt eine Quellenübersicht, die drei Notizbücher nennt, deren ältestes 1964 begonnen wurde.
Als Ich-Erzähler berichtet Westin nun zunächst selbst von seiner Untersuchung in der Klinik, deren Ergebnis ihm per Brief zugeht, den er aber aus Angst vor dem darin enthaltenen Befund nicht öffnet. «Diesen Brief benutzte er als Fidibus» heißt es am Ende des Kapitels, er verbrennt ihn ungelesen. Nach zwei weiteren Kapiteln über seine Ehe und seine Kindheit werden immer wieder seine Schmerzen thematisiert, denen er trotzig gegenübertritt, dem Motto von Nietzsche folgend: «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker». Überirdisches ist Thema im Kapitel «Als Gott erwachte», eine herbei fantasierte Wunschwelt, die uns mit einem grenzenlos gütigen Gott überrascht. Nach einer Rückblende auf glückliche Zeiten in der Jugend unter dem Titel «Memoiren aus dem Paradies» leitet das letzte Kapitel mit kurzen Textfragmenten in die Schlussphase der Krankheit ein, endend mit dem Krankenwagen, der ihn holen kommt. «Man kann immer noch hoffen» lautet der letzte Satz, der im Roman des Öfteren zitiert wird
Der handlungsarme Roman ist in einer einfachen Sprache geschrieben, nüchtern und sachlich wird da erzählt, nordisch unterkühlt, wie ich finde. Mehr Verlorenheit als bei dieser einsamen Figur des Bienenzüchters ist selten zu finden, er ist extrem beziehungsarm und geht einem einsamen Tod entgegen. Sein Hund und die Natur, die seine Kate umgibt, sind alles, was sein Dasein ein wenig erhellt, Westins Sterben ist eher ein Krepieren in einer selbst gewählten Isolation. Philosophische Mutmaßungen über das Ich, die seelische Verfassung des trostlosen Protagonisten, eine selbstkritische Inventur seiner Versäumnisse, die verpassten Gelegenheiten bestimmen große Teile dieses Romans. Überzeugt hat mich letztendlich weder die Geschichte selbst noch ihre sprachliche Umsetzung, das Fragmentarische wirkt arg konstruiert, es erzeugt zudem keine positive Wirkung im Rahmen des kargen Plots. Das sogenannte «Vorspiel» ist einfach nur stilistische Spielerei, und auch die Wechsel der Erzählperspektive tragen nichts erkennbar Positives bei, sie erscheinen mir reichlich unmotiviert. Von den Bienen schließlich erfährt man so gut wie nichts, dabei hätte ihr Sozialverhalten für die aufgeworfenen philosophischen Fragen so manche Anregung geben können. Wahrlich kein Jahrhundertroman!
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Der Verrückte des Zaren
 Wahrheit als Menetekel
Wahrheit als Menetekel
Aus dem estnischen Sprachraum sind nur wenige Schriftsteller einer breiteren Leserschaft bekannt, Jaan Kross nimmt dabei zweifellos den Spitzenplatz ein. Er gilt als führender Nationaldichter seines Landes und wurde zeitweise sogar als Nobelpreis-Kandidat angesehen. Sein Roman «Der Verrückte des Zaren» ist sein erfolgreichstes Werk, es wurde in viele Sprachen übersetzt und behandelt, wie die meisten seiner Werke, einen historischen Stoff. Was auch hier die ewige Frage aufwirft, wie viel von dem Erzählten denn nun authentisch ist und wie viel fiktional. Kroos hat seinem Buch nicht nur ein mehrseitiges Nachwort beigefügt, wo diese Fragen geklärt werden, sondern auch zwei umfangreiche Verzeichnisse mit Orten und weiterführenden Anmerkungen.
Ich-Erzähler des Romans ist die fiktive Figur Jakob Mättik, ein aus einfachen Verhältnissen stammender Bauernjunge, der aber auf Druck des Vaters mit seiner Schwester Eeva früh lesen und schreiben gelernt hat. Was wir lesen als Roman ist Jakobs Tagebuch, beginnend am 26. Mai 1827. Er hat es begonnen, als der – historisch belegte – Gutsbesitzer Timotheus von Bock zum Entsetzen des Adels Eeva zur Frau nimmt. Timo hat als Offizier in Sankt Petersburg Karriere gemacht und wurde als Oberst Flügeladjutant des Zaren Alexander I, der ihn aufforderte, ihm stets die Wahrheit zu sagen. In einer vielseitigen Denkschrift, die beinahe dem Entwurf einer neuen Verfassung gleich kommt, benennt Timo nun gravierende Missstände und innere Widersprüche im russischen Reich und weist auf die Mitschuld des Zaren hin. Prompt wird er verhaftet und an einem unbekannten Ort interniert. Unter Zar Nikolaus I wird er schließlich acht Jahre später für verrückt erklärt und unter strengen Auflagen auf sein Gut verbannt. Bald hält Timo es in dieser bedrückenden Situation nicht mehr aus und beschießt, ins Ausland zu flüchten, was sich aber als ein recht schwieriges Unterfangen erweist, das mehrmals widriger Umstände wegen abgebrochen werden muss. Als schließlich dann irgendwann alles günstig steht für eine Flucht, beschließt Timo im letzten Moment, doch in seiner Heimat zu bleiben, nicht feige zu flüchten. Sieben Jahre später stirbt er unter mysteriösen Umständen.
Der Ich-Erzähler zitiert in dieser zentralen Geschichte zahlreiche Dokumente und ergänzt sein Tagebuch mit einem Geflecht aus Rückblenden, historischen Begebenheiten und Ereignissen in seinem eigenen Leben, wobei das Leben des Adels im russischen Feudalismus ebenso anschaulich geschildert wird wie das Alltagsleben auf einem estnischen Gutshof. Das im Roman behandelte Problem der absoluten Wahrhaftigkeit, an dem der ebenso naive wie unberechenbare Held scheitert, ist ein – jeden einzelnen Menschen betreffendes – moralisches Dilemma, ohne Notlüge zumindest wäre unser Leben ja schlichtweg nicht vorstellbar. Kross schreibt in einer klaren, komprimierten Sprache ohne Schnörkel, wobei insbesondere die vielen Dialoge sehr lebensecht wirken, man fühlt sich dadurch regelrecht hineingezogen in diese Geschichte, so als wäre man dabei. Die Figuren sind glaubwürdig beschrieben und wirken allesamt sympathisch, ihr Seelenleben jedoch bleibt ausgeklammert, ihre Emotionen werden nicht thematisiert. Das gilt insbesondere auch für den «Verrückten», dessen Geisteszustand bis zuletzt nicht ganz zweifelsfrei geklärt ist. In seinem Sohn, der ein linientreuer Offizier des Zaren geworden ist, erkennt Timo am Ende resignierend seine Ohnmacht, der Wahrhaftigkeit zum Sieg verhelfen zu können.
Kann die kritiklose Befolgung gesellschaftlicher Normen kompromisslose Idealisten zu vermeintlichen Irren machen, die schließlich sogar selber glauben, verrückt zu sein? Kross wirft hier eine philosophische Frage auf, die nicht nur in totalitären Systemen wie dem feudalistischen Russland relevant ist und allen Anlass zum vertiefenden Weiterdenken gibt. Auch deshalb ist dieser bis hin zum Nachwort spannend bleibende Roman eine bereichernde, überaus lohnende Lektüre.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Das Buch von Blanche und Marie
 Omnia vincit amor
Omnia vincit amor
Auch in seinem 2004 erschienenen Roman «Das Buch von Blanche und Marie» geht der schwedische Schriftsteller Per Olof Enquist, wie oft in seinem Œuvre, von historischen Personen aus, die ihm als Bindeglied für seinen Plot dienen. Herausgekommen ist dabei ein pseudo-dokumentarischer Roman, dessen wahrer Kern nicht nur fiktional ausgeschmückt ist, sondern fast untergeht vor allzu unbekümmert Hinzuphantasiertem.
Vergils «omnia vincit amor», Liebe besiegt alles, steht auf dem Deckel einer braunen Mappe mit dem Titel «Fragebuch», das drei Notizbücher enthält. Das lateinische Motto bezeichnet Enquist als Arbeitshypothese, seine Handlung baut auf diesen Notizbüchern von Blanche Wittmann auf, berühmte Patientin von Professor Jean Martin Charcot, dem Leiter der psychiatrischen Anstalt Salpêtrière in Paris, im Jahre 1862 mit 4000 Patientinnen größtes Hospiz in Frankreich. In seiner regelmäßig veranstalteten, eher als Show inszenierten Vorlesung zu seinem Forschungsthema Hysterie dient ihm Blanche als williges Medium. Einer seiner Assistenten ist Sigmund Freud, und die gaffenden Zuschauer sind nicht nur Studenten, sondern viele berühmte Leute aus ganz Europa. Die titelgebende zweite Protagonistin des Romans ist Marie Skłodowska Curie, die berühmte Wissenschafterin polnischer Herkunft, Entdeckerin des Radiums, zweifache Nobelpreisträgerin sowohl für Physik (1903) als auch für Chemie (1911). Nach dem Unfalltod ihres Mannes hat sie eine stürmische Liebesbeziehung mit einem verheirateten Physikprofessor, die als Langevin-Affäre in Frankreich hohe Wellen schlägt und fortan als ewiger Makel an ihr hängen bleibt.
Soweit die Fakten. Postfaktisch hingegen, um eine dümmliche Wortschöpfung unserer Tage auch mal zu benutzen, ist die jahrelang unterdrückte Liebesbeziehung zwischen Blanche und Professor Charcot. Nach dessen Tod wird sie Assistentin bei Marie Curie, erleidet durch hohe Strahlungen bei ihrer Arbeit schwere gesundheitliche Schäden, beide Beine und der linke Arm müssen amputiert werden, sie sitzt als Torso fortan in einer rollenden Kiste. Die beiden Frauen werden enge Freundinnen, zu denen sich als dritte Jane Avril gesellt, kurzzeitig ebenfalls Patientin von Professor Charcot, später dann im Moulin Rouge berühmt gewordene Tänzerin, vielfach portraitiert von Toulouse Lautrec und auf ihren Plakaten omnipräsent bis heute.
«Die Liebe kann man nicht erklären. Aber wer wären wir, wenn wir es nicht versuchten?» Dieser Versuch ist hier misslungen, mit der Liebe als Zentralthema hat sich Enquist total verhoben. Marie scheitert kläglich mit ihrer ehebrecherischen Liaison, Blanche verkümmert in ihrer unerfüllten und, sieht man von einer irrealen Schlussszene ab, ewig platonischen Liebe zu Charcot. Dem uralten Thema Liebe gewinnt der Autor keine neuen Facetten ab, er verfällt vielmehr zusehends in peinliches Pathos dabei. Schon eher ist da die Aufdeckung der schaurigen Frühgeschichte der Psychiatrie zu loben, der tadelnde Hinweis auf die mühsame Emanzipation der Frauen, die Kritik des naiven Fortschrittsglaubens jener Zeit. Das Interessanteste aber, die faszinierende Figur der genialen Forscherin Marie Curie, wird kaum gebührend gewürdigt, sie ist als Romanfigur weitgehend auf ihre Liebesaffäre reduziert.
Schon ein Blick ins Inhaltsverzeichnis, das die einzelnen Kapitel als Gesänge bezeichnet, macht stutzig und kündet von Esoterischem. Der melancholische Plot verstört durch unmotivierte zeitliche und gedankliche Sprünge und lästige Wiederholungen, deren nervigste, geradezu sadistisch anmutende für mich der gefühlt hundertmal erwähnten Torso in der rollenden Kiste war. Vollends fragwürdig aber wird dieser Roman durch seinen holzschnittartigen Sprachstil, durch verstümmelte Sätze mit merkwürdiger Interpunktion, die das Verständnis behindern statt es zu fördern. Liebe und leidenschaftliche Forschung belegen, das ist mein Fazit aus dieser Lektüre, nun mal keine gleichen Areale in unserer Seele, sie sind wesensfremd.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
Über den Winter
 Vom Gewinn beim Scheitern
Vom Gewinn beim Scheitern
Hochaktuell erscheint uns Rolf Lapperts neuer Roman «Über den Winter» gleich im Prolog, der mit dem letzten Kapitel eine lose Klammer bildet um die Handlung, eines verschwundenen Koffers wegen, aber das nur nebenbei. Das Thema Bootsflüchtlinge nämlich leitet den Plot ein, bleibt jedoch auf die Einleitung begrenzt. Meine anfängliche Vermutung, dass die Wahl dieses Romans unter die Finalisten des Deutschen Buchpreises 2015 dieser Thematik wegen erfolgt sein könnte, erwies sich somit als falsch. Auch in diesem Roman etabliert der Schweizer Schriftsteller einen typischen Antihelden, und man fragt sich unwillkürlich und auch ein wenig skeptisch, wo diese melancholische Prosa hinführen soll.
Lennard Salm, mäßig erfolgreicher, knapp fünfzigjähriger Objektkünstler mit illegalem Atelier in einem Abrisshaus in New York, sammelt am Strand des Mittelmeers Treibgut von gekenterten und ertrunkenen Bootsflüchtlingen für eine geplante neue Installation. Der plötzliche Tod seiner Schwester Helene jedoch zwingt ihn, nach Hamburg zu reisen, wo seine Familie wohnt, von der er sich seit Jahren entfremdet hat. Er scheut das Wiedersehen mit seinen Angehörigen, würde am liebsten zur Beerdigung nicht erscheinen. Der ewig zaudernde, völlig irrational handelnde Protagonist verkörpert den Prototyp des gescheiterten Künstlers, seine Kreativität ist auf den Nullpunkt gesunken, was dazu führt, dass er seinem Manager und Mäzen schließlich das Ende seiner künstlerischen Tätigkeit verkündet. Wovon er denn leben wolle, fragt der belustigt, Lennard verweist auf seine Ersparnisse, mit denen er bescheiden zwei bis drei Jahre leben könne. Auf die Frage: Und dann? weiß er keine Antwort.
In einer Art Gegenentwicklung zu seinem Niedergang als Künstler erwickelt der introvertierte, lethargische Antiheld allmählich empathische Züge, nähert sich sehr langsam seinen Angehörigen, die wie er in prekären Verhältnissen leben. Der Vater verarmt und fast erblindet, als Pflegefall von einer Polin betreut, die unkonventionelle Schwester Billie, die in seinem Beisein ihren Job als Regieassistentin verliert, von einer selbstbetriebenen Suppenküche faselt. Er lernt die anderen Mieter im Haus des Vaters kennen, kommt einer Mitbewohnerin und ihrem chaotischen Sohn näher, kümmert sich mit ihm zusammen schließlich um ein ausgemergeltes, herrenloses Pferd. Trotz aller deprimierenden Umstände, in denen Lapperts diverse Figuren leben, strahlt seine im Grunde traurige Geschichte allmählich doch Zuversicht aus, entsteht zaghaft menschliche Nähe, wächst das Verständnis füreinander.
Der Klappentext spricht von einem Familienroman, mir waren viele der anderen Figuren, die der Autor so überaus subtil beschreibt, ebenso wichtig. Berührend menschlich zum Beispiel fand ich eine Szene mit einem türkischen Schneider, bei dem Lennard gleich zu Beginn seinen schwarzen Anzug für die Beerdigung kauft, aber auch seine Begegnungen mit Hotelportiers, Taxifahrern, dem Bauern, bei dem er Heu und Stroh für das Pferd kauft oder dem durchgeknallten Schauspieler, der beim Vorsprechen für eine Rolle ausrastet und um sich schießt. All dies wird in einer leicht lesbaren, klaren Sprache einsträngig erzählt, wobei sich der Autor viel Zeit lässt, seine Szenen wunderbar anschaulich zu beschreiben. Die immer wieder thematisierte klirrende Kälte dieses Winters überstrahlt metaphorisch das gesamte Geschehen. Und auch wenn der traurige Held überzeichnet erscheint in seiner Weltfremdheit und seine Metamorphose vom Künstler zum Familienmenschen etwas unglaubwürdig, so ist die Wirkung auf den Leser im Verlaufe seiner Lektüre gleichwohl angenehm berührend in ihrer allmählich erfreulicheren emotionalen Entwicklung. Das alles ist gekonnt erdacht und in Szene gesetzt, ein nachdenklich machender Roman vom Scheitern also, von den nicht geglückten Lebensläufen, lesenswert mithin, wenn man auf die subtilen Zwischentöne zu achten gewillt ist – und die erforderliche Geduld mitbringt.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de



