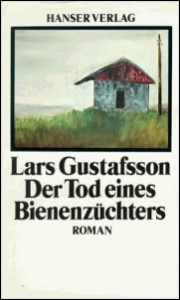 Kein Jahrhundertroman
Kein Jahrhundertroman
Der jüngst verstorbene schwedische Schriftsteller und Philosoph Lars Gustafsson hat ein vielseitiges Œuvre aufzuweisen, in dem neben philosophischen, lyrischen und literaturwissenschaftlichen Werken auch die Epik eine gewichtige Rolle einnimmt. «Ich neige dazu, mich als einen Philosophen zu betrachten, der die Literatur zu einem seiner Werkzeuge gemacht hat» lautet seine Selbsteinschätzung. Seine fünfteilige Romanreihe «Risse in der Mauer» wird durch den 1978 erschienenen Roman «Der Tod eines Bienenzüchters» abgeschlossen, der von der Süddeutschen Zeitung durch Aufnahme in ihre Bibliothek «Hundert große Romane des 20. Jahrhunderts» exemplarisch hervorgehoben wurde. Zu Recht?
Bei einem solchen Titel darf der Leser natürlich keine leichte Lektüre erwarten, und so ist man hier auch schon bald ziemlich betroffen von der emotionslosen Schilderung des Sterbens – nicht des Todes – eines erschreckend vereinsamten Menschen. Der Verfasser stellt seinen Protagonisten Lars Lennart Westin als vierzigjährigen, vorzeitig pensionierten Volksschullehrer vor, früh gealtert, geschieden, kinderlos, der allein und abgeschieden in einer einfachen Kate wohnt und seinen Lebensunterhalt unter anderem als Bienenzüchter bestreitet. Ein viel zu spät erkanntes Krebsgeschwür wird seine Todesursache sein, lässt uns der Autor in einer als «Vorspiel» bezeichneten Einleitung wissen, in der ein anonymer Erzähler sich dann schließlich direkt an die Leser wendet: «Die Stimme, die ihr von jetzt an hören werdet, ist seine, nicht meine, und deshalb nehme ich hier von euch Abschied.» Es folgt eine Quellenübersicht, die drei Notizbücher nennt, deren ältestes 1964 begonnen wurde.
Als Ich-Erzähler berichtet Westin nun zunächst selbst von seiner Untersuchung in der Klinik, deren Ergebnis ihm per Brief zugeht, den er aber aus Angst vor dem darin enthaltenen Befund nicht öffnet. «Diesen Brief benutzte er als Fidibus» heißt es am Ende des Kapitels, er verbrennt ihn ungelesen. Nach zwei weiteren Kapiteln über seine Ehe und seine Kindheit werden immer wieder seine Schmerzen thematisiert, denen er trotzig gegenübertritt, dem Motto von Nietzsche folgend: «Was mich nicht umbringt, macht mich stärker». Überirdisches ist Thema im Kapitel «Als Gott erwachte», eine herbei fantasierte Wunschwelt, die uns mit einem grenzenlos gütigen Gott überrascht. Nach einer Rückblende auf glückliche Zeiten in der Jugend unter dem Titel «Memoiren aus dem Paradies» leitet das letzte Kapitel mit kurzen Textfragmenten in die Schlussphase der Krankheit ein, endend mit dem Krankenwagen, der ihn holen kommt. «Man kann immer noch hoffen» lautet der letzte Satz, der im Roman des Öfteren zitiert wird
Der handlungsarme Roman ist in einer einfachen Sprache geschrieben, nüchtern und sachlich wird da erzählt, nordisch unterkühlt, wie ich finde. Mehr Verlorenheit als bei dieser einsamen Figur des Bienenzüchters ist selten zu finden, er ist extrem beziehungsarm und geht einem einsamen Tod entgegen. Sein Hund und die Natur, die seine Kate umgibt, sind alles, was sein Dasein ein wenig erhellt, Westins Sterben ist eher ein Krepieren in einer selbst gewählten Isolation. Philosophische Mutmaßungen über das Ich, die seelische Verfassung des trostlosen Protagonisten, eine selbstkritische Inventur seiner Versäumnisse, die verpassten Gelegenheiten bestimmen große Teile dieses Romans. Überzeugt hat mich letztendlich weder die Geschichte selbst noch ihre sprachliche Umsetzung, das Fragmentarische wirkt arg konstruiert, es erzeugt zudem keine positive Wirkung im Rahmen des kargen Plots. Das sogenannte «Vorspiel» ist einfach nur stilistische Spielerei, und auch die Wechsel der Erzählperspektive tragen nichts erkennbar Positives bei, sie erscheinen mir reichlich unmotiviert. Von den Bienen schließlich erfährt man so gut wie nichts, dabei hätte ihr Sozialverhalten für die aufgeworfenen philosophischen Fragen so manche Anregung geben können. Wahrlich kein Jahrhundertroman!
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de

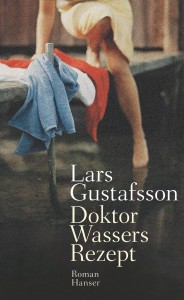 Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.
Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.