 Im Drogensumpf
Im Drogensumpf
Das seinerzeit vielbeachtete Romandebüt «Adler und Engel» der Schriftstellerin Juli Zeh hat 2001 weithin Anerkennung gefunden. Inzwischen sind sieben weitere Romane von ihr erschienen, von allen erweist sich ziemlich eindeutig «Unterleuten» als ihr bisher bester, der Hype um den Erstling ist heute kaum mehr nachvollziehbar. Die journalistisch tätige und politisch engagierte Volljuristin ist durch Fernsehauftritte auch außerhalb des Lesepublikums bekannt, seit 2019 ist sie ehrenamtlich Richterin am Verfassungsgericht in Brandenburg. Ihre juristische Expertise nutzend ist der Protagonist ihrer melancholischen Geschichte denn auch prompt ein Karriere-Jurist.
Ich-Erzähler Max, der picklige, 33jährige Leiter der Leipziger Dependance einer Wiener Anwaltskanzlei, seit zwei Jahren mit seiner fünf Jahre jüngeren Jugendliebe Jessi zusammenlebend, erleidet ein fürchterliches Trauma. Während eines Telefonats mit der psychisch kranken Kindfrau droht sie damit, sich zu erschießen. Und tut es tatsächlich auch gleich, sie schießt sich, den Hörer in der Hand, mit einer Pistole in den Kopf. Völlig aus der Bahn geworfen, weil es ihm nicht gelungen ist, sie aus ihren ständigen Angstzuständen zu befreien, wirft er seinen gutdotierten Job hin. Er schnupft Kokain in selbstzerstörerischen Mengen und ruft schließlich verzweifelt bei einer mitternächtlichen Radiosendung an, wo live Gespräche mit aus der Bahn Geworfenen wie ihm geführt werden. Die toughe Moderatorin Clara ist sehr an seiner Geschichte interessiert, sie würde gern ihre Diplomarbeit darüber schreiben. Es gelingt ihr, ihn zu einer Reise nach Wien zu überreden, wo sie in der Nähe ein unbewohntes Bauernhaus besitzt, in dem er, vom Außenleben abgeschirmt, seine abenteuerliche Geschichte auf Band sprechen soll.
Zweisträngig wird in wilden Zeit- und Ortsprüngen abwechselnd die turbulente Vorgeschichte mit Jessi erzählt sowie die von Max und Clara bei ihrem Versuch, das Vergangene zu rekonstruieren. Jessi war die Tochter eines Drogenbosses, der den Schmuggel auf der Balkanroute und dann weiter mit Schnellbooten über die Adria organisiert hat. Dieser thrillerartige Plot verblüfft durch seine einfallsreichen Wendungen, die den Leser sehr häufig in seinen Erwartungen ziemlich überraschen. Juli Zeh erzählt ihre Geschichte in einer unterkühlten, sachlichen Sprache. Der in zwei mit Leipzig und Wien betitelte Abschnitte unterteilte Roman ist akkurat in 32 Kapitel aufgeteilt, was die Orientierung ein wenig erleichtert. Denn geradezu irrwitzig faselt Max in der Erzählung auch noch häufig im Kokain-Delirium, man ist nie ganz sicher, was davon real ist und was phantasiert.
Die Autorin hätte besser daran getan, ihren verzwickten Plot mit seiner unterschwelligen Kapitalismus-Kritik deutlich zu straffen, insbesondere die zu nichts hinführenden Nebenstränge der Handlung zu Gunsten einer stringenten Schilderung der eigentlichen Story einfach wegzulassen. Denn gerade diese überflüssigen Umwege und erzählerischen Sackgassen bewirken eine zunehmende Ermüdung beim Lesen, weil wenig passiert und man sich bald schon sehr langweilt. Die Figuren sind als Charaktere allesamt wenig glaubwürdig und tragen absolut nichts dazu bei, als Sympathieträger Aufmerksamkeit oder gar Interesse zu erwecken. Besonders störend ist, dass die drei Protagonisten Max, Jessi und Clara als menschliche Wracks dargestellt sind. Wobei Clara erst im Verlauf der Geschichte dazu wird, – warum, das bleibt völlig offen. Sie sind gleichermaßen von ständigen Schmerzen geplagt und dauerhaft bekifft, essen kaum etwas, kotzen häufig und vegetieren in einer ekelerregenden Umgebung dahin. Durch permanentes Chaos wird ein Unbehagen erzeugt, welches das Lesen zunehmend unliebsam, teils schon fast lästig werden lässt. Und allzu vieles in der Erzählung bleibt unplausibel oder völlig sinnfrei. Man könnte fast auf die Idee kommen, dass dieser eiskalte Drogenthriller in einem halluzinatorischen Rausch geschrieben wurde, wirr und irreal.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
 Pop-Trash
Pop-Trash Symbiose von Moral und Wortwitz
Symbiose von Moral und Wortwitz Ein Mythos wird entlarvt
Ein Mythos wird entlarvt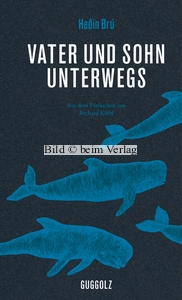 Eine literarische Nische
Eine literarische Nische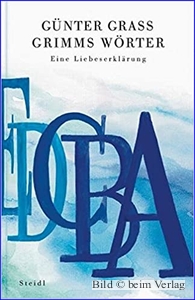 Ambivalentes Spätwerk
Ambivalentes Spätwerk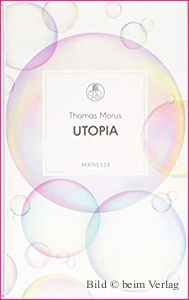 Triumph der Vernunft
Triumph der Vernunft Märkische Behaglichkeit am Niederrhein
Märkische Behaglichkeit am Niederrhein Esoterischer Kosmos
Esoterischer Kosmos Leserherz, was willst du mehr?
Leserherz, was willst du mehr? Wenn ihr so weitermacht
Wenn ihr so weitermacht
 Ironisches Requiem
Ironisches Requiem Schwaches Büchlein
Schwaches Büchlein Durchs Raster gefallen
Durchs Raster gefallen