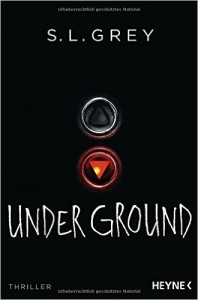 Ein tödliches Grippevirus grassiert in den USA. Während Chaos um sich greift, flieht eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen in einen unterirdischen Luxusbunker – das Sanctum –, ihre eigene, sich selbst versorgende Welt. Doch schon bald befeuern Abschottung und Enge erste Spannungen unter den Bewohnern. Als der Erbauer des Bunkers tot aufgefunden wird, bricht Panik aus. Mit ihm ist der Code zum Öffnen der Türen verloren. Der Sauerstoff wird knapp. Die Wasservorräte schwinden. Der Kampf ums Überleben beginnt.
Ein tödliches Grippevirus grassiert in den USA. Während Chaos um sich greift, flieht eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen in einen unterirdischen Luxusbunker – das Sanctum –, ihre eigene, sich selbst versorgende Welt. Doch schon bald befeuern Abschottung und Enge erste Spannungen unter den Bewohnern. Als der Erbauer des Bunkers tot aufgefunden wird, bricht Panik aus. Mit ihm ist der Code zum Öffnen der Türen verloren. Der Sauerstoff wird knapp. Die Wasservorräte schwinden. Der Kampf ums Überleben beginnt.
Bereits seit einiger Zeit wütet ein tödliches Virus in Asien und tausende Menschen sterben. Nun ist das Virus auch in den USA angelangt und das Massensterben beginnt…
Wie gut dass es das „Sanctum“, einen unterirdischen Luxusbunker, versteckt in den Wäldern von Maine gibt. Für 1,5 Millionen Dollar kann man sich dort ein Luxusappartement mieten um einer drohenden Katastrophe zu entfliehen. Auf 7 Etagen sind 6 Luxussuiten, ein Aufenthaltsraum, ein Fitnessraum, Swimmingpool, eine Krankenstation, eine kleine Hühnerfarm, und ein kleiner Hydrokulturgarten verteilt. So soll das Überleben für ein Jahr gesichert sein.
Aber der Platz im Sanctum ist begrenzt und nur wenige haben das Glück sich so ein Appartement sichern bzw überhaupt leisten zu können.
Fünf extrem unterschiedliche Familien treffen zu Beginn der Geschichte im Sanctum ein, klar dass Spannungen vorprogrammiert sind. Denn nicht nur die grundverschiedenen Charaktere gestalten das Leben im Bunker als schwierig, der Erbauer des Sanctum hat in seiner Hochglanzbroschüre auch mächtig übertrieben und an allen Ecken und Enden gespart…
Die Krankenstation ist nicht einmal ansatzweise fertig, so dass es keinerlei ärztliche Versorgung gibt, der Fahrstuhl zwischen den einzelnen Etagen funktioniert nicht, Essensvorräte und Wasser reichen nicht annähernd für ein Jahr und Vieles ist einfach nur billig zusammengeschustert.
Bereits nach ein paar Tagen bricht ein kleines Feuer aus, welches die Internetverbindung zur Außenwelt abschneidet und der Erbauer Greg wird tot aufgefunden. Leider hatte er kurz vor seinem Tod wohl noch den Sicherheitscode für die Einstiegsluke geändert und diese Luke ist scheinbar das Einzige woran nicht gespart wurde…
Die Geschichte beginnt damit dass erst einmal alle Familien getrennt voneinander auf dem Weg ins Sanctum sind und man einen so einen ersten Eindruck von den Bewohnern bekommt:
• Da wäre die kanadische Zahnärztin Stella, mit Ihrem koreanischen Mann und dem Teenager Sohn Jae, der am liebsten den ganzen Tag World of Warcraft spielt und chattet
• das stinkreiche, verwöhnte und ziemlich arrogante Ehepaar James und Vicky, dessen Ehe auch schon besser Tage gesehen hat
• der alleinerziehende Vater Tyson, mit seiner vier jährigen Tochter Sarita und dem südafrikanischen Aupair Mädchen Cait, die Mitte 20 ist und einfach nur wieder nach Hause möchte
• das 70-jährige Ehepaar Dannhauser und ihre 40 jährige Tochter Trudi
• der Erbauer und Besitzer Greg
• sein Bauleiter Will, der eigentlich gar nicht im Sanctum bleiben sondern zurück zu seiner schwerkranken Frau wollte
• und zu guter Letzt die Familie Guthrie. Vater Cameron und Teenagersohn Brett sind absolute „Alphamännchen“, Waffenbesessen, rassistisch und totale Machos. Mutter Bonnie hat absolut nichts zu sagen, will sie aber auch eigentlich gar nicht denn sie ist übertrieben religiös, eigentlich schon fanatisch und beschäftigt sich am liebsten mit ihrer Bibel und Gebeten. Bretts Zwillingsschwester Gina könnte man schon fast als Hausmädchen statt als Familienmitglied bezeichnen und sie hat noch viel weniger zu melden als Mutter Bonnie.
Klar dass das totale Chaos bei so einer Konstellation, unter Extrembedingungen auf engstem Raum vorprogrammiert ist.
Die Geschichte wird Kapitelweise aus der Sicht von verschiedenen Personen erzählt, wobei aber nicht die Sicht von allen Personen geschildert wird. Interessant fand ich dass die Kapitel über drei bestimmte Personen immer aus der Ich-Erzählperspektive geschildert werden, die anderen aber nicht.
Das Buch war der totale Hammer, von Anfang an sehr spannend und ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen, so dass ich die knapp 400 Seiten in Windeseile durch hatte.
Absolut großartig, sehr zu empfehlen!!
S.L Grey ist das Pseudonym der beiden Bestsellerautoren Sarah Lotz und Louis Greenberg. Sie leben beide in Südafrika. Unter ihrem Pseudonym beschäftigen sie sich mit Geschichten in denen Menschen in Extremsituationen geraten.
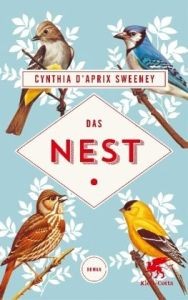 Kreatives Schreiben
Kreatives Schreiben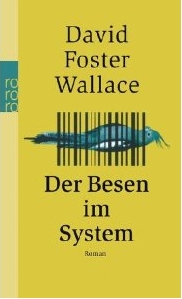 Für Leser mit Sinn für das Absurde
Für Leser mit Sinn für das Absurde Literarische Zauberei
Literarische Zauberei Das muss ihm erst mal einer nachmachen
Das muss ihm erst mal einer nachmachen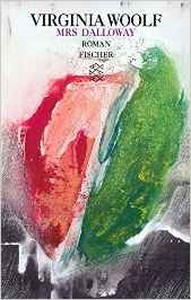 Keine Angst
Keine Angst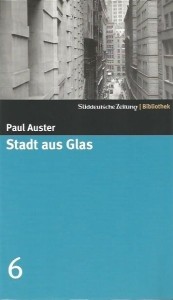 Spurensuche
Spurensuche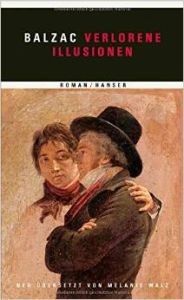 Vom Scheitern
Vom Scheitern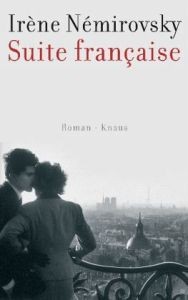 Ein literarischer Live-Mitschnitt
Ein literarischer Live-Mitschnitt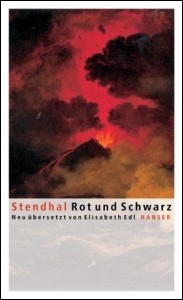 To the happy few
To the happy few Heilitler, Herr Düring
Heilitler, Herr Düring Eine Parabel auf uns alle
Eine Parabel auf uns alle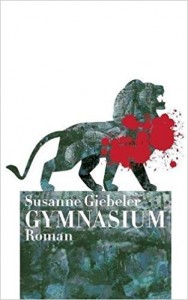 Alex kämpft um seine Familie, Kampfarena ist seine neue Schule. Alex denkt, wenn er es hier schafft, werden seine Eltern aufhören, sich wegen seiner schlechten Noten gegenseitig fertigzumachen. Am Gymnasium aber ringt die akademische Mittelschicht um ihren Status, schickt ihre Kinder ins Rennen … »Hanne Christ liebte ihr Kind und Birgit liebte ihres. Alle liebten ihre Kinder und wollten sie vor dem Niedergang bewahren, vor einem Dasein als Klempner, als Krankenschwester oder kaufmännische Angestellte.« Ein Schulroman voller wunderbar böser Beobachtungen. Eine Geschichte über erschöpfte Schüler, verzweifelte Mütter und ratlose Lehrer.
Alex kämpft um seine Familie, Kampfarena ist seine neue Schule. Alex denkt, wenn er es hier schafft, werden seine Eltern aufhören, sich wegen seiner schlechten Noten gegenseitig fertigzumachen. Am Gymnasium aber ringt die akademische Mittelschicht um ihren Status, schickt ihre Kinder ins Rennen … »Hanne Christ liebte ihr Kind und Birgit liebte ihres. Alle liebten ihre Kinder und wollten sie vor dem Niedergang bewahren, vor einem Dasein als Klempner, als Krankenschwester oder kaufmännische Angestellte.« Ein Schulroman voller wunderbar böser Beobachtungen. Eine Geschichte über erschöpfte Schüler, verzweifelte Mütter und ratlose Lehrer.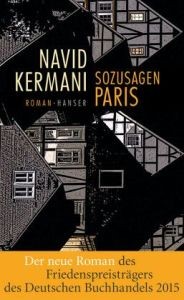
 Vom hässlichen Deutschen
Vom hässlichen Deutschen