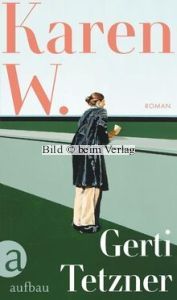 Authentisches Zeitzeugnis
Authentisches Zeitzeugnis
Der im Jahre 1974 in der damaligen DDR erschienene Debütroman von Gerti Tetzner mit dem Titel «Karen W.» wurde kürzlich als Wiederentdeckung in einer Neuauflage herausgebracht, ergänzt um ein ausführliches Interview mit der betagten Schriftstellerin. Zwischen der titelgebenden Protagonistin und Ich-Erzählerin Karen Waldau und der Autorin gibt es unübersehbare Parallelen, beide haben Jura studiert und als Notarin gearbeitet, insoweit ist dieser Roman einer Zeitzeugin autofiktional, sie verarbeitet eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Die zum «Weiberkreis» junger Autorinnen um Christa Wolf gehörende Gerti Tetzner wurde von der berühmten Kollegin bei ihrem Romanprojekt wohlwollend unterstützt, das Buch war dann mit einer hohen Auflage auf Anhieb auch sehr erfolgreich. Aber schon ihr nächster Roman wurde von der Zensur abgelehnt, – und sie wurde eindringlich davor gewarnt, ihn im Westen zu veröffentlichen. Demotiviert begann sie, einige Kinderbücher zu schreiben und geriet schließlich weitgehend in Vergessenheit.
Karen, die in der unschwer als Leipzig erkennbaren Universitätsstadt L. zusammen mit ihrem Freund Peters und der gemeinsamen Tochter Bettina lebt, war vor zwölf Jahren aus der Enge eines kleinen thüringischen Dorfes geflüchtet und nach dem Studium in der Stadt geblieben. Aber ihr Leben erscheint ihr eintönig und sinnlos, sie lebt mit Peters, ihrer einstigen großen Liebe, nur noch nebeneinander her. Als knapp Dreißigjährige will sie aus den Alltagstrott und der Enge des reglementierten Arbeitslebens ausbrechen und etwas Neues wagen, von dem sie allerdings noch nicht weiß, was das denn sein könnte. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion nutzt sie eine Reise ihres Partners und zieht unangekündigt aus, zurück in das Dorf ihrer Jugend. Das von den Eltern geerbte Haus ist an einen Tierarzt vermietet, der von seiner Frau verlassen dort allein lebt. Sie bietet ihm an, wohnen bleiben zu können, wenn sie die beiden ungenutzten Dachkammern mit ihrer Tochter beziehen kann. Die siebenjährige Bettina wird in der örtlichen Schule angemeldet, und Karen selbst sucht sich eine Arbeit in einer LPG. In der landwirtschaftlich geprägten Gegend werden überall händeringend Arbeitskräfte gesucht. Peters schreibt ihr irritiert hinterher: «Wohin treibst Du? Weißt Du, was Du riskierst?»
Karen erinnert sich nun an ihre Kindheit und Jugendzeit, an die erste Begegnung mit Peters, ihre schwierige Identitätssuche als junge Frau und die latenten Probleme mit der weiblichen Selbstbestimmung. Und sie denkt daran zurück, wie sie mit ihrem selbstbewussten, kritischen Denken immer wieder in Konflikt gekommen ist mit der allgegenwärtigen Staatsmacht, gegen die sie hilflos ist. Und genau diese Konflikte haben ihr auch das Zusammenleben mit Peters schwierig gemacht. So fragt sich Karen an einer Stelle: «Was war das bloß für eine Zeit und ein Land um mich rum? Immer blieb ich für oder gegen was verwickelt, und immer traf jede Wahl die ungewählte Kehrseite mit. Gab’s denn nie ein vollkommenes rundes Ja? Nicht mal in der Liebe?» Der Idealismus und Optimismus sowohl der Autorin als auch ihrer Ich-Erzählerin Karen bleibt ungebrochen. Beide sind sie selbstbewusst und unbeugsam überzeugt, in der Realität mit ihren abweichenden Meinungen und Zweifeln auf der richtigen Seite zu stehen.
Das Besondere am Roman von Gerti Tetzner ist die Tatsache, dass sie Mitte der siebziger Jahre das unrühmliche Ende der DDR ja nicht mitdenken konnte. Christa Wolf hatte in einer Stellungnahme zu 36 Manuskript-Seiten vom Romananfang neben einiger Kritik angemerkt, die «wachsende innere Inaktivität unter vielen jungen Leuten» als Thematik sei interessant und könne Kräfte wecken, «die unbewusst vorhanden sind und Bestätigung, Ermutigung, Anstoß brauchen». Der leicht lesbare Roman wirkt mit originellen Wörtern und Redensarten aus der Umgangssprache als Zeitzeugnis sehr authentisch, er ist trotz einiger Längen und häufiger Wiederholungen eine kontemplativ anregende, empfehlenswerte Lektüre!
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de
 Dschungelartiges Erzählspiel
Dschungelartiges Erzählspiel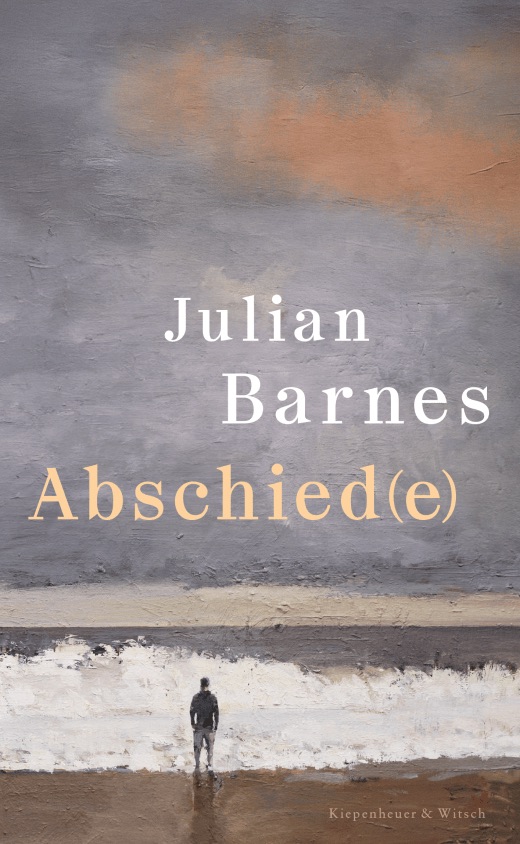
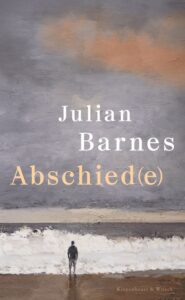 Ist die Erinnerung ebenso eine Konstruktion wie die Wirklichkeit? Julian Barnes, der diesen Monat 80 Jahre alt wird, blickt auf ein erfülltes Schriftstellerleben und stellt sich die wichtigsten Fragen des Seins: was ist wirklich wichtig und wer sind wir?
Ist die Erinnerung ebenso eine Konstruktion wie die Wirklichkeit? Julian Barnes, der diesen Monat 80 Jahre alt wird, blickt auf ein erfülltes Schriftstellerleben und stellt sich die wichtigsten Fragen des Seins: was ist wirklich wichtig und wer sind wir?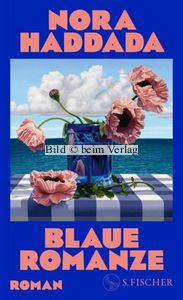 Polit-Seminar statt Liebes-Schnulze
Polit-Seminar statt Liebes-Schnulze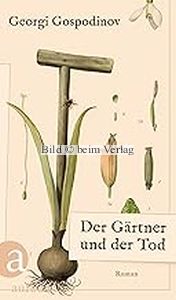 Bulgarische Scheherazade
Bulgarische Scheherazade Eine Stimme für das Unsagbare
Eine Stimme für das Unsagbare Listige Subjekt/Objekt-Umkehr
Listige Subjekt/Objekt-Umkehr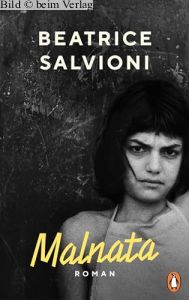 Deutschlandfunk trifft’s
Deutschlandfunk trifft’s
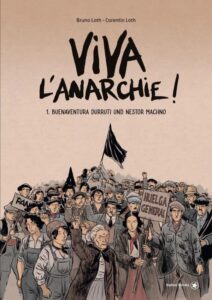
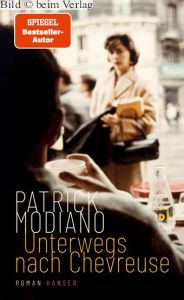 Anschreiben gegen das Vergessen
Anschreiben gegen das Vergessen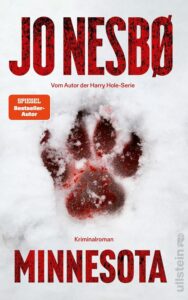
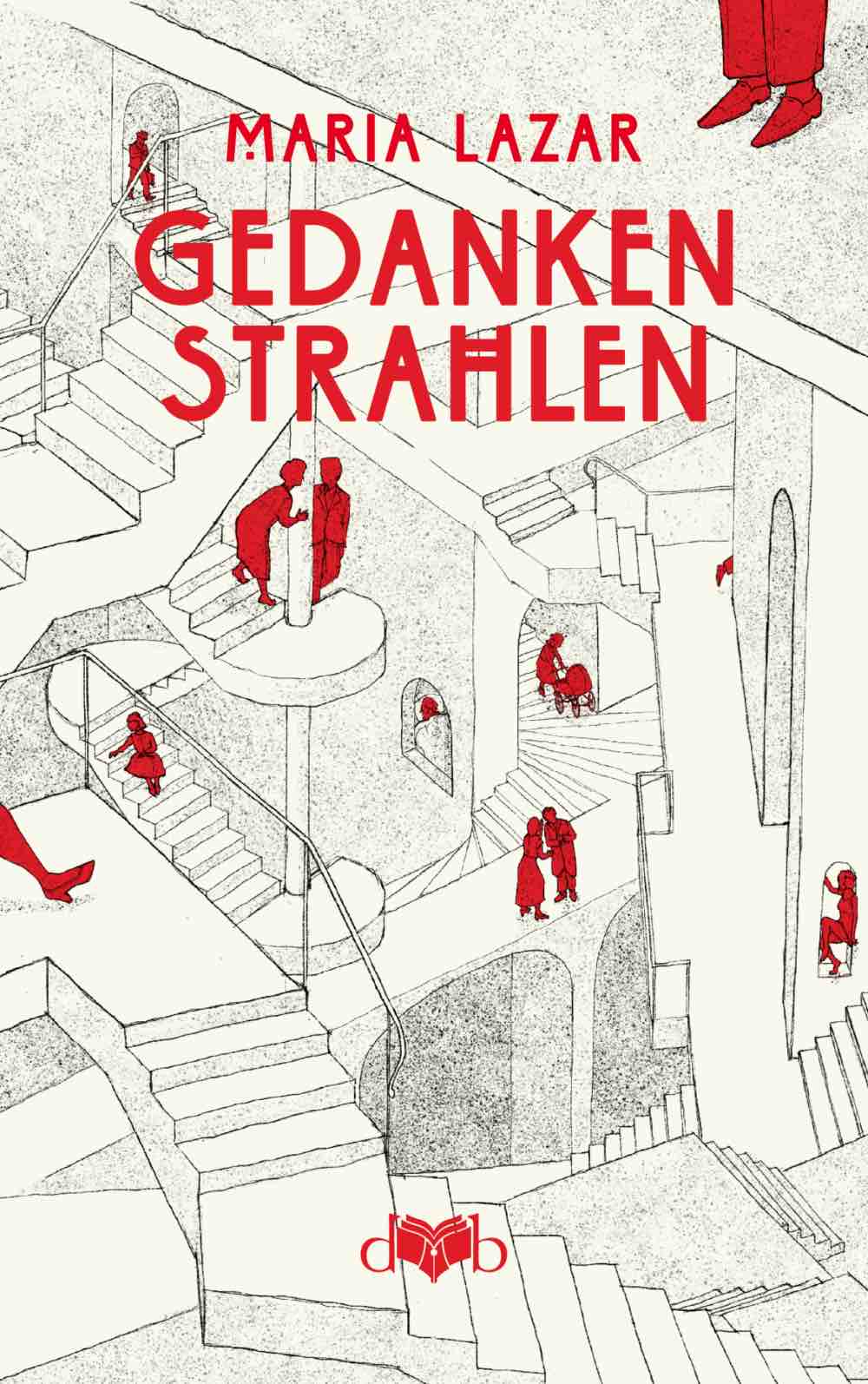
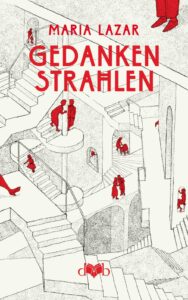 “Gedankenstrahlen” versammelt erstmals Meistererzählungen und Kurzgeschichten der Literaturentdeckung Maria Lazar (1895–1948) aus den späten 30er und frühen 40er Jahren, die zum Teil noch nie veröffentlicht wurden.
“Gedankenstrahlen” versammelt erstmals Meistererzählungen und Kurzgeschichten der Literaturentdeckung Maria Lazar (1895–1948) aus den späten 30er und frühen 40er Jahren, die zum Teil noch nie veröffentlicht wurden.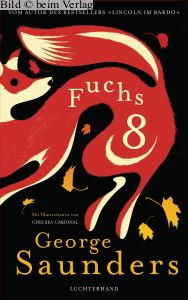 Linguistisch überschäumende Kreativität
Linguistisch überschäumende Kreativität Salman Rushdie hat viele Jahrzehnte in den Ländern gelebt, in denen seine Geschichten spielen: In Indien, im Vereinten Königreich und in den USA. Inzwischen ist er bald achtzig Jahre alt, aber er weiß noch, wie es sich anfühlte, dort zu leben, was die Menschen sehen, denken, fühlen. In seine Erzählkunst schöpft er aus der Fülle genauer Beobachtungen, auch von Details.
Salman Rushdie hat viele Jahrzehnte in den Ländern gelebt, in denen seine Geschichten spielen: In Indien, im Vereinten Königreich und in den USA. Inzwischen ist er bald achtzig Jahre alt, aber er weiß noch, wie es sich anfühlte, dort zu leben, was die Menschen sehen, denken, fühlen. In seine Erzählkunst schöpft er aus der Fülle genauer Beobachtungen, auch von Details. 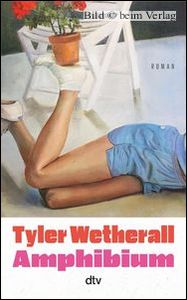 Adoleszenz eines toughen Mädchens
Adoleszenz eines toughen Mädchens