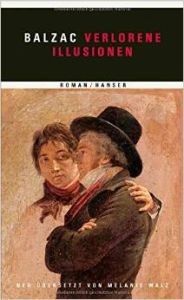 Vom Scheitern
Vom Scheitern
In dem gewaltigen Zyklus «Die menschliche Komödie» von Honoré de Balzac, der von den geplanten 137 Romanen und Erzählungen «nur» 91 Werke fertig stellen konnte, ist der 1843 erstmals in einem Band herausgegebene, dreiteilige Roman «Verlorene Illusionen» das umfangreichste und wohl auch schönste Werk. Die vorliegende Neuübersetzung von Melanie Walz macht die Lektüre dieses im Stil des literarischen Realismus erzählten, grandiosen Gesellschaftsromans sprachlich zu einem Leseerlebnis besonderer Art, ist es ihr doch gelungen, den vor etwa 180 Jahren geschriebenen, anspruchsvollen altfranzösischen Text in ein flüssig zu lesendes, modernes Deutsch zu transferieren. Gleichwohl wird dem Leser volle Aufmerksamkeit abverlangt in diesem großangelegten Sittengemälde, sowohl was die gewaltige Zahl an Figuren anbelangt als auch das adäquate Milieu, der uns Heutigen unbekannte Erfahrungshintergrund der damaligen Epoche, insbesondere in Hinblick auf die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und künstlerischen Gegebenheiten im Frankreich der ersten Hälfte des 19ten Jahrhunderts. Hilfreich dabei sind die Vorworte aus Balzacs Feder zu den ursprünglich drei einzelnen Bänden sowie insbesondere ein umfangreicher Anhang, in dem neben einem kenntnisreichen Nachwort der Übersetzerin vor allem deren umfangreiche Anmerkungen zum Text mir unabdingbar erscheinen zum tieferen Verständnis des vielschichtigen Geschehens.
Julien Chardon, ein auffallend schöner junger Mann, der sich für einen großen Dichter hält, wird von Madame de Bargeton protegiert, unumstrittene Grande Dame der Salons in der Provinzstadt Angoulême. Als sie mit ihm nach Paris geht, schämt sie sich dort plötzlich seiner Armut und Provinzialität wegen und überlässt ihn einfach sich selbst. Es gelingt Julien, sich in der Boheme der französischen Metropole als Journalist nach oben zu arbeiten, in die Gesellschaft eingeführt zu werden. Eine schöne Schauspielerin wird seine Mätresse, er lebt in Saus und Braus, bekommt aber schon bald Missgunst und Neid zu spüren und gelangt in einen finanziellen Abwärtsstrudel, dem er auch durch Glücksspiel und, als letzte Rettung, das Fälschen dreier Wechsel auf seinen Freund Daniel Séchard nicht entkommt. Er flüchtet aus Paris und kehrt nach Angoulême zurück. Daniel, der Juliens Schwester geheiratet hat, arbeitet dort verbissen an einer Erfindung zur Papierherstellung und vernachlässigt sträflich seine Druckerei, er bringt sich damit letztendlich in den Ruin. Die bei Fälligkeit präsentierten Wechsel kann er nicht einlösen und landet schließlich im Gefängnis. Julien als Schuldiger an diesem Unglück will sich daraufhin das Leben nehmen, trifft aber auf der Landstraße einen geheimnisvollen spanischen Abbé, der ihn von seinem Vorhaben abbringt. Er gibt ihm sogar das Geld für Daniel, mit dem der sich von allen seinen Schulden befreien kann, und macht ihn zu seinem Sekretär unter der Bedingung, dass er ihm blind gehorchen müsse, wofür er ihm in Paris eine glänzende Karriere ermöglichen werde.
Es sind in der Tat viele Illusionen, die Balzac als auktorialer Erzähler in seinem Roman platzen lässt. Er führt seine vielen überaus lebensvollen Figuren zielstrebig durch eine weit ausholende Handlung, immer mit dem Ziel, die Usancen und Hintergründe der vornehmen Gesellschaft und des korrupten Literaturbetriebs sowie der Theaterwelt seiner Zeit detailliert und so realistisch wie möglich darzustellen. Insoweit handelt es sich bei seinem Werk auch um ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte. Dünkel und Hochmut, Missgunst, Neid und Hass sind Auslöser absolut skrupelloser Ränkespiele und korrupter Machenschaften in dieser Erzählung, dem Sieg des Bösen stehen nur wenige ins Positive weisende Lebenslinien gegenüber, ein fürwahr pessimistisches Menschenbild, das Balzac da entworfen hat. Wer sich die Zeit nimmt, genüsslich in diesen Kosmos einzutauchen, dem stehen viele anregende Lesestunden bevor mit einem Klassiker der Weltliteratur.
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
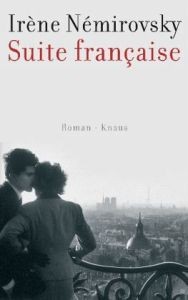 Ein literarischer Live-Mitschnitt
Ein literarischer Live-Mitschnitt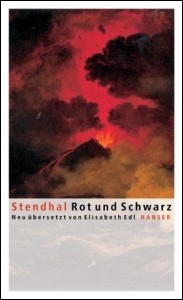 To the happy few
To the happy few Heilitler, Herr Düring
Heilitler, Herr Düring Eine Parabel auf uns alle
Eine Parabel auf uns alle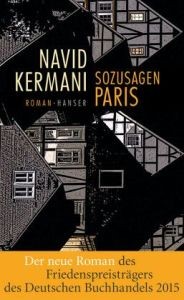
 Vom hässlichen Deutschen
Vom hässlichen Deutschen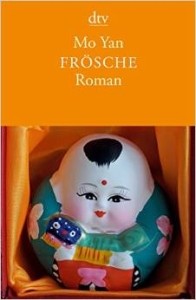 Halluzinatorischer Realismus
Halluzinatorischer Realismus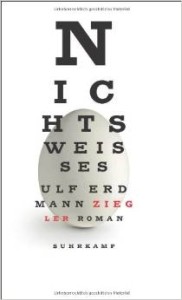 Dingbat
Dingbat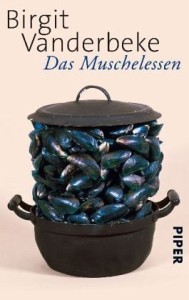 Demontage einer verlogenen Idylle
Demontage einer verlogenen Idylle
 Wenn die Kinder aus dem Haus sind
Wenn die Kinder aus dem Haus sind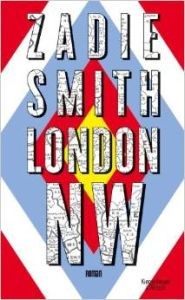 Bewundert und ungeliebt
Bewundert und ungeliebt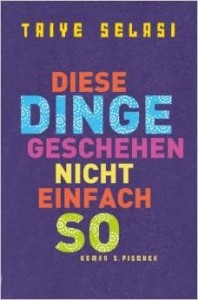 Quantität versus Qualität
Quantität versus Qualität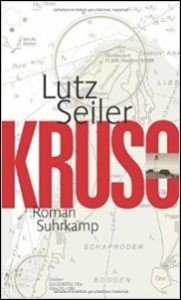 Magischer Realismus
Magischer Realismus