 Vom steinernen Zölibatär
Vom steinernen Zölibatär
Der im angelsächsischen Sprachraum als Kultautor verehrte Schriftsteller Henry James hat auch in dem Roman «Die Aspern-Schriften» von 1888 ein grandioses Beispiel geliefert für seine Kunst, psychologisch ausgefeilte Frauenfiguren zu erschaffen, das andere Geschlecht also vielschichtig und tiefgründig darzustellen. Dabei bleibt allerdings eine – nicht ganz unwichtige – Komponente des Weiblichseins völlig ausgeschlossen. Der Autor hat sich selbst mal als einen «sexuellen Selbstversorger» bezeichnet, seine Geschichte – wen wundert’s – ist ein geradezu puritanisch anmutender Text ohne jeden erotischen Esprit. Aber auch Wittgenstein hat ja in seinem berühmten Tractatus logico-philosophicus gefordert: «Wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen». Es bleibt aber, das sei vorweg gesagt, genügend übrig aus dem fragwürdigen Innenleben seiner Figuren, was diesen subtilen Roman trotzdem zu einem Lesevergnügen werden lässt.
In einem kammerspielartigen Plot mit nur drei Hauptfiguren und einem verfallenen Palazzo in Venedig als Bühne wird die Geschichte einer literarischen Obsession erzählt. Ein amerikanischer Ich-Erzähler, der namenlos bleibt und auch altersmäßig unbestimmt, ist als Herausgeber von Werken des – etwa um 1820 herum – jung verstorbenen, romantischen Dichters Jeffrey Aspern auf der Suche nach hinterlassenen Schriften von ihm. Dabei ist er auf Juliana Bordereau gestoßen, die einst zu seinen Musen gehörte und in seinem Werk etliche Spuren hinterlassen hat. Sie lebt hochbetagt mit Tina, ihrer Nichte ebenfalls unbestimmten Alters, die genau so gut auch ihre Großnichte sein könnte, völlig zurückgezogen in Venedig. Auf schriftliche Anfrage wird der Romanheld denn auch brüsk abgewiesen, also versucht er mit einer List, in die Nähe der uralten Dame, – eine Hundertjährige mutmaßlich -, und damit auch an die bei ihr vermuteten, begehrten Papiere zu kommen, Liebesbriefe höchstwahrscheinlich. Und tatsächlich zieht er unter falschem Namen und unter einem trickreichen Vorwand für eine horrende Summe als Untermieter in den Palazzo ein und kann auch tatsächlich, nach anfänglich eiskalter Abweisung seitens der Damen, allmählich einen Kontakt zu ihnen aufbauen. Seine wahnhafte Gier nach schriftlichen Zeugnissen seines Dichter-Idols, den er auf einer Stufe sieht mit Shakespeare, lässt ihn alle Demütigungen ertragen und bringt ihn finanziell an den Rand des Ruins. Moralische Skrupel kennt er nicht, «es gibt keine Niederträchtigkeit, die ich nicht um Jeffrey Asperns willen begehen würde» sagt er im Roman. Der Nichte verrät er schließlich den wahren Grund seines Aufenthalts im Palazzo, und nach dem ersten Schrecken deutet sie vage an, ihm vielleicht ja helfen zu können.
Die in neun Kapiteln konventionell erzählte, spannende Geschichte, die zeitlich nur einige wenige Monate umfasst, steigert sich in einer geschickten Dramaturgie auf ein so nicht unbedingt vorhersehbares Ende zu. Mit ihrem kenntnisreichen Nachwort gibt die Übersetzerin dem Leser eine hochwillkommene Ergänzung des Textes zur Hand, die auf dessen viele Bezüge zum Ambiente Venedigs eingeht, auf die im Roman beschriebenen Kunstwerke zudem, vor allem aber auf das verwirrend komplexe psychische Geflecht der drei Protagonisten. An dieser Stelle erfahren wir auch, dass all dem eine Anekdote zugrunde liegt von einem Geschehen, das sich im Jahre 1879 in Florenz zugetragen habe, – mit identischem Ausgang der Geschichte übrigens.
Der sprachlich recht altbackene Roman mit seiner enigmatischen Erzählweise lässt den Lesern reichlich Raum für eigene Interpretationen. Mit kriminalistischen Anklängen wird da von beiden Seiten ein ebenso schlitzohriger wie erbitterter, skrupelloser Kampf zwischen den Damen und dem im Nachwort als «steinerner Zölibatär» bezeichneten Ich-Erzähler geführt. Keiner von ihnen kann wirklich gewinnen, was einen nicht unwesentlichen Teil des – zugegeben – schadenfrohen Lesevergnügens ausmacht, bei mir war es jedenfalls so!
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Wenn Trennung obsolet wird
Wenn Trennung obsolet wird Für den idealen Leser
Für den idealen Leser Glücklich ist, wer vergisst
Glücklich ist, wer vergisst Prekär wie die gleichnamige Straße
Prekär wie die gleichnamige Straße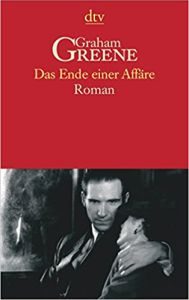 Der dritte Mann
Der dritte Mann
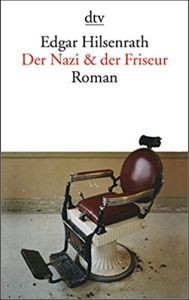 Widerlegt Adornos Diktum
Widerlegt Adornos Diktum Allegorie auf die Spaßgesellschaft
Allegorie auf die Spaßgesellschaft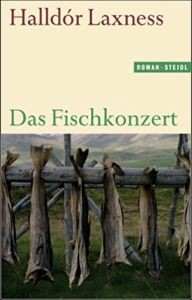 Das Beste von Laxness
Das Beste von Laxness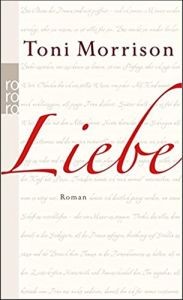 Liebe, Gier, Hass – eine Melange
Liebe, Gier, Hass – eine Melange Pathologische Skepsis
Pathologische Skepsis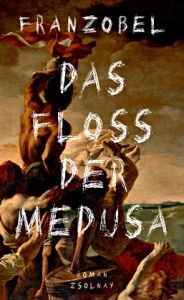 Mich fragt ja niemand
Mich fragt ja niemand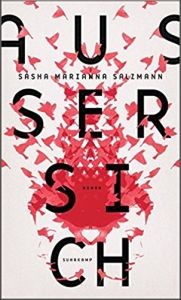 Пошёл ты!
Пошёл ты!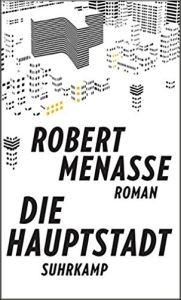 Brüssel oder Auschwitz
Brüssel oder Auschwitz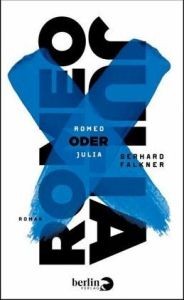 Orgasmusfrühstück
Orgasmusfrühstück