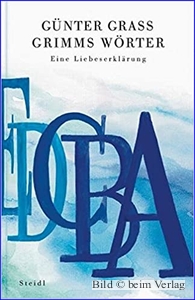 Ambivalentes Spätwerk
Ambivalentes Spätwerk
Es war nicht sein letztes Buch, wie er befürchtet hatte, es folgten noch zwei weitere, mit «Grimms Wörter» hat Günter Grass seinem belletristischen Œuvre noch eine ambivalente «Liebeserklärung» hinzugefügt. Der überbordenden Liebe zum geschriebenen Wort, die hier wortmächtig und sprachverliebt zum Ausdruck kommt, steht erneut eine seiner peinlichen Selbstdarstellungen gegenüber. Eine unverhüllte Eitelkeit, die dem Literatur-Nobelpreisträger und künstlerischem Multitalent wahrlich nicht zur Ehre gereicht. Lange galt er als führender Intellektueller Deutschlands, seine Stimme hatte Gewicht, er hat sich politisch eingemischt wie kein zweiter und oft den Nagel auf den Kopf getroffen. Dieser Roman über die Gebrüder Grimm wäre ohne die selbstverliebten autobiografischen Einschübe ein amüsanter und lehrreicher linguistischer Parforceritt für sprachlich Interessierte. Wäre!
Die Geschichte um das Jahrhundertwerk der begnadeten Philologen Jakob und Wilhelm Grimm beginnt mit dem Rauswurf der «Göttinger Sieben» aus der berühmten niedersächsischen Universität, Jakob wurde sogar des Landes verwiesen. Nachdem Berufungen an andere deutsche Universitäten ausgeblieben waren, bietet sich mit dem Auftrag für ein Deutsches Wörterbuch ein Jahr später endlich für beide die Chance, ihrer inzwischen entstandenen finanziellen Misere zu entrinnen. Von Buchstabe zu Buchstabe und Wort zu Wort hangelt sich Günter Grass durch die deutsche Sprache, deren Ursprüngen und linguistischen Varietäten die gelehrten Brüder mit höchstem wissenschaftlichem Anspruch nachspürten. Eine Mammutaufgabe, wie sich schon bald erweist, es vergehen sechzehn Jahre, bis 1854 der erste Band erscheinen kann. Aus der Feder der beiden Grimms stammen dann noch die Bände bis zum Buchstaben F, den Jakob erarbeitet hat, bevor der Tod auch seinem Fleiß ein Ende setzte. Der große Rest wurde von vielen anderen Wissenschaftlern erstellt, der 32te und letzte Band erschien dann erst 1961. Die Taschenbuch-Ausgabe des dtv von 1999 enthält 320.000 Stichwörter auf 34.824 Seiten.
Mit erkennbarer Lust breitet Günter Grass linguistische Varianten ausgesuchter Wörter und diverse, von den Grimms als Belege angeführte Zitate aus der Literatur vor dem Leser aus. Er ergänzt sie um heutige, neu hinzu gekommene Worte und weist auf die Dynamik hin, der Sprache permanent unterworfen ist. Seine erkennbare Freude an barocken, altertümelnden Sprachformen findet sich auch in anderen Werken von ihm, «Das Treffen in Teltge» nennt er selbst als Beispiel. Aber er weist auch völlig unnötig auf viele andere seiner Werke hin, obwohl er solch plumpe Eigenwerbung als weitaus erfolgreichster deutscher Schriftsteller gar nicht mehr nötig hatte. Noch peinlicher aber sind die vielen einfließenden Reden, Begegnungen, politischen Aktivitäten und verbalen Scharmützel mit der Springer-Presse, durch die er sich in diesem Buch selbst inszeniert. So sehr man seinen Ansichten zu politischen und sozialen Problemen auch heute noch nur zustimmen kann, so sehr sind sie in diesem Roman fehl am Platze, es fehlt nämlich jedweder Zusammenhang mit dem Grimm-Thema. Und anders als bei den Gebrüdern hat seine Aufmüpfigkeit auch nie gravierende Folgen für ihn gehabt, sie hat ihn im Gegenteil auflagesteigernd nur bekannter gemacht.
Größte Stärke des Buches ist sicherlich der virtuose Umgang mit Sprache, hinzu kommt der interessante Einblick in die Entstehungsgeschichte des kolossalen Grimmschen Werkes. Aber auch der historische Kontext mit den vielen prominenten Zeitgenossen jener Epoche, über die da munter fabuliert wird, ist bereichernd. Es gelingt Grass aber nicht, kurzweilig zu plaudern, wie das der von ihm zitierte und bewunderte Theodor Fontane so perfekt konnte, insoweit hat der Roman auch wenig Unterhaltungswert aufzuweisen. Das posthume Herbeizitieren der Grimms zu fiktiven Gesprächen im Berliner Tiergarten, zur gemeinsamen Bootsfahrt gar am Ende, wirkt zudem eher deplatziert als mystisch bereichernd.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
 Das Beste von Laxness
Das Beste von Laxness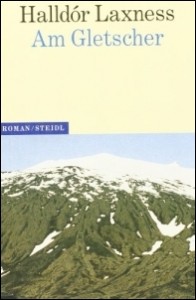 Deshalb lesen wir doch Romane
Deshalb lesen wir doch Romane