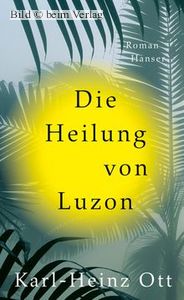 Unerfüllte Erwartungen
Unerfüllte Erwartungen
Der neue Roman von Karl-Heinz Ott mit dem deskriptiven Titel «Die Heilung auf Luzon» ist ein psychologisch raffiniertes Spiel mit den Ängsten und Problemen zweier Paare, von denen jeweils einer der Partner unheilbar erkrankt ist. Nachdem die Schulmedizin ihnen keine Aussicht mehr auf Heilung attestieren kann, setzen sie nun ihre letzte Hoffnung auf den Wunderheiler Bon Sato, einer der bekanntesten fernöstlichen Schamanen, der in Baguio lebt, einem der prominenten Orte in den Kordilleren auf Luzon, wo auch die Staatspräsidentin ein repräsentatives Anwesen besitzt.
Nach einem sechzehnstündigen Flug mit Zwischenstopp in Hongkong kommt ein Berliner Ehepaar erschöpft in Manila an, wo sie ein Taxifahrer erwartet, der sie zum Hotel fährt, um sie am nächsten Tag dann zu ihrem Resort auf Luzon zu bringen. Der egozentrische, 55jährige Bock, einst ein bekannter Theaterregisseur von der Sorte ‹Kotzbrocken›, ist an Krebs erkrankt, ein Berserker ohne Kraft nur noch, er setzt nun seine letzte Hoffnung auf Bon Sato. Begleitet wird er von Gela, seiner zehn Jahre jüngeren Frau, die schon lange mit ihm verheiratet ist, viel in ihrem Leben für ihn geopfert hat, nun aber zunehmend unter seinen Launen und Wutanfällen leidet und sehr bedauert, dass sie ihn nicht schon längst verlassen hat, – jetzt scheint es ihr zu spät dafür. Bei einem zweiten Berliner Paar Ende vierzig ist es die experimentierfreudige, lebenslustige Rikka, die unheilbar am Krebs erkrankt ist und auf ein Wunder hofft. Tom, ihr Mann, arbeitet ohne inneren Antrieb als Lehrer für Deutsch und Ethik. Er befindet sich in einer veritablen Midlife-Crisis, in einem andauernden, inneren Aufruhr, der ihn niederdrückt und verzweifeln lässt. Denn im Grunde will er nur einfach der wieder sei, der er mal war, er hadert also mit den verpassten Chancen in seinem immer banaler und eintöniger gewordenen Leben, wobei er einseitig seiner eher labilen Frau die Schuld dafür gibt. Rikka hatte nach ihrem ziemlich wilden Leben in dem ruhigen, soliden Tom einen Ruhepol gefunden, bis dann eine Fehlgeburt der Grund war für alles Unglück und die schwelenden Probleme ihrer Beziehung.
Zeitlich ist diese Geschichte in der Osterzeit des Jahres 2004 angesiedelt, was sich in den Schilderungen der armseligen Hütten, Bauruinen und primitiven Elektrokabel widerspiegelt, wo es damals von Bettlern wimmelte und man, als Europäer total entsetzt, plötzlich in Manila auf der Straße sogar Leprakranken begegnen konnte. Andererseits ist man damals aber auch noch nicht von Touristen-Schwärmen umzingelt, der Strand ist paradiesisch leer. Tom sagt, er fühle sich hier wie in der Südsee, – letztendlich aber sind sie ja nicht auf Urlaub hier! Vierzehn Tage lang werden sie jetzt nämlich jeden Tag zu dem Wunderheiler kutschiert, der in einer voodooartigen, viertelstündigen Zeremonie vor Publikum angeblich das Schlechte aus den Kranken herausholt, wofür Bon Sato vorab eintausend Dollar in bar kassiert hat. In den 18 Kapiteln des Romans wird aus wechselnder Perspektive der vier Protagonisten von deren Vergangenheit erzählt, von den Verwerfungen und verpassten Chancen in ihrem Leben. Nach und nach setzt schließlich bei den beiden Kranken eine Schicksals-Ergebenheit ein, für ihre beiden Partner aber deutet sich vage eine Hoffnung auf ein spätes Glück ein.
Krankheit und Tod sind die vermeintlich großen Themen dieses Romans, seine eigentliche Thematik besteht aber im Zwischen-Menschlichen unter den extremen Bedingungen des unabweisbar nahen Todes. Es ist ja nicht so, dass der nicht betroffene Partner zum Heiligen wird in solcher Situation. Gela bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt, sie erschrecke die Vorstellung, «… noch weitere Jahre an der Seite eines Kranken zu verbringen, von dem sie sich schon lange trennen wollte». Das psychologische Experimentierfeld dieses Romans voller Klischees und Wiederholungen wirft immer wieder die gleichen Fragen auf und läuft schließlich auf das vom Leser vorab erwartete Ende hinaus. Es ist nicht die begrenzte Lebenszeit, die sich im Roman als Problem erweist, im Fokus stehen hier die unerfüllten Erwartungen seiner Protagonisten.
Fazit: lesenswert
Meine Website: https://ortaia-forum.de
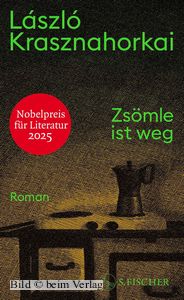 Zwischen Wahnsinn und Realität
Zwischen Wahnsinn und Realität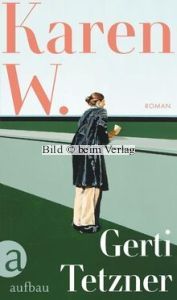 Authentisches Zeitzeugnis
Authentisches Zeitzeugnis Dschungelartiges Erzählspiel
Dschungelartiges Erzählspiel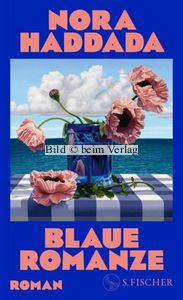 Polit-Seminar statt Liebes-Schnulze
Polit-Seminar statt Liebes-Schnulze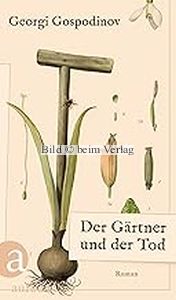 Bulgarische Scheherazade
Bulgarische Scheherazade Eine Stimme für das Unsagbare
Eine Stimme für das Unsagbare Listige Subjekt/Objekt-Umkehr
Listige Subjekt/Objekt-Umkehr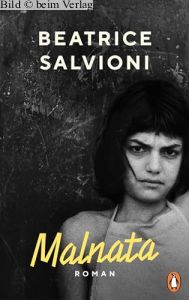 Deutschlandfunk trifft’s
Deutschlandfunk trifft’s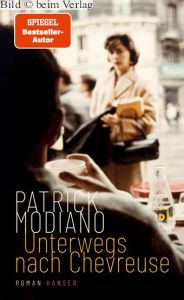 Anschreiben gegen das Vergessen
Anschreiben gegen das Vergessen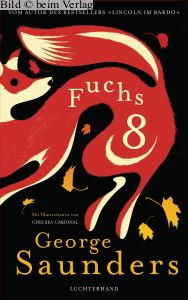 Linguistisch überschäumende Kreativität
Linguistisch überschäumende Kreativität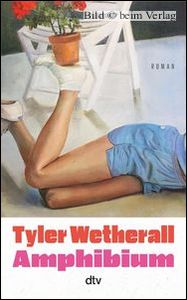 Adoleszenz eines toughen Mädchens
Adoleszenz eines toughen Mädchens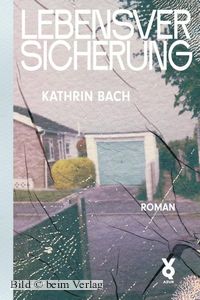 Stilistischer Fehlgriff par excellence
Stilistischer Fehlgriff par excellence Und Wera zeigt Zähne
Und Wera zeigt Zähne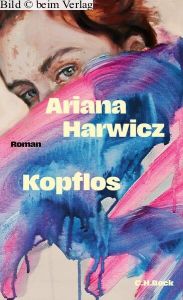 Radikale stilistische Unmittelbarkeit
Radikale stilistische Unmittelbarkeit