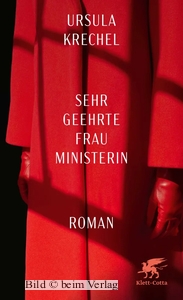 Narrativ unausgewogen
Narrativ unausgewogen
Nach sieben Jahren hat Ursula Krechel mit «Sehr geehrte Frau Ministerin» gerade ihren vierten Roman veröffentlicht, der auch wieder eine dezidiert feministische Thematik aufgreift. Es geht um drei Frauen der Jetztzeit, die mit ihren spezifisch weiblichen Problemen im Roman gespiegelt werden am Schicksal von Agrippina minor, der Mutter des römischen Kaisers Nero. Die in den Feuilletons ziemlich einhellig als eine der sprachmächtigsten deutschen Schriftstellerinnen gefeierte Autorin hat für ihr neues Buch ein hoch kompliziertes narratives Konstrukt gewählt, das in Anbetracht der Komplexität ihrer extrem verschachtelten Geschichte höchste Aufmerksamkeit beim Lesen erfordert.
Der dreiteilige Roman beginnt im ersten, mit «Eva» betitelten Teil mit der Geschichte der Verkäuferin Eva, die in der Essener Filiale einer auf Kräuter spezialisierten Ladenkette arbeitet. Trotz ihrer geradezu symbiotischen Beziehung hat sie als allein erziehende Mutter Probleme mit ihrem Sohn. Philipp hat sein Studium abgebrochen, verbringt antriebslos die meiste Zeit vor seinem Computer, hat nie Zeit für seine Mutter. In permanentem Wechsel zu diesem Erzählstrang springt der Plot in die Antike und erzählt häppchenweise die Geschichte von Nero in der Überlieferung von Tacitus. «Ab ovo», so der Titel des zweiten Teils, ‹von Beginn an› also, wird die Geschichte der Lateinlehrerin Silke erzählt, die als Kundin mit auffällig roter Mütze gelegentlich in Evas Kräuterladen auftaucht. Sie interessiert sich sehr für die «Annalen» von Tacitus und baut sie in ihren Unterricht mit ein, was ihr Schwierigkeiten mit den Eltern einbringt, die den Stoff für unangemessen halten als Schullektüre. Silke kann nach einer Operation keine Kinder mehr bekommen und interessiert sich ziemlich auffallend für Eva und ihren Sohn. Sie spioniere ihnen nach und wolle ein Buch über sie schreiben, mutmaßt Eva. Ein verstecktes Alter Ego der Autorin mithin, die den Schreibprozess und ihre Absichten häufig offen darlegt, den Leser in Wortfindungen und Überlegungen zur Thematik gezielt mit einbindet. Im dritten Teil dieses metafiktionalen Romans, listig mit «als ob» betitelt, steht die Ministerin im Blickpunkt. Schon der Buchtitel weist auf die vielen Briefe hin, die an sie gerichtet sind und Alltagsprobleme aufzeigen, für die es keine politischen Patentrezepte gibt. Auch hier wird die Erzählung, wie schon in den anderen Teilen, häufig durch Zitate von Tacitus unterbrochen. Die Karriere dieser dritten Protagonistin wird ebenso geschildert wie ihr arbeitsreicher Alltag, unter dem ihre Familie häufig zu leiden hat.
Als Kulturgeschichte der Frauen beschäftigt sich dieser Roman mit problematischen Beziehungen zwischen Müttern und Söhnen heutzutage ebenso wie in der Antike. Die realistisch dargestellten Schicksale der drei Protagonistinnen stehen exemplarisch für die Defizite in der heutigen Gesellschaft, denen Frauen trotz aller Fortschritte bei der Emanzipation nach wie vor ausgesetzt sind. Vielleicht als Trost gedacht, werden diese Probleme vor dem antiken Hintergrund aus der Kaiserzeit vor zweitausend Jahren geschildert, wo Mord und Totschlag unter den Regenten und ihren Neidern alltäglich waren, business as usefull! Aber auch eine so hochgestellte Person wie eine veritable Bundesministerin der Justiz ist heutzutage ihres Lebens nicht sicher, lehrt uns der Roman.
Geradezu gewalttätig wirkt aber auch dieser Roman selbst, wenn nämlich mitten im Satz plötzlich aus einer anderen Perspektive weitererzählt wird, und schwer zugänglich wird er neben den verwirrenden Perspektiv-Wechseln zudem durch die vielen wilden Zeitsprünge. Ein weiteres Manko sind die allzu ausufernden Schilderungen der geschlechts-spezifischen Rolle von Frauen, die sich gegen tradierte Ungerechtigkeiten wehren. Stilistisch topp, aber erzählerisch hochgradig konfus und als Lektüre quälend langweilig, ein narrativ unausgewogener Roman wie selten!
Fazit: mäßig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
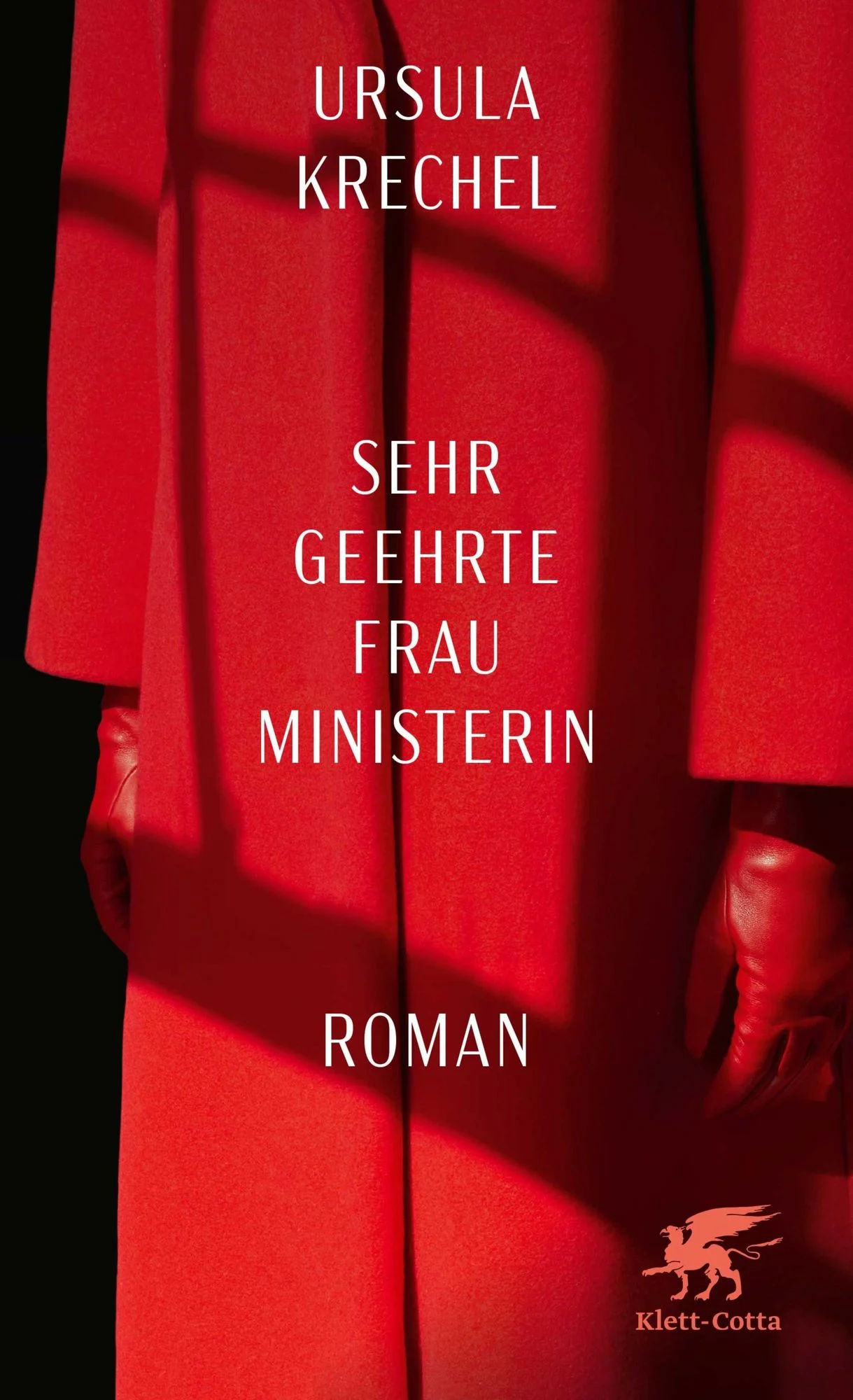
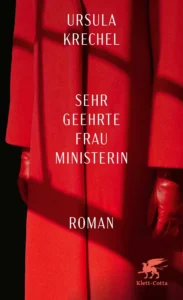 Dass ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, schien anfangs unwahrscheinlich. Erst ging es, in einem Kapitel mit dem Titel: „Eva,“ detailliert um den römischen Kaiser Nero und wie er seine Mutter Agrippina verbannen und umbringen ließ. Dabei erfuhr ich, dass Seneca sein Tutor war, den er aber auch verbannte. Aber, wollte ich das lesen?
Dass ich das Buch bis zu Ende gelesen habe, schien anfangs unwahrscheinlich. Erst ging es, in einem Kapitel mit dem Titel: „Eva,“ detailliert um den römischen Kaiser Nero und wie er seine Mutter Agrippina verbannen und umbringen ließ. Dabei erfuhr ich, dass Seneca sein Tutor war, den er aber auch verbannte. Aber, wollte ich das lesen?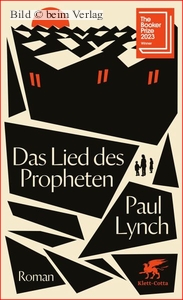 Ein politischer Weckruf ohnegleichen
Ein politischer Weckruf ohnegleichen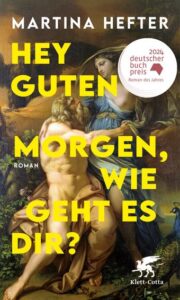 Juno, die Erzählerin, ist Anfang Fünfzig. Sie lebt mit Jupiter, ihrem seit Jahren bettlägerigen Mann in einer kleinen Wohnung in Leipzig. Er ist Schriftsteller, sie freiberufliche Performancekünstlerin, die, nicht nur zu Coronazeiten, gerne häufiger Engagements hätte.
Juno, die Erzählerin, ist Anfang Fünfzig. Sie lebt mit Jupiter, ihrem seit Jahren bettlägerigen Mann in einer kleinen Wohnung in Leipzig. Er ist Schriftsteller, sie freiberufliche Performancekünstlerin, die, nicht nur zu Coronazeiten, gerne häufiger Engagements hätte.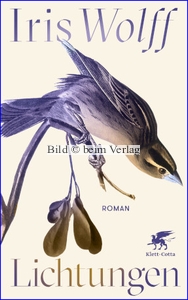 Eine gute Idee?
Eine gute Idee?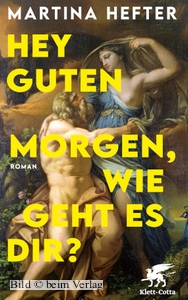 Love-Scammer vs. Performerin
Love-Scammer vs. Performerin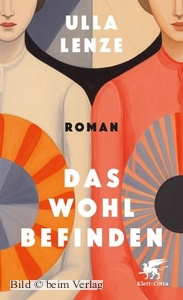
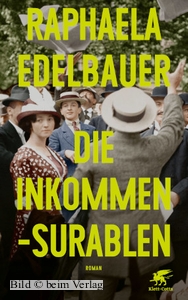 Intellektueller Höhenflug
Intellektueller Höhenflug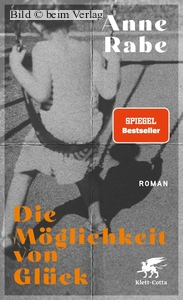 Die Mär von den Ossis
Die Mär von den Ossis Das Buch Das Recht auf Sex: Feminismus im 21. Jahrhundert besteht aus sechs Essays, die unabhängig und zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben wurden. Die Autorin wurde in den USA und den UK zur Philosophin ausgebildet und lehrt soziale und politische Theorie am Chichele Institut für Völkerrecht in Oxford, als erste nicht-weiße Professorin.
Das Buch Das Recht auf Sex: Feminismus im 21. Jahrhundert besteht aus sechs Essays, die unabhängig und zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben wurden. Die Autorin wurde in den USA und den UK zur Philosophin ausgebildet und lehrt soziale und politische Theorie am Chichele Institut für Völkerrecht in Oxford, als erste nicht-weiße Professorin.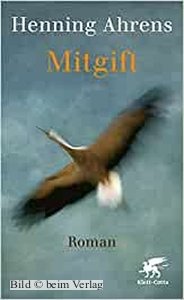 Nichts zu lachen
Nichts zu lachen Die zehn besten Bücher der letzten zwanzig Jahre
Die zehn besten Bücher der letzten zwanzig Jahre Surreale Parabel
Surreale Parabel

