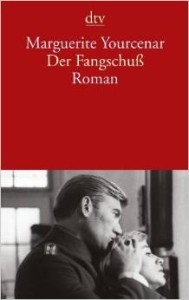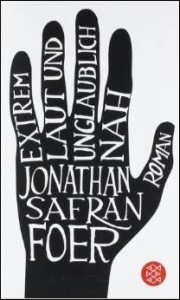 Keine brav herunter geschriebene Prosa
Keine brav herunter geschriebene Prosa
Dies ist zweifellos der gelungene Roman eines kreativen jungen Autors, über den an vielen Stellen schon viel Kluges geschrieben steht. So viel, dass einem begeisterten Leser wie mir eigentlich nur übrig bliebe, ein paar bissige Kommentare zu den auffallend wenigen negativen Rezensionen zu schreiben, das Meiste ist schon gesagt. Es wird dabei aber häufig der Fehler gemacht, einen solchen Roman nach Gesetzen der Logik zu analysieren, wo es hier doch eindeutig um Irrationales geht, das wird einem ja schon nach wenigen Sätzen klar. Ein neunjähriger Protagonist ist zwar nicht völlig neu, und wenn der dann, wie die Figur bei Grass, auch noch Oskar heißt, ist doch eindeutig eine ganz andere, eine besondere Perspektive gegeben, da muss halt auch der Rezensent mal über seinen Schatten springen.
Denn genau diese Sicht eines neunmalklugen Jungen macht das Buch zu einer äußerst vergnüglichen Lektüre, ich hab mich lange nicht mehr so gut amüsiert, so oft laut aufgelacht. Der Autor brennt ein Feuerwerk an skurrilen Einfällen ab, und äußerst witzige Wortspiele, aber auch die ganz subtilen Beziehungen zwischen den teils urkomischen Gestalten lassen einen immer wieder schmunzeln. Besonders berührend fand ich die Odyssee zu den verschiedenen ‚Blacks’, wie schön könnte das Leben sein, geht es einem da durch den Kopf, wenn wir uns alle so ungezwungen geben, so freundlich aufeinander zugehen würden wie diese vielen Namensträger, die Oskar da unverdrossen aufgesucht hat.
Und all das spielt vor todernstem Hintergrund, 9/11 insbesondere, aber auch Dresden und Hiroshima, ohne dass es jemals unangemessen wirkt. Es muss erlaubt sein, die Welt eben auch mal aus einer herzerfrischend anderen Perspektive zu sehen, selbst wenn es so makaber wird wie im Daumenkino am Schluss des Buches, bei dem einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Diesen extremen, ungewöhnlichen Spagat zwischen Tragödie und Komödie hat Jonathan Safran Foer in einer fulminanten Sprache und mit ausgefallenen typografischen Verzierungen versehen grandios bewältigt. Endlich mal keine brav herunter geschriebene Prosa, die allen Konventionen folgt, sondern ein unbekümmert anderer Stil, der die Literatur bereichert und damit ganz besonders auch denjenigen, der sich darauf einzulassen vermag als Leser. Er wird fürstlich belohnt!
Fazit: erstklassig
Meine Website: http://ortaia.de
 Ein sprachliches Fest
Ein sprachliches Fest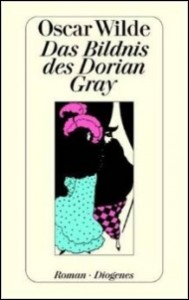 Von Bonmot zu Bonmot
Von Bonmot zu Bonmot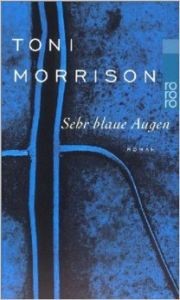 Gelungenes Debüt einer großen Autorin
Gelungenes Debüt einer großen Autorin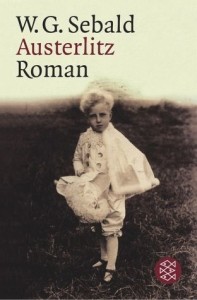 Spurensuche
Spurensuche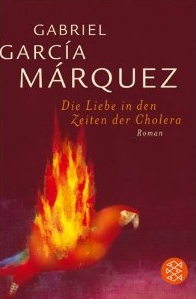 Die schönste Liebesgeschichte der Welt
Die schönste Liebesgeschichte der Welt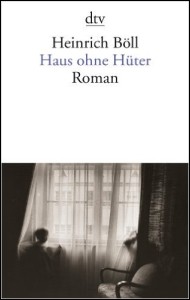 Zeit der Onkelehen
Zeit der Onkelehen Ilsebill salzte nach
Ilsebill salzte nach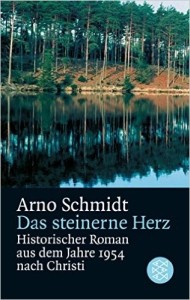 Manifeste Leseerwartungen hintanstellen
Manifeste Leseerwartungen hintanstellen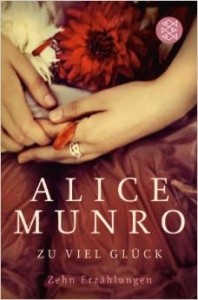 Literarische Miniaturen
Literarische Miniaturen Baltischer Fontane
Baltischer Fontane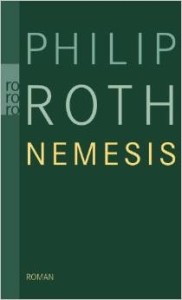 Aus dem Klischee-Baukasten
Aus dem Klischee-Baukasten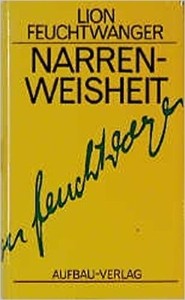 Vitam impendere vero
Vitam impendere vero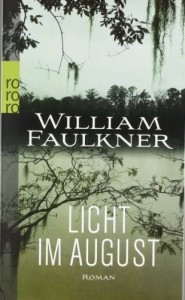 Erzählkunst auf allerhöchstem Niveau
Erzählkunst auf allerhöchstem Niveau