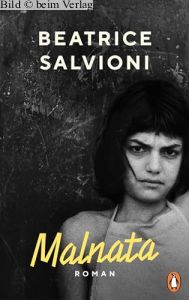 Deutschlandfunk trifft’s
Deutschlandfunk trifft’s
«Malnata», der erste Roman der jungen Schriftstellerin Beatrice Salvioni, erinnert thematisch stark an Elena Ferrantes Bestseller «Meine geniale Freundin». Prompt ist auch hier wieder ein Hype um dieses von den italienischen Feuilletons hoch gelobte und in 35 Sprachen übersetzte Buch entbrannt. Und auch hierzulande waren die Leserkommentare euphorisch, ganz im Gegenteil dazu haben jedoch die deutschen Print-Medien diesen Roman komplett ignoriert, die einzige Buchbesprechung im Perlentaucher stammt jedenfalls vom Deutschlandfunk Kultur und ist ein regelrechter Verriss. Das Buch sei schlicht und ergreifend ein Trivialroman, erklärt der Buchkritiker Christoph Schröder dort in seinem Radiobeitrag! Kann das wahr sein, fragt man sich als irritierter Leser.
Historischer Hintergrund dieser Erzählung ist der Faschismus in Italien und der von Mussolini angezettelte Abessinenkrieg. Die titelgebende «geniale» Freundin in Ferrantes Roman ist bei Salvioni eine «unheilbringende», und so wird Maddalena von allen im Ort auch nur«Malnata» genannt. Manche bezeichnen das selbstbewusste, unangepasste Mädchen, das uns da vom Buchcover her so wütend anblickt, sogar als Hexe, weil in ihrer Anwesenheit schon schreckliche Unfälle passiert sind. Francesca hingegen, die zwölfjährige Ich-Erzählerin und Protagonistin des vorliegenden Romans, stammt aus so genanntem ‹gutem Hause› und wird von ihrer naiv religiösen Mutter streng erzogen. Unterschiedlicher könnten die beiden Mädchen gar nicht sein, aber trotz aller Warnungen werden sie beste Freundinnen. Der vierteilige, im Jahr 1935 in der Lombardei angesiedelte Roman beginnt gleich im Prolog mit einem erzählerischen Paukenschlag: Ein zu den strammen Faschisten gehörender junger Mann versucht, am Ufer des Lambro die brave Francesca zu vergewaltigen. Deren Freundin, die böse «Malnata», kommt ihr zur Hilfe und erschlägt schließlich den Übeltäter im Kampf, – bringt also, ihrem Ruf entsprechend, Unheil.
Maddalena ist ein Freigeist par excellence, unangepasst, kampfeslustig, immer schmutzig, immer zum Widerspruch bereit, sie lässt sich von niemandem etwas sagen. Frech wie sie ist stielt sie zum Beispiel mit Hilfe zweier Jungen, die sie wie Schatten überall begleiten und ihr aufs Wort gehorchen, beim Obsthändler einen ganzen Korb Kirschen. In der Schule sitzen die brave Francesca und die aufmüpfige Maddalena nebeneinander in der ersten Reihe. Auf Wunsch ihres älteren Bruders nämlich soll die «Malnata» unbedingt die Schule absolvieren, wozu sie eigentlich gar keine Lust hat. Aber sie fügt sich ausnahmsweise mal und strengt sich sogar an. Francesca, die gute schulische Leistungen zeigt, hilft ihr nach Kräften dabei. Es kommt zum Eklat, als bei der allmorgendlich zur Begrüßung im Stehen heraus geschmetterten Hymne zu Ehren des Duce Maddalena einfach sitzen bleibt und schweigt. Francesca sagt die Hymne zwar brav auf, fügt aber hinterher noch eine recht kritische Bemerkung zum Faschismus hinzu. Maddalena muss die Schule sofort verlassen, Francesca aber kommt noch mal mit einem blauen Auge davon.
Vor dem Hintergrund der politischen Verhältnisse wird in dieser Coming-of-Age-Geschichte über die Rollen-Erwartungen berichtet, mit denen sich junge Mädchen damals zunehmend konfrontiert sahen. Ihr Kampf um ein selbst bestimmtes Leben beinhaltet auch ihre Auflehnung gegen die gesellschaftliche Scheinheiligkeit in sozialer und religiöser Hinsicht. Diese Loyalitäts-Konflikte kulminieren in einem nebelhaften Ende, das zumindest andeutet, dass die beiden Mädchen im Kern ja Recht habenund der Vergewaltiger seinen Tod selbst herauf beschworen hat. Als Melodram allerdings kann der Roman nicht überzeugen, allzu viele Klischees werden da bemüht, die grotesken Figuren wirken seltsam ambivalent, und das Setting des Romans in Mussolinis Italien ist definitiv zu weit hergeholt als passende historische Kulisse. Der Deutschlandfunk hat letztendlich also doch Recht mit seiner literarischen Zuordnung!
Fazit: miserabel
Meine Website: https://ortaia-forum.de
 Salman Rushdie hat viele Jahrzehnte in den Ländern gelebt, in denen seine Geschichten spielen: In Indien, im Vereinten Königreich und in den USA. Inzwischen ist er bald achtzig Jahre alt, aber er weiß noch, wie es sich anfühlte, dort zu leben, was die Menschen sehen, denken, fühlen. In seine Erzählkunst schöpft er aus der Fülle genauer Beobachtungen, auch von Details.
Salman Rushdie hat viele Jahrzehnte in den Ländern gelebt, in denen seine Geschichten spielen: In Indien, im Vereinten Königreich und in den USA. Inzwischen ist er bald achtzig Jahre alt, aber er weiß noch, wie es sich anfühlte, dort zu leben, was die Menschen sehen, denken, fühlen. In seine Erzählkunst schöpft er aus der Fülle genauer Beobachtungen, auch von Details. 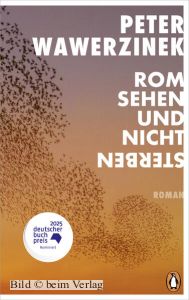 Irritierend eigenständig
Irritierend eigenständig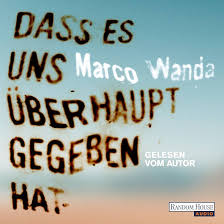
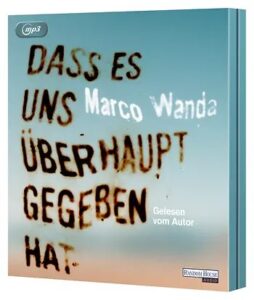 “Wir werden von dem geleitet was wir nicht wissen wollen, etwas das uns kränkt und verletzt, davon laufen wir davon in die Wüste unserer Unwissenheit.” Als Wanda begannen sich zu formieren, sagen wir mal ca. 2010, war in Wien eigentlich nichts mehr los. Was die Bandmitglieder schnell verband, war das “Das Gefühl dieser entleerten Wiener Langeweile etwas entgegenhalten zu müssen. Irgendetwas musste passieren“. Kokett fügt er hinzu, dass es schließlich sie – Wanda – waren, die endlich “passierten“. Aber seine Selbsteinschätzung kommt nicht angeberisch, eher verwegen daher, denn Marco Wanda versteht es, immer wieder, zu betonen, wie viele andere Menschen, also Freunde und Freundinnen, am Erfolg von Wanda mitgebastelt haben. Trotz allen Stolzes ist ihm natürlich bewusst, wem er das alles zu verdanken hat und so wirkt auch seine Selbstüberschätzung durchwegs sympathisch da sie mit der Wien-typischen Selbstironie daherkommt. In Wien nennt man sowas nämlich Humor und vielleicht ist es genau das, was den meisten anderen Bewohner:innen der (Bundes-)Länder so abgeht. Selbst in der düstersten Stunde, als er von Schicksalsschlägen getroffen auf der Bühne immer noch weitermachen muss und er sich sein Rückgrat ruiniert, lacht er noch: “Endlich machte ich Bekanntschaft mit etwas, was sich gut anfühlte: legale Drogen“. Der Mick Jagger und alle bekommen es, meint sein Arzt, ein Allheilmittel für alle Künstler und Künstlerinnen, die es mal wieder übertrieben haben. Die Rede ist von Fentanyl, den höheren Weihen des Rockolymps legal zugänglich. Dieser Humor, dieses Schmunzeln, dieses “Singen auf der Folter” macht “Dass es uns überhaupt gegeben hat” zu einem hörenswerten Buch gerade weil es vom Autor selbst gelesen wird, der gerne auch die Stimmen anderer Prominenter imitiert. Auch dadurch wird sein literarisches Debüt zu einem echten literarischen Leckerbissen.
“Wir werden von dem geleitet was wir nicht wissen wollen, etwas das uns kränkt und verletzt, davon laufen wir davon in die Wüste unserer Unwissenheit.” Als Wanda begannen sich zu formieren, sagen wir mal ca. 2010, war in Wien eigentlich nichts mehr los. Was die Bandmitglieder schnell verband, war das “Das Gefühl dieser entleerten Wiener Langeweile etwas entgegenhalten zu müssen. Irgendetwas musste passieren“. Kokett fügt er hinzu, dass es schließlich sie – Wanda – waren, die endlich “passierten“. Aber seine Selbsteinschätzung kommt nicht angeberisch, eher verwegen daher, denn Marco Wanda versteht es, immer wieder, zu betonen, wie viele andere Menschen, also Freunde und Freundinnen, am Erfolg von Wanda mitgebastelt haben. Trotz allen Stolzes ist ihm natürlich bewusst, wem er das alles zu verdanken hat und so wirkt auch seine Selbstüberschätzung durchwegs sympathisch da sie mit der Wien-typischen Selbstironie daherkommt. In Wien nennt man sowas nämlich Humor und vielleicht ist es genau das, was den meisten anderen Bewohner:innen der (Bundes-)Länder so abgeht. Selbst in der düstersten Stunde, als er von Schicksalsschlägen getroffen auf der Bühne immer noch weitermachen muss und er sich sein Rückgrat ruiniert, lacht er noch: “Endlich machte ich Bekanntschaft mit etwas, was sich gut anfühlte: legale Drogen“. Der Mick Jagger und alle bekommen es, meint sein Arzt, ein Allheilmittel für alle Künstler und Künstlerinnen, die es mal wieder übertrieben haben. Die Rede ist von Fentanyl, den höheren Weihen des Rockolymps legal zugänglich. Dieser Humor, dieses Schmunzeln, dieses “Singen auf der Folter” macht “Dass es uns überhaupt gegeben hat” zu einem hörenswerten Buch gerade weil es vom Autor selbst gelesen wird, der gerne auch die Stimmen anderer Prominenter imitiert. Auch dadurch wird sein literarisches Debüt zu einem echten literarischen Leckerbissen.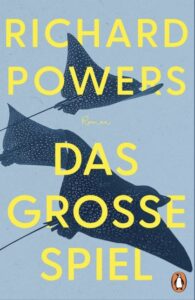

 Eigentum. “Bist bes auf mi, Mutti?” Neu erschienen als Taschenbuch ist auch der (vor-)letzte Roman des Sprachkünstlers Wolf Haas. Der Erfinder der “Brenner”-Krimireihe fischt dieses Mal in ganz anderen Gewässern. Genauer gesagt in fremden “Lechn“, hochdeutsch: Lehen. Denn immer strebt der Mensch nach Besitz, nach Eigentum und selbst wenn es dann nur 1,7 m2 werden, ist zumindest etwas zum Vererben da.
Eigentum. “Bist bes auf mi, Mutti?” Neu erschienen als Taschenbuch ist auch der (vor-)letzte Roman des Sprachkünstlers Wolf Haas. Der Erfinder der “Brenner”-Krimireihe fischt dieses Mal in ganz anderen Gewässern. Genauer gesagt in fremden “Lechn“, hochdeutsch: Lehen. Denn immer strebt der Mensch nach Besitz, nach Eigentum und selbst wenn es dann nur 1,7 m2 werden, ist zumindest etwas zum Vererben da.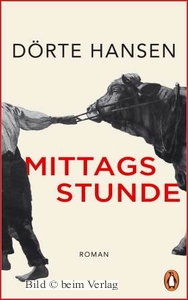 Flurbereinigung auf den Mädchenköpfen
Flurbereinigung auf den Mädchenköpfen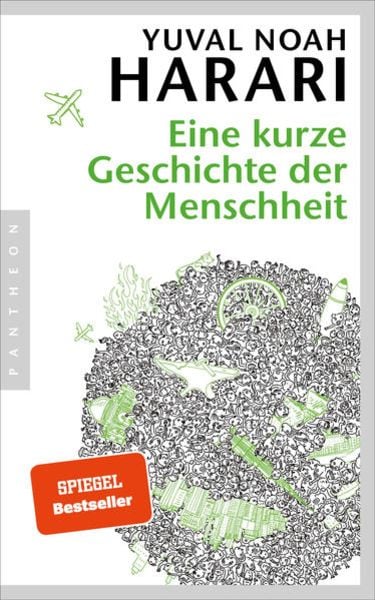
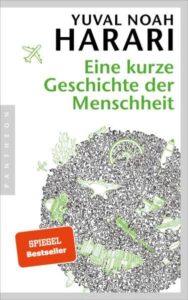 Anfangs dachte ich, das Vorgängerbuch Sapiens, das 25 millionenfach verkauft wurde, müsste ich vor diesem gelesen haben; der Autor bezieht sich gerne darauf. Dann aber überzeugte die Fülle der Beispiele dieses Buches. Diese „kurze Geschichte“ des Historikers hat mehr als sechs hundert Seiten, einhundert davon sind Quellenangaben.
Anfangs dachte ich, das Vorgängerbuch Sapiens, das 25 millionenfach verkauft wurde, müsste ich vor diesem gelesen haben; der Autor bezieht sich gerne darauf. Dann aber überzeugte die Fülle der Beispiele dieses Buches. Diese „kurze Geschichte“ des Historikers hat mehr als sechs hundert Seiten, einhundert davon sind Quellenangaben.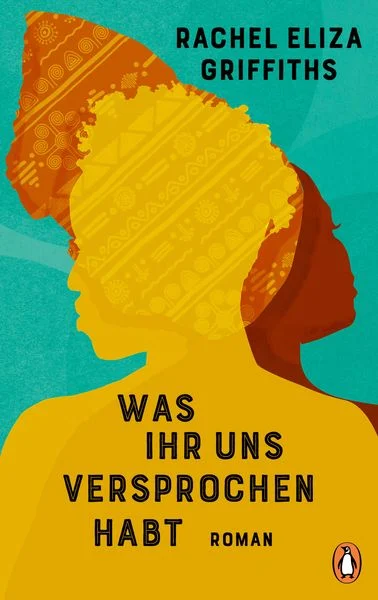
 Der Roman beschreibt die Geschichte einer Schwarzen Familie in einer kleinen neu-englischen Stadt am Meer, Salt Point, in den fünfziger Jahren. Cinthy, zu Beginn 13 Jahre alt, erzählt in Ich-Form.
Der Roman beschreibt die Geschichte einer Schwarzen Familie in einer kleinen neu-englischen Stadt am Meer, Salt Point, in den fünfziger Jahren. Cinthy, zu Beginn 13 Jahre alt, erzählt in Ich-Form.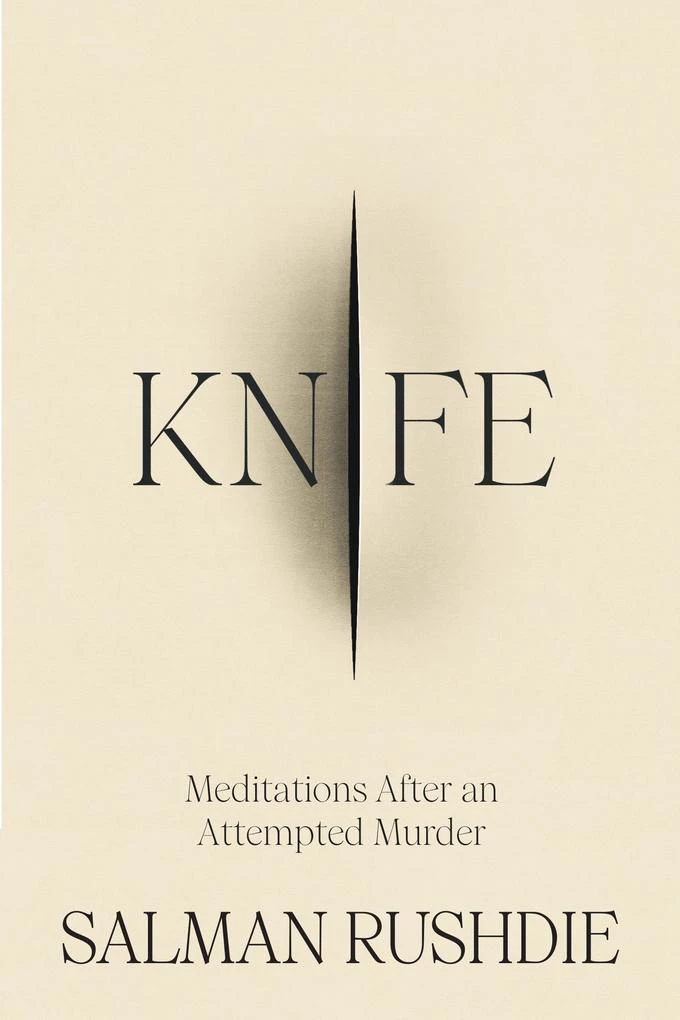
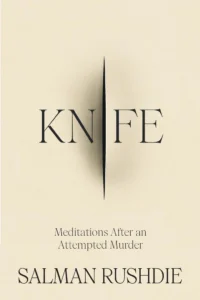 Salman Rushdie sollte im Rahmen eines Projektes für in ihren Ländern verfolgte Autoren eine Rede halten, darüber „wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen.“ Er sieht den Mann aus dem Publikum im Staat New York aufstehen und auf ihn losrennen—ein Sicherheitsdienst war nicht vorgesehen.
Salman Rushdie sollte im Rahmen eines Projektes für in ihren Ländern verfolgte Autoren eine Rede halten, darüber „wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen.“ Er sieht den Mann aus dem Publikum im Staat New York aufstehen und auf ihn losrennen—ein Sicherheitsdienst war nicht vorgesehen.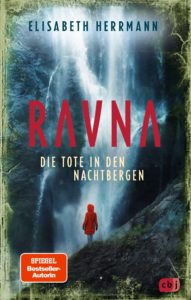
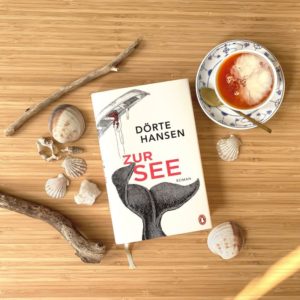 In ihren anderen Büchern ging es um das Landleben und, wie Menschen sich ändern müssen, um dort zu leben: Im Alten Land suchen Vertriebene eine neue Heimat und bleiben fremd, in der Mittagsstunde flieht ein Einheimischer in die Stadt, aber kommt immer wieder zurück und beobachtet, wer und was sich ändert. (link Landlust und Landfrust) In Zur See bleiben die Inselbewohner der Heimat treu und erleben, wie das Meer auch andere in seinen Bann zieht. Aber auch, was sich hier alles ändert. Da sind alte Geschichten zu erzählen, von Männern, die zur See gingen und von großen Fluten. Wir leben mit den Menschen auch in der Winterzeit, sehen wie die Gewerke der Fischer und Bauern sich ändern und lernen, wie der Zeitplan der Fähre das Leben bestimmen kann.
In ihren anderen Büchern ging es um das Landleben und, wie Menschen sich ändern müssen, um dort zu leben: Im Alten Land suchen Vertriebene eine neue Heimat und bleiben fremd, in der Mittagsstunde flieht ein Einheimischer in die Stadt, aber kommt immer wieder zurück und beobachtet, wer und was sich ändert. (link Landlust und Landfrust) In Zur See bleiben die Inselbewohner der Heimat treu und erleben, wie das Meer auch andere in seinen Bann zieht. Aber auch, was sich hier alles ändert. Da sind alte Geschichten zu erzählen, von Männern, die zur See gingen und von großen Fluten. Wir leben mit den Menschen auch in der Winterzeit, sehen wie die Gewerke der Fischer und Bauern sich ändern und lernen, wie der Zeitplan der Fähre das Leben bestimmen kann. Der kleine Yusuf himmelt den großen Kaufmann an, dem seine Eltern immer ein Festmahl kredenzen, wenn er, der Onkel Aziz, erscheint. Er schenkt ihm zum Abschied auch immer ein Geldstück. An anderen Tagen gibt es nicht immer etwas zu essen, seine Mutter meint, er solle doch den Staub essen, den der Holzbock hinterlässt. Richtig unangenehm wird sie ihm, als sie ihn herzt und küsst wie ein kleines Kind, er ist doch schon zwölf Jahre alt!
Der kleine Yusuf himmelt den großen Kaufmann an, dem seine Eltern immer ein Festmahl kredenzen, wenn er, der Onkel Aziz, erscheint. Er schenkt ihm zum Abschied auch immer ein Geldstück. An anderen Tagen gibt es nicht immer etwas zu essen, seine Mutter meint, er solle doch den Staub essen, den der Holzbock hinterlässt. Richtig unangenehm wird sie ihm, als sie ihn herzt und küsst wie ein kleines Kind, er ist doch schon zwölf Jahre alt!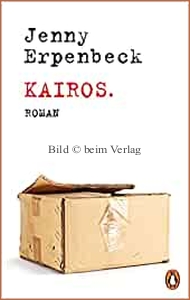 Entscheidende Momente in Liebe und Politik
Entscheidende Momente in Liebe und Politik Um es gleich vorweg zu sagen: Das Buch Über Leben: Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden von Dirk Steffens und Fritz Habekuß geht unter die Haut und man sieht die Welt danach mit anderen Augen an. Es zeigt uns, dass die Biodiversität Grundlage jedweden menschlichen Lebens ist und wie sehr sie heute schon gefährdet ist. Gelesen habe ich es während der ersten Welle der Coronazeit — in der Geborgenheit meines Gartens.
Um es gleich vorweg zu sagen: Das Buch Über Leben: Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden von Dirk Steffens und Fritz Habekuß geht unter die Haut und man sieht die Welt danach mit anderen Augen an. Es zeigt uns, dass die Biodiversität Grundlage jedweden menschlichen Lebens ist und wie sehr sie heute schon gefährdet ist. Gelesen habe ich es während der ersten Welle der Coronazeit — in der Geborgenheit meines Gartens.