 Kehlmanns Titelgeschichte »Unter der Sonne« schildert den Werdegang eines gescheiterten Autors. Ein Mann schreibt über einen berühmten Schriftsteller, er widmet ihm sein gesamtes wissenschaftliches Werk und all seine Arbeitszeit. Doch gelingt es ihm nicht, den Schriftsteller zu Lebzeiten auch nur ein einziges Mal zu treffen oder ihm eine persönliche Zeile zu entlocken. Weiterlesen
Kehlmanns Titelgeschichte »Unter der Sonne« schildert den Werdegang eines gescheiterten Autors. Ein Mann schreibt über einen berühmten Schriftsteller, er widmet ihm sein gesamtes wissenschaftliches Werk und all seine Arbeitszeit. Doch gelingt es ihm nicht, den Schriftsteller zu Lebzeiten auch nur ein einziges Mal zu treffen oder ihm eine persönliche Zeile zu entlocken. Weiterlesen
Archiv
Unter der Sonne: Erzählungen
Der Akazienkavalier: Von Menschen und Gärten
 Mit dem Geschenk Der Akazienkavalier: Von Menschen und Gärten von Ulla Lachauer konnte ich zuerst nicht viel anfangen— wo gibt es noch Kavaliere und dann mit Akazien? Aber ich las doch los, und gleich die kurze Geschichte vom Akazienkavalier, hatte sie doch dem Buch den Namen gegeben, obwohl sie im Buch die elfte (von fast zwanzig) war.
Mit dem Geschenk Der Akazienkavalier: Von Menschen und Gärten von Ulla Lachauer konnte ich zuerst nicht viel anfangen— wo gibt es noch Kavaliere und dann mit Akazien? Aber ich las doch los, und gleich die kurze Geschichte vom Akazienkavalier, hatte sie doch dem Buch den Namen gegeben, obwohl sie im Buch die elfte (von fast zwanzig) war.
Und wurde mitgenommen nach Odessa, in die Zeit kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion. Schnell kommen Erinnerungen an andere Orte in Mitteleuropa. Eine Zeit, in der sich Alles änderte, Alles möglich wurde, aber auch Verlustängste geschürt wurden. Wir lernen viel über die besondere Geschichte Odessas, warum dort Akazien, die eigentlich Robinien sind, die Alleen säumen. Wie wurde Odessa in der Literatur beschrieben, was macht den Odessiten aus?
Wir sind in einem Belle Epoque Hotel untergebracht, wo es nach Katzendreck riecht, was „gemäß odessitischer Erfahrung“ angenehmer sei, als eine Mäuseplage, so die Angestellten, die sich nach den guten alten Zeiten zurücksehnen.
Wir entfliehen dem Gestank im Hotel und machen einen Morgenspaziergang zur Brücke, auf der der Panzerkreuzer Potemkin gedreht wurde, fühlen uns befreit von allem Schweren, und das trotz des drückenden Dufts der blühenden Akazien. Die Begegnung mit dem Akazienkavalier passt in diese surreale Gegenwart und bringt uns, wie schon die Autorin, zum Lachen.
Im ersten Absatz heißt es schon: “Wenn es denn stimmt, dass kurz vor dem Tod das Leben, Bedeutsames, Skurriles, Schrecken und Glück, noch einmal im Zeitraffer vorbeizieht, dann könnte mein Kavalier aus Odessa dabei sein und mich zum Lachen bringen. Jedenfalls wünsche ich mir es, und dazu, wenn das nicht zu unbescheiden ist, Akazienduft!“
Diese Geschichte steht für viele andere, die von den europäischen Migrationsbewegungen des letzten Jahrhunderts erzählen, wobei es immer die zwischenmenschlichen Begegnungen sind, die den Reiz ausmachen. Und wir werden immer in die Gegenwart (der Nullerjahre, in denen das Buch erschien) zurückgeholt.
Auf Reisen bewundern wir Ostpreußische Wolkengärten, lernen über Bernsteinschmuggel und wie man echten von falschem Bernstein unterscheiden kann. Und es geht um Menschen, von denen manche schon nach den Weltkriegen, oder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu uns gekommen sind: Da ist ein „Gartenmann,“ Akademiker aus Kasachstan, der, bevor er sein Arztexamen nachholt, sein Geld in fremder Leute Gärten verdienen muss, oder der Aussiedler vom Balkan. Oder ein Engländer, der in Andalusien überwintert, aber eigentlich, weil er Jude ist, aus Litauen fliehen musste.
Manches passiert auch in Deutschland: Eine raumfressende Zimmerpflanze wird gemordet, aber erst nach langen Rechtfertigungen, warum Pflanzen eigentlich nach draußen gehören und Gedanken darüber, wie wir Menschen im Laufe der Zeit gelernt haben, mit Pflanzen zu leben. Wir lernen mit einer blinden Gärtnerin, wie Gärten erspürt werden können. Oder warum der Tante zur Gladiolenzeit immer welche gebracht werden müssen, auch wenn man als Kind noch so klein ist, dass die Ärmchen ganz hochgehalten werden müssen, wenn die Gladiolen nicht auf der Erde schleifen sollen.
Meine Lieblingsgeschichten spielen in Frankreich, wohl, weil ich ein Kind der Deutsch-Französischen Freundschaft bin. Auch hier geht es um Versöhnung nach Feindschaft und Kriegen. Außerdem weiß ich jetzt, dass Colette die erste und bisher einzige Frau ist, die ein Staatsbegräbnis erhalten hat.
Im Nachwort wird eine Erfahrung angesprochen, die auch meine ist und mir erst beim Lesen bewusst gemacht wurde: „Viele der Interviews für meine Bücher habe ich in Gärten geführt. Es ergab sich so, ohne besondere Absicht. Mir ist inzwischen klar geworden: Im Garten, unter freiem Himmel und doch geschützt vor der Außenwelt, ist leichter reden. Im Haus verlaufen Gespräche meist ganz anders.”
Ich mache gerne Empfehlungen, wem man ein Buch schenken könnte, etwa wenn Weihnachten naht: Allen Menschen, die vor 1955 geboren wurden, vor allem, wenn sie selbst Fluchterfahrungen haben. Am meisten Freude bereitet es denen, die selbst gerne mit anderen Menschen über Gärten reden.
Der Tokio-Montana-Express
 In seinem 1979 erschienenen »Tokio-Montana-Express« bietet Richard Brautigan ein buntes Potpourri: Tagebucheinträge über Personen, die er beobachtet hat. Kleine Geschehnisse, die ihm widerfuhren. Gedanken, die sich spontan vordrängten, aber keine Durchsetzungskraft besaßen. Gesamt: 131 heterogene Prosabissen formen eine phantasievolle Textcollage mit deutlichen biographischen Bezügen. Schon der Buchtitel deutet auf das häufige Hin und Her zwischen seiner Wohnung in Tokio und seiner Ranch nahe Livingstone, Montana. Weiterlesen
In seinem 1979 erschienenen »Tokio-Montana-Express« bietet Richard Brautigan ein buntes Potpourri: Tagebucheinträge über Personen, die er beobachtet hat. Kleine Geschehnisse, die ihm widerfuhren. Gedanken, die sich spontan vordrängten, aber keine Durchsetzungskraft besaßen. Gesamt: 131 heterogene Prosabissen formen eine phantasievolle Textcollage mit deutlichen biographischen Bezügen. Schon der Buchtitel deutet auf das häufige Hin und Her zwischen seiner Wohnung in Tokio und seiner Ranch nahe Livingstone, Montana. Weiterlesen
Kurze Interviews mit fiesen Männern
 Ironisches Psychogewäsch
Ironisches Psychogewäsch
Drei Jahre nach dem Opus magnum von David Foster Wallace erschien 1999 eine Sammlung von Geschichten unter dem ebenso deskriptiven wie amüsanten Titel «Kurze Interviews mit fiesen Männern». Der wichtigste und innovativste US-amerikanische Schriftsteller der Postmoderne glänzt hier wieder mit seinem geradezu verwegenen Sprachstil, der in einigen narrativen Aspekten an James Joyce erinnert und wohl auf seine Mutter Sally Foster zurückzuführen ist, deren Sprachbegeisterung ihn, wie er trotz sonstiger Vorbehalte gegen sie einräumte, entscheidend geprägt habe. Es geht im Wesentlichen um abnorme Beziehungen zwischen den Geschlechtern in diesem Band, wobei, wie der Titel schon ahnen lässt, den Männern allein hier die Rolle des Buhmannes zugewiesen ist, ein feministischer Ansatz also.
Geradezu als Lehrstück, als Quintessenz aus den 22 Geschichten, die noch folgen, beginnt das Buch mit «Ein stark verkürzter Abriss des postindustriellen Lebensstils», eine halbe Buchseite nur, in der jemand einen Mann und eine Frau einander vorstellt. Ein kommunikativer Akt mithin, der grandios fehlschlägt, – die Drei verstehen nichts, weil sie unehrlich sind, weil sie sich verstellen. Probleme mit der Verständigung aber durchziehen alle diese Geschichten von der Suche nach Identität. Da ist der 13jährige Junge, der an seinem Geburtstag erstmals auf den Sprungturm im Freibad klettert und nun schlotternd vor Angst nach unten starrt, oder die Ehefrau, die nach dreijähriger Ehe das abgekühlte sexuelle Verlangen mit allerlei Hilfsmitteln aus der Adult-World wieder gehörig aufheizen will. Um Sex geht es in vielen der Geschichten, sei es um machohafte Protzerei, um brutale Vergewaltigung, um ausgeklügelte Methoden der Anmache. Unter den insgesamt vier Geschichten des Buches mit dem Titel «Kurze Interviews mit fiesen Männern» ist am Ende eine, bei der ein junger Mann erzählt, mit welchen Tricks er ein schönes Mädchen auf einem Stadtfest zu einem One-Night-Stand verführt hat. Postkoital berichtet sie ihm dann von dem schlimmen Erlebnis, wie sie mal als Tramperin unbedacht bei einem Mulatten ins Auto gestiegen ist und voller Entsetzen zu spät erkannt hat, dass der Mann offensichtlich ein pathologischer Lustmörder ist. Und wie sie mit purer Willensanstrengung zwar nicht der Lust, aber doch dem Mörder entkommen ist. Ihre «Anekdote», wie er es naiv nennt, beeindruckt den jungen Mann derart, dass er am Schluss aus seiner lieblosen Rolle als Frauen vernaschender Macho herausfindet und glaubt, sie könne ihn retten. «Ich wusste, ich konnte lieben. Ende der Geschichte».
In einem intellektuellen Feuerwerk erzählt Wallace, human und wütend gleichermaßen, von der Reizüberflutung des modernen Menschen, von dem informellen Dauerfeuer, unter dem er steht und bei dem sich Quantität und Qualität diametral gegenüberstehen. Er setzt seinen fulminanten Wortschatz und seine ebenso geschliffene wie komplexe Syntax mit beißender Ironie ein, wobei er auch in dieser Sammlung psychologischer Skizzen wieder die für ihn typischen Fußnoten verwendet, was seine ironische Intention oftmals ins verächtlich Sarkastische verschärft. All die Selbstdarsteller, Neurotiker, Depressiven in diesen Geschichten sind keine sonderlich markanten Figuren, denen man vielleicht sogar Empathie entgegenbringen könnte als Leser. Sie treten vielmehr narrativ deutlich zurück hinter das Geschehen, welches Wallace wie ein brillanter Diagnostiker mit Akribie psychologisch seziert, damit pathologische Marotten entlarvend, wobei er allerdings nicht selten gehörig übertreibt.
Zugegeben, DFW ist nicht leicht zu lesen, ein wenig muss man sich schon anstrengen, will man ihm gedanklich folgen. Gleichzeitig aber bietet die Lektüre beste Unterhaltung, wobei sich unter den oft schreiend komischen Erzählskizzen, unter dem «Psychogewäsch», wie es im Buch selbstironisch heißt, die depressiven Krüppel unserer Konsum- und Mediengesellschaft verbergen, und davon gibt es mehr, als man glaubt.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
Reise ans Ende der Nacht
 Ordinär originell
Ordinär originell
Als Enfant terrible der französischen Literatur wurde Louis-Ferdinand Céline mit seinem 1932 erschienenen Skandalwerk «Reise ans Ende der Nacht» schlagartig bekannt, er gilt seither als sprachlicher Neuerer und wird zuweilen sogar als Jahrhundert-Autor auf eine Stufe gestellt mit Proust. Sein nicht weg zu diskutierender Judenhass und die Kollaboration mit den Nazis belasten ihn politisch schwer, ästhetisch aber gilt der revolutionäre Stilist als rehabilitiert, mit erkennbarer Wirkung auf berühmte Schriftstellerkollegen. Der spätere französische Staatspräsident Macron höchstselbst hatte sich vor seiner Wahl in einem Gespräch mit Houellebecq über Céline dahingehend geäußert, von ihm «könne man lernen, die ‹Sorgen des Mannes auf der Straße› ernst zu nehmen». In Frankreich jedem Schulkind bekannt und als nationaler Kultautor hymnisch verehrt, wird der zwiespältige Schriftsteller hierzulande weitaus skeptischer beurteilt, er ist jedenfalls auch literarisch heftig umstritten.
Der mit über 650 Seiten dickleibige Roman ist eine polemische Abrechnung mit den französischen Eliten der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und der auf den Börsencrash von 1929 folgenden wirtschaftlichen Depression. Ich-Erzähler dieses Episodenromans mit deutlichen Parallelen zur Vita des Autors ist Bardamu, der als junger Freiwilliger die Schrecken des Weltkriegs erlebt und dem es am Ende der ersten Episode gelingt, dem sinnlosen Abschlachten zu entkommen. In weiteren, verbindungslos und vom Plot her nicht stringent erzählten Episoden erleben wir den misanthropischen Helden auf einer fragwürdigen Mission in Afrika, in den USA anschließend, ein wirtschaftlich verheißungsvoller Fluchtpunkt, ehe er schließlich, desillusioniert zurück in Paris, Medizin studiert und sich als Armenarzt niederlässt. Auch diese Episode endet mit einer Flucht aus den prekären Verhältnissen, in denen er lebt, er findet zuletzt eine Anstellung in einer psychiatrischen Klinik am Stadtrand, wird schließlich deren kommissarischer Leiter. Auf all diesen Stationen seines Lebens taucht immer wieder überraschend sein ebenso skrupelloser wie bösartiger Freund Robinson auf, ein mephistophelischer Begleiter. Garniert, anders kann man es wirklich nicht sagen, werden diese Episoden außerdem jeweils mit Frauengestalten, die fast alle aus dem horizontalen Gewerbe stammen, ehe dann in der letzten Episode eine nymphomane Krankenschwester als Geliebte auftritt.
Literarisch wirkt der inhaltlich konturlose Roman wie eine einzige, hasserfüllte Suada, die Erzählerstimme verdeutlicht von der ersten Seite an, dass hier exemplarisch einer spricht, der «die Schnauze voll hat», der zutiefst frustrierte «kleine Mann» nämlich. Die vom Autor nicht nur in den Dialogen, sondern nahezu durchgängig benutzte Umgangssprache ist geradezu gespickt mit Argot, mit einer unflätigen Pariser Gossensprache, sie ist aber auch mit Hochsprache, sogar mit Wissenschaftssprache durchsetzt. Und die Welt, die Céline da schildert, besteht aus Dreck, Scheiße, Rotz, Eiter, Blut, Schweiß, Pisse, ekligem Ausfluss. Überall herrscht infernalischer Gestank, sind Flöhe, Wanzen, Ratten allgegenwärtig, begegnet man bitterster Armut. Alles ist verseucht, krank, desaströs, kaputt, und die titelgebende «Reise ans Ende der Nacht» führt unmittelbar in den Tod, wohin sonst?
So ist denn auch dieser als avantgardistisch geltende Roman letztendlich nichts anderes als Literatur gewordene, anarchistische Polemik, brutal, animalisch, völlig maßlos, – viel zu weitläufig angelegt zudem, geradezu geschwätzig. Was als Kunst gefeiert wird daran, was als authentisch gepriesen wird, ist tatsächlich nichts anderes als der antibürgerliche Furor eines unbelehrbaren, nihilistischen Hasspredigers, der mit seinem wüsten Rundumschlag radikal die Grenzen des guten Geschmacks negiert, jenseits aller Vernunft. Diese literarische Exkursion dürfte also bestenfalls von Lesern mit einem Faible für abseitig Sprachliches wirklich goutiert werden.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Der Sommer ohne Männer
 Mit intellektuellem Anspruch
Mit intellektuellem Anspruch
Als Komödie hat Siri Hustvedt ihren Roman «Der Sommer ohne Männer» bezeichnet, er markiert zugleich einen Perspektivwechsel der amerikanischen Autorin, zu dem sie erklärt hat: «Ich habe zehn Jahre lang als Mann geschrieben, ich dachte, es sei jetzt Zeit, wieder als Frau zu schreiben». Zudem scheint der Stoff ja auch geradezu klischeehaft vorgeprägt zu sein, «Mann verlässt Frau», das wird in der Literatur regelmäßig aus weiblicher Sicht erzählt, meistens von Autorinnen. Gibt es denn da noch etwas Neues zu erzählen, ist denn diese archetypische, geradezu banale Konstellation in Frauenromanen nicht schon bis zum Überdruss thematisiert worden?
Boris, hoch angesehener Neurowissenschaftler in New York, hat seiner Frau Mia, einer erfolgreichen Dichterin, mit der er seit dreißig Jahre verheiratet ist, in ihrer kriselnden Ehe eine Pause vorgeschlagen. Die «Pause» stellt sich als seine vollbusige, zwanzig Jahre jüngere, französische Laborassistentin heraus. Mia dreht völlig durch und landet für anderthalb Wochen in der Psychiatrie, ehe sie anschließend, – als Reha quasi -, für einen Sommer in ein Provinznest nach Minnesota geht, wo ihre neunzigjährige, noch ziemlich aktive Mutter in einem Heim wohnt. Außerdem ist sie auch engagiert worden, im Kulturzentrum des Ortes einen Poesiekurs für Jugendliche zu veranstalten. Innerhalb dieses Handlungsgerüsts berichtet die Ich-Erzählerin Mia über ihre Verzweiflung, verarbeitet ihre Kränkung, versucht zu begreifen, warum es gekommen ist, wie es kam, rekapituliert ihr Leben bis zurück in die Kindheit.
Hustvedt installiert in ihrem männerlosen Roman zwei Frauengruppen, die beide künstlerisch geprägt sind und Mia in ihrem mentalen Chaos Halt geben. Da sind zunächst die von ihr nur als die «Fünf Schwäne» bezeichneten, hoch betagten Freundinnen der Mutter im Altersheim, aber auch die Jugend ist vertreten durch die sieben Mädchen ihrer Poesiegruppe. Und die Nachbarfamilie mit zwei kleinen Kindern sorgt ebenfalls für Trubel, der Mia ablenkt von ihren sinnlosen Grübeleien. Sie schreibt Gedichte, notiert außerdem mancherlei in einem erotischen Tagebuch und führt, zunächst unfreiwillig, eine Email-Korrespondenz mit einem hartnäckigen Stalker, die sich mit der Zeit zu einem geistreichen Gedankenaustausch entwickelt. Der vordergründig banale Plot erhält durch die ausschließlich auf Frauen fokussierte Thematik eine über den Frauenroman hinausreichende Bedeutung, stimmig werden hier die Beziehungen des weiblichen Geschlechts untereinander dargestellt, jung und alt, Mutter und Tochter, Geliebte und Ehefrau, Freundin und Rivalin, – ein Macho würde von latentem Zickenkrieg sprechen. Mit bewundernswertem Scharfsinn zeigt die Autorin geradezu analytisch das komplizierte psychologische Geflecht innerhalb der beiden Gruppen auf, demaskiert kritisch Falschheit, Mobbing, Eifersucht in den femininen Grabenkämpfen, die den Terminus «schwaches Geschlecht» ad absurdum führen.
Dieser Roman beinhaltet eine ernstzunehmende Recherche über die Möglichkeit lebenslanger Paarbeziehungen, – und über die Chancen einer Restitution. Mit ihrer Klassifizierung als Komödie hat Siri Hustvedt ihre Absicht verdeutlicht, zur Entkrampfung einer soziologischen Problematik beizutragen, die gleichermaßen brisant und omnipräsent ist. Weniger überzeugend als diese thematische Komponente ihres Romans ist die stilistische Umsetzung des Stoffs. Da wäre die besonders in der ersten Hälfte nervige Zergliederung der Geschichte in Erzählschnipsel zu nennen, die Langatmigkeit des Erzählens auch, wobei die Erzählerin, die sich öfter mal neckisch direkt an den Leser wendet, hier um Geduld bittet. Prosaleser wie mich nerven auch die eingestreuten lyrischen Ergüsse, lächerliche Wortakrobatik in meinen Augen, und mit den Strichzeichnungen konnte ich ebenfalls nichts anfangen. Gleichwohl, dieser Roman ist eine Rarität, ein Frauenroman nämlich mit intellektuellem Anspruch, nicht mehr und nicht weniger.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Ein sanfter Tod
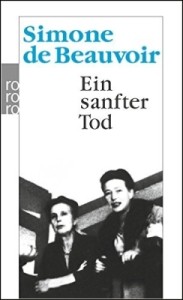 Meistverdrängtes Menschheitstrauma
Meistverdrängtes Menschheitstrauma
Das Werk der französischen Schriftstellerin Simone de Beauvoir ist neben seiner explizit philosophischen Ausrichtung oft auch autobiografisch geprägt, dem 1964 erschienenen Roman «Ein sanfter Tod» liegt dieses für sie spezifische Sujet ebenfalls zugrunde. Es geht um den Tod ihrer Mutter, mit der die Autorin lebenslang ein gespanntes, distanziertes Verhältnis hatte, das sich nun im Sterbeprozess zu verändern beginnt. In den sechs Jahre vorher erschienenen «Memoiren einer Tochter aus gutem Hause» hatte die Autorin die Vorgeschichte der Entfremdung mit ihrer Mutter sehr detailliert beschrieben. Im vorliegenden Roman nun greift de Beauvoir darauf zurück, sie erwähnt das der damaligen Veröffentlichung folgende Zerwürfnis. Die jüngere Schwester übernahm es dann, die erboste Mutter zu beschwichtigen. «Ich begnügte mich damit, ihr einen Blumenstrauß zu schicken und mich wegen eines Wortes zu entschuldigen; das rührte und verblüffte sie übrigens. Eines Tages sagte sie zu mir: Eltern verstehen ihre Kinder nicht, aber das gilt auch umgekehrt…»
Vor diesem Hintergrund erzählt de Beauvoir von einem häuslichen Unfall der 77jährigen Mutter. Bei den Untersuchungen in der Klinik wird neben einem Schenkelhalsbruch auch noch eine Bauchfellentzündung vermutet. Der Zustand der Patientin verschlechtert sich jedoch zusehends, es folgen weitere ärztliche Befunde, bis sich schließlich herausstellt, dass eine Krebsgeschwulst ihren Dünndarm verschließt. «Lassen Sie sie nicht operieren» raunt eine es gut meinende, ältere Krankenschwester den beiden Töchtern zu. Sie entscheiden anders, bei der Operation wird dann eine riesige Krebsgeschwulst gefunden, die kurzzeitig zum Tode führen würde. Was folgt ist ein vierwöchiger schmerzvoller Sterbeprozess, den die Autorin minutiös beschreibt, in dem sich auch das gespannte Verhältnis zur Mutter allmählich bessert, dessen unabwendbares Ende ihr jedoch rücksichtsvoll verschwiegen wird.
In dem Auf und Ab des körperlichen Verfalls wird deutlich, wie sehr doch die Mutter am Leben hängt. Sie will nicht sterben, lehnt sogar strikt allen behutsam angebotenen geistlichen Beistand ab. Was erstaunlich scheint, war doch gerade die unbeirrbare religiöse Bindung der Mutter einst Auslöser für die Differenzen, zu denen dann der damals fast skandalöse Lebenswandel der emanzipierten Tochter noch erschwerend hinzukam. Denn Simon de Beauvoir hatte eine völlig andere Auffassung von der Rolle der Frau, die sie in ihrem erfolgreichsten Werk «Das andere Geschlecht» niederschrieb. Ihre Erkenntnis, «man wird nicht zur Frau geboren, man wird dazu gemacht von der Gesellschaft» hat ihr für immer den Status einer Ikone der Frauenbewegung verliehen.
Der Roman ist insoweit ein Zeugnis der weiblichen Emanzipation, die sich innerhalb der einen Generation von Mutter zur Tochter entscheidend weiterentwickelt hatte. Die Geschichte, die auch eine Rückblende auf die familiären Verhältnisse beinhaltet, wird äußerst detailverliebt erzählt in einer nüchternen, uneitlen Sprache, die flüssig zu lesen ist. Zweifellos aber ist der Roman als Auslöser für philosophische Diskurse geeignet, wozu auch die Frage gehört, ob jede medizinisch mögliche Verlängerung des Lebens wirklich immer geboten ist. Aus atheistischer Sicht bleibt mir unverständlich, warum man denn verzweifelt den doch fest versprochenen Einzug der bußfertigen Glaubenden in den Himmel unbedingt hinausschieben will? Bedeutet das etwa Zweifel an den Grundfesten religiöser Verheißungen? Die Versöhnung zwischen Mutter und Tochter findet nur nonverbal statt, durch Gesten, Lächeln, ein sanfter Tod also zu guter Letzt, wenigstens auf emotionaler Ebene. In einer resümierenden Schlussbetrachtung beleuchtet die Autorin den Tod aus existentialistischer Sicht, er sei widernatürlich, «weil seine Gegenwart die Welt in Frage stellt», ein Unfall für den Menschen «und, selbst wenn er sich seiner bewusst ist und sich mit ihm abfindet, ein unverschuldeter Gewaltakt».
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Frühstück bei Tiffany
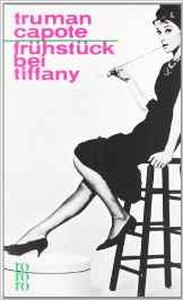 Satire auf New Yorks Schickeria
Satire auf New Yorks Schickeria
Im Werk des in New Orleans geborenen Schriftstellers Truman Capote markiert der 1958 erschienene Kurzroman «Frühstück bei Tiffany» einen Höhepunkt seines vielseitigen Schaffens, das durch seine Tätigkeiten als Drehbuchautor und Schauspieler dem Film stets eng verbunden war. Ein Jahr nach der amerikanischen Erstausgabe erschien der Roman bereits in deutscher Übersetzung, 1961 folgte dann die berühmte Verfilmung des Stoffes mit Audrey Hepburn und machte die Geschichte von Holly Golightly einem weltweiten Publikum bekannt. Wie so oft kann aber auch hier der Film nicht wirklich überzeugen, wenn man ihn mit dem Buch vergleicht, also heißt es selber lesen, will man die berühmte Erzählung unverfälscht und ungeschmälert in allen ihren Facetten goutieren.
Im Mittelpunkt der Geschichte, die zeitlich im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist, steht die unkonventionelle 19jährige Holly Golightly, deren in etwa mit «Leichtfuß» übersetzbarer Nachname schon ihren Lebenswandel andeutet, sie schlägt sich frech und unbekümmert als Partygirl durchs New Yorker Nachtleben. Ihre diversen Verehrer nimmt sie erfindungsreich und gnadenlos aus, ohne ihnen entgegen zu kommen, als attraktive Frau auch nur ein wenig von dem zu bieten, wonach sie alle lechzen. Namenlos bleibender Ich-Erzähler ist ihr mutmaßlich schwuler Nachbar, der sich schon bald als einziger echter Freund erweist in einer ansonsten platonischen Beziehung. Denn nicht immer ist Hollys Leben lustig und unbeschwert, und wenn sie den Koller bekommt, das «rote Grausen», wie sie es nennt, dann ist wieder ein Besuch bei Tiffany fällig, dem Juwelier in der Fifth Avenue, – nicht als Kundin, nur der besonderen Atmosphäre wegen, die sie dann immer rasch wieder aufrichtet. Ihr Charme, ihre Cleverness und Unverfrorenheit helfen ihr zuverlässig über alle Klippen. Schlussendlich will sie José heiraten, einen brasilianischen Diplomaten, von dem sie ist schwanger ist und mit dem sie nach Rio de Janeiro ziehen will.
Aber sie hatte vor einiger Zeit unbedarft einen Job angenommen, der ihr jeweils hundert Dollar einbringt, nämlich Sally Tomato wöchentlich im Zuchthaus Sing-Sing zu besuchen. Die harmlos scheinenden Botschaften, die er ihr dabei mündlich mitgibt, werden ihr zum Verhängnis, sie wird verhaftet unter dem Verdacht, für den Mafiaboss gearbeitet zu haben. José trennt sich daraufhin von ihr, um sein Ansehen besorgt. Holly erleidet eine Fehlgeburt, flieht aus dem Krankenhaus und nutzt kurz entschlossen ihr Flugticket nach Rio, danach hört der Erzähler nichts mehr von ihr. Bis eines Tages eine Postkarte eintrifft: «Brasilien war scheußlich, aber Buenos Aires ganz toll. Nicht Tiffany, aber fast. Bin hüftabwärts mit himmlischem Señor verbunden. Liebe? ich glaube nicht. Sehe mich jedenfalls nach was zum Wohnen um (Señor hat Frau und sieben Bälger) und lasse Sie Adresse wissen, sobald ich selber weiß. Mille tendresse.» Diese Adresse aber hat er nie bekommen.
Truman Capote schreibt hier in bester US-amerikanischer Erzähltradition, journalistisch knapp und zielgerichtet mit dem Augenmerk immer auf seiner Geschichte, die er chronologisch erzählt. Sein völlig unprätentiöser Sprachstil ist leichtfüßig wie Hollys Lebensweise, gekonnt angereichert mit Alltagssprache aus dem Milieu einer exzentrischen Lebedame, eine leicht zu lesende, amüsante Satire auf die Schickeria von New York. Denn immer wieder kommt man ins Schmunzeln bei den teils grotesken Situationen, in die Holly und ihr Nachbar unversehens hineinschlittern. Für Buchleser erhellend aber ist auch der Vergleich mit dem vermutlich allseits bekannten Spielfilm. Dort bleibt nämlich von der verruchten Atmosphäre um die lebensgierige Holly so gut wie nichts übrig, die Story wird dank Audrey Hepburn wie mit Zuckerguss serviert, und ein kitschiges Happy End verkehrt schließlich die Intention des Autors geradezu ins Gegenteil. Den Roman zu lesen lohnt sich deshalb allemal!
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
Ein liebender Mann
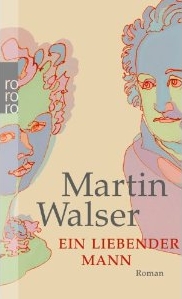 So weit so gut, hätte Ulrike da wohl gesagt, s.w.s.g.
So weit so gut, hätte Ulrike da wohl gesagt, s.w.s.g.
Walsers männlicher Protagonist, der 74-jährige Johann Wolfgang von Goethe, erschießt sich bekanntlich nicht, wie es seine berühmte Romanfigur, der junge Werther, aus Liebesgram getan hat, womit damals ja eine Aufsehen erregende Welle von Nachahmungstaten ausgelöst wurde. Gleichwohl leidet auch der greise Geheimrat im Sommer 1823 unsäglich an Liebeskummer, zum Ausdruck gebracht in der Marienbader Elegie, diesem Liebesgedicht aus «Glut, Blut, Mut und Wut». Martin Walser nutzt für den Stoff seines biografischen Liebesromans eine Informationslücke im ansonsten bestens dokumentierten Leben des großen Dichters, seine beim Kuraufenthalt in Marienbad aufgeflammte späte Liebe zu der 55 Jahre jüngeren Ulrike von Revetzlow. Altersunterschiede dieser Größenordnung waren und sind immer ein beliebtes Thema, denn nicht nur Charlie Chaplin ist ja im Opa-Alter noch Vater geworden, auch die Liste der Lustgreise unserer Tage ist ellenlang, in den bunten Blättern der Boulevardpresse stets süffisant kommentiert, die prominenten Namen setze ich mal als bekannt voraus. Im frühen Neunzehnten Jahrhundert hingegen ging es weitaus betulicher zu, wie wir bei Walser nachlesen können.
Der Roman ist dreiteilig aufgebaut und beginnt furios mit der Schilderung der Liaison, die sich da anbahnt, allerdings nur in der Wunschvorstellung des alten Herrn. Das ungleiche Paar versteht sich jedenfalls blendend und sprüht vor Lebensfreude, Walser erzählt das beinahe wie eine Komödie, mit Witz und Elan jedenfalls. Es gibt amüsante Dialoge zwischen den Beiden, überhaupt wird die Konversation zu jener Zeit und in diesen Kreisen als recht geistreich dargestellt, mit verschiedensten anspruchsvollen Themen befasst. Man gibt sich auch ganz genüsslich dem bei solchem Kuraufenthalte üblichen Reigen wiederkehrender Zerstreuungen hin, lange Spaziergänge auf der Promenade, gegenseitige Besuche, kleine Landausflüge, Dinner-Einladungen und pompöse Bälle. Und unser Lustgreis, der Geheimrat Goethe, geht dann doch tatsächlich so weit, seinen ebenfalls kurenden Landesherren zu bitten, für ihn bei der verwitweten Mutter um die Hand der nichtsahnenden 19-jährigen Ulrike anzuhalten. Und das läuft, man ahnt es gleich, gründlich schief!
Es folgt die übereilte Abreise der angehimmelten Jungfrau, von der wir so gut wie nichts erfahren, die der Autor jedenfalls wie einen unbedeutenden Kometen an der strahlenden Sonne namens Goethe vorbeifliegen lässt. Sicher ist nur ihr weiblicher Status, die Jungfräulichkeit also, denn mehr als ein überschwängliches, völlig unschuldiges Küsschen auf die geschlossenen Lippen ist nicht gewesen zwischen den Beiden, wie Walser uns erzählt. Wobei er sich, ohne Not allerdings, denn das alles ist ja nur Fiktion, streng an die Tatsachen hält, Ulrike von Levetzow hat sich dazu später nämlich sehr eindeutig erklärt. Der Autor beginnt nun zu schwadronieren im zweiten Teil seines Romans, Goethes Liebeskummer, diese seitenlange Rührseligkeit, oft in inneren Monologen oder fiktiven Briefen ausgedrückt, ist schwer zu ertragen. Man fühlt sich als Leser nach der erfrischenden Oase des ersten Teils plötzlich in einer öden Wüste und kämpft sich durch, begegnet Seite um Seite einer unsäglichen Larmoyanz, die regelrecht peinlich ist und langweilig obendrein.
Im dritten Teil greift Walser auf die Technik des Briefromans zurück und schildert so die langsam einsetzende Erkenntnis seines Protagonisten, dass er diese ja nur imaginierte Liebschaft aus seinen Gedanken streichen muss. Aber das gelingt nicht, lässt der Autor uns wissen, denn in Walsers vulgärer Pointe ganz am Ende des Romans wacht der Herr Geheimrat morgens auf und hält seinen Morgensteifen in den Händen, wir wissen also genau, wovon der 74-Jährige geträumt hat. So weit so gut, hätte Ulrike da wohl gesagt, s.w.s.g.
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Fiesta
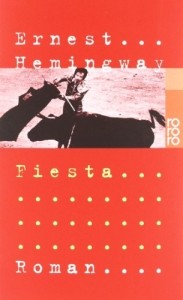 Wär schön gewesen
Wär schön gewesen
Um «Fiesta» von Ernest Hemingway habe ich jahrzehntelang einen großen Bogen gemacht, denn untrennbar mit diesem ersten, größeren Roman des späteren Nobelpreisträgers verband sich für mich Pamplona und der Stierkampf. Auf einer Andalusien-Reise vor zwei Jahren erzählte uns ein Reiseleiter während der Busfahrt gedankenverloren so detailliert von der Corrida de Toros, dass ein offensichtlich zartbesaiteter Mitreisender erregt eingeschritten ist und ihn ultimativ aufforderte, sofort diese blutrünstige Schilderung abzubrechen, – das war damals durchaus auch in meinem Sinne. Nach der Lektüre dieses Romans nun muss ich mein diesbezügliches Vorurteil revidieren, Hemingways Schilderung der Fiesta de San Fermin mit den dazugehörigen Stierkämpfen ist überhaupt nicht abstoßend, ja sie hat bei mir sogar ein gewisses Verständnis für die Euphorie der Spanier erzeugt. Insoweit gibt es also wirklich keinen Grund, dieses Buch nicht zu lesen, das vorab!
Hemingway ist ja ein typischer Vertreter der «Lostgeneration», jener durch den Ersten Weltkrieg desillusionierte Gruppe junger Menschen, die in diesem Roman die Protagonisten stellen und deren Ziellosigkeit die eigentliche Thematik der Geschichte bildet. Ich-Erzähler Jake, ein amerikanischer Journalist in Paris, stellt uns zu Beginn Robert vor, ein ehemaliger Box-Champion in Princeton. «Glauben Sie nicht etwa, dass mir so ein Boxtitel imponiert» heißt es dann schon im zweiten Satz, der Autor spricht seinen Leser also direkt an, stellt mit ihm sofort eine gewisse Intimität her. Robert wurde Schriftsteller, und mit Bill gehört noch ein weiterer Schriftsteller zu dem Kreis um Jake. Sie beschließen, zur Fiesta nach Pamplona zu fahren und vorher noch eine Woche lang in den Pyrenäen Forellen zu angeln. Die 34jährige Lady Ashley, ehemalige Krankenschwester, von den Freunden Brett genannt, und Mike, den sie zu heiraten gedenkt, ein Bankrotteur, wie sich später herausstellt, wollen auch nach Pamplona kommen. Brett liebt zwar Jake, sie hatten sich einst im Lazarett kennengelernt, er aber ist durch seine Kriegsverletzung impotent geworden. Darin nun liegt die Tragik dieser lebensgierigen Frau, um die sich im Grunde alles dreht in diesem Roman, sie schätzt nun mal eine robuste Virilität bei ihren Männern.
Der überwiegende Teil des kurzen Romans ist in Dialogform geschrieben, in der für Hemingway typischen, spartanisch knappen Sprache. «In diesem Buch wird viel getrunken. Erst in Paris: Absinth, Champagner, dann in Spanien der funkelnde Fundador. Und es wird auch viel geraucht … ». Dieses Zitat stammt zwar aus dem Buch, ist aber nicht vom Autor, es ist eine durchaus stimmige, listig in mein historisches Buchexemplar von 1952 eingefügte Zigaretten-Werbung. Und in der Tat, gefühlt ein Drittel des Textes handelt vom Essen, Trinken – oft eher Saufen – und vom Rauchen, was neben Jagen, Fischen, dem Stierkampf und Frauen natürlich die Passionen Hemingways sind. Dass er seinen ihm, dem ausgewiesenen Macho, so ähnlichen Helden nun ausgerechnet impotent sein lässt, verleiht seiner Geschichte eine urkomische Tragik. Und so heißt es denn auch im Schlusssatz melancholisch: «Ach, Jake … wir hätten so glücklich sein können». Der erwidert: «Ja, … wär schön gewesen».
Die Gespräche der Protagonisten sind fast durchweg Geschwafel ohne tieferen Sinn, lebensnah eben in ihrer Banalität. Literarisch erfreulicher fand ich den Ausflug zum Forellenangeln und die wirklich gelungene Beschreibung der Corrida. Die Personen aber bleiben allesamt blass und unkonturiert, ihre Beziehungen zueinander sind oberflächlich, selbst die des Liebespaares. Begeistern konnte mich das alles nicht!
Fazit: mäßig
Meine Website: http://ortaia.de
Heimkehr
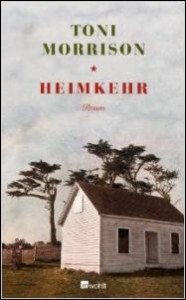 Vom moralischen Potenzial der Literatur
Vom moralischen Potenzial der Literatur
Mit «Heimkehr» hat die afroamerikanische Schriftstellerin Toni Morrison einen Zyklus fortgesetzt, der mit dem Roman «Jazz» begann. Dabei steht die Situation der farbigen Bevölkerung der USA zu verschiedenen Zeiten im Mittelpunkt, hier ist es der Rassismus der frühen Fünfzigerjahre. «Hätte Amerika eine Nationalschriftstellerin, so wäre es Toni Morrison» hat die New York Times über die Nobelpreisträgerin von 1993 geschrieben. Eine derartige Wertung kann nur qualitativ interpretiert werden, widmet sich die streitbare Autorin in ihrem Werk doch ausschließlich dem unterprivilegierten farbigen Teil der amerikanischen Bevölkerung, leiht also nur einer Minderheit ihre Stimme, nicht dem gesamten Volke. «Es wird niemand meine Literatur verstehen, der nicht versteht, aus welch anderem Humus sie wuchs als die Literatur der John Updike oder Saul Bellow», hat sie im Interview mit dem kürzlich verstorbenen Fritz J. Raddatz gesagt. Und ebenso eindeutig ist der feministische Blickwinkel, aus dem heraus sie schreibt, die Männer kommen allesamt schlecht weg in ihren Geschichten, so auch in ihrem vorliegenden neuen Roman.
Frank kehrt traumatisiert aus dem Koreakrieg zurück, in dem er seine zwei Kumpels verloren hat. Er stürzt ab, versinkt in Alkohol-Exzessen, trennt sich von seiner Freundin und landet in der geschlossenen Psychiatrie, ohne sich recht erinnern zu können, was ihn dort hingebracht hat. Weil er schlimme Nachrichten über seine innig geliebte Schwester erhalten hat, die im Sterben läge, bricht er aus von dort, will schnell zu ihr. Auf seiner Flucht erlebt er die Solidarität vieler Menschen, die ihm selbstlos weiterhelfen. Er findet Cee in schlimmem Zustand vor, ein dilettantischer Gynäkologe hatte in Narkose medizinische Experimente an ihr vorgenommen. Es sind die schwarzen Frauen ihres Heimatdorfes, die sie wieder aufpäppeln mit allerlei Heilkünsten jenseits der Schulmedizin. Diese starken Frauen, allesamt Analphabetinnen, sind die Stütze der kleinen Gemeinde, sie sind es, die heilen, die für Essen und Kleidung sorgen, den eigenen Garten bestellen, ihre Tiere füttern, Feldarbeit leisten, die bösen Geister fernhalten. Und die bei alledem noch singen, sich die alten Geschichten erzählen, dem Leben zugetan sind trotz aller Fährnisse und Widrigkeiten.
Es mangelt nicht an Grausamkeiten in diesem Roman, auf dem Kriegsveteranen lastet die Erinnerung an den grausamen Mord, den er in Korea an einem kleinen Mädchen verübt hat. Ein Trauma schon im Kindesalter war für die bei ihrer lieblosen Großmutter aufgewachsenen Geschwister, wie sie unfreiwillig Zeugen wurden, als ein Schwarzer heimlich auf einer Pferdekoppel verscharrt wurde. Frank findet heraus, dass es sich damals um das Opfer eines grauenhaften Kampfes gehandelt habe, zu dem zwei Farbige, Vater und Sohn, von einem weißen Mob gezwungen wurden, einem Hahnenkampf ähnlich, bei dem einer von Beiden in jedem Fall sterben musste. Ganz untypisch für Toni Morrison endet ihre Geschichte jedoch versöhnlich, um nicht zu sagen kitschig, Frank überwindet seine Psychosen, findet in seiner Fürsorge für Cee wieder Halt und Lebenssinn.
Abwechselnd auktorial und personal aus der Perspektive Franks erzählt, zuweilen sogar durch innere Monologe, in denen er die Autorin selbst anspricht, vermittelt der Roman das Bild eines zutiefst traumatisierten Mannes, dem gleichwohl seine Menschlichkeit erhalten geblieben ist. In schnörkelloser Sprache, mit ungekünstelten Dialogen und in diversen Rückblenden wird in dem schmalen Band das Bild einer typischen Südstaaten-Gesellschaft auf dem Lande gezeichnet. Zeitlich ist das Geschehen im Vorfeld der Rassenkämpfe angesiedelt, die diese Zuständen bis zum heutigen Tage allenfalls abmildern, nicht aber wirklich beseitigen konnten – als Stichwort sein nur Ferguson genannt, derzeit Thema in allen Medien. Gerade in Hinblick darauf ist «Heimkehr» ein überzeugender Beweis für das moralische Potenzial der Literatur.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de