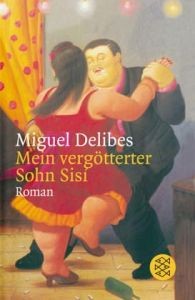 Ein Unsympath
Ein Unsympath
Miguel Delibes war in seiner Heimat Spanien als Schriftsteller sehr erfolgreich, er hat ein beeindruckendes Œuvre von etwa 70 Büchern vorzuweisen. Zu dem auch der vorliegende, 1953 veröffentlichte Roman «Mein vergötterter Sohn Sisí» aus dem Frühwerk gehört, 1976 verfilmt und erst 2003 auch auf Deutsch erschienen. Neben den vielen Ehrungen im spanischen Sprachraum war er auch mehrfach Kandidat für den Nobelpreis. Seine frühen Romane sind stark durch den Spanischen Bürgerkrieg geprägt und werden zur sozialrealistischen Literatur eines Landes gezählt, dessen tiefe gesellschaftliche Gegensätze darin thematisiert werden.
Der deskriptive Titel deutet schon darauf hin, es handelt sich hier um einen Familienroman. Der ist zeitlich in drei Abschnitte gegliedert, wobei im ersten Buch ein Zeitraum von 1917 bis 1920 behandelt wird. Im Mittelpunkt steht dabei der wohlhabende Cecilio Rubes, der in einer spanischen Provinzstadt einen alteingesessenen Sanitärhandel betreibt. Verheiratet ist der fette, selbstgerechte, antriebslose Mann mit einer ungebildeten, frigiden Frau, die den sexuell aktiven Enddreißiger geradezu in die Arme anderer Frauen treibt. Er hält sich prompt mit Paulina eine viel jüngere, attraktive Geliebte, für die er eine Wohnung eingerichtet hat, sein Liebesnest, ohne das er nicht leben könnte. Als sich trotz unterkühlter Ehe spät, und von ihm eigentlich ungewollt, Nachwuchs einstellt, ist der auf Reputation bedachte Macho plötzlich ganz aus dem Häuschen, sein langweiliges Leben bekommt damit überraschend einen Sinn. Man erkennt schon bald, wie er den Sohn verhätscheln wird, und Cecilio Rubes macht dann auch so ziemlich alles falsch in der Erziehung, was man falsch machen kann, der vergötterte Junge wird zum Abbild seiner selbst. Im zweiten Buch dann (1925-1929) erleben wir, wie aus dem Kind ein verwöhnter, nichtsnutziger, bösartiger Tyrann wird, dessen Mutter schier verzweifelt, weil der despotische Vater jedwede Erziehung vereitelt nach dem Motto: Mein Sohn soll es gut haben, Erziehung ist was für die Armen. Schließlich aber holt im dritten Buch (1935-1938) der Bürgerkrieg den verzogenen Sisí aus seinem Lotterleben heraus, er muss an die Front, und auch der Vater erwacht am Ende aus seiner Realitätsferne, er erkennt, viel zu spät allerdings, dass er total versagt hat.
Frauen sind das beherrschende Thema in dieser ausufernden Geschichte, immer wieder werden, nicht nur im Herrenclub, ihre Hüften und Fesseln bewundert. Zeittypisch und wohl auch dem prüden Katholizismus verpflichtet ist die Sexualität hier zwar allgegenwärtig, sie unterliegt aber sprachlich einer fast schon grotesk anmutenden Verklausulierung, der Roman ist jedenfalls jugendfrei ab null Jahre. Die geschilderte, abstoßend patriarchalische Gesellschaft ist für uns Heutige einerseits schwer erträglich, man spürt aber andererseits permanent den ironischen Unterton des Autors, der durch Übertreibungen und durch grotesk überzeichnete Figuren die Distanz zum Erzählten sehr deutlich herstellt.
Weite Teile des Plots entwickeln sich aus Dialogen heraus, zu denen sich oft die innere Rede gesellt, manchmal im schnellen Wechsel mit der direkten Rede, womit das unredlich Gesagte immer wieder virtuos konterkariert wird mit dem tatsächlich Gedachten, was ich so, in dieser Konsequenz, noch nie gelesen habe. Berührend auch eine Stelle, als die Mutter von Cecilio stirbt. «Für ihn hatte seine Mutter soeben den Raum verlassen, ohne dass sich die Türen oder Fenster geöffnet hätten». Angesichts der Leiche fragt er sich: «Nun, das ist sie nicht. Was hat diese Gestalt mit meiner Mutter gemeinsam?» Dieser in der Franco-Ära geschriebene, opulente Roman lässt sich sehr viel Zeit, seine Geschichte vor uns auszubreiten. Die ersten hundert Seiten sind zäh zu lesen, bis Seite 200 etwa legt die Geschichte erzählerisch langsam zu, sie steigert sich danach allmählich zum so nicht absehbaren Ende hin. Man braucht also einiges an Geduld!
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Für die Fragen- und Denkbereiten
Für die Fragen- und Denkbereiten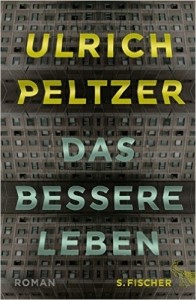 Modern Times
Modern Times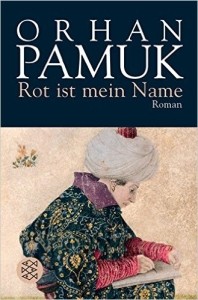 Gipfel literarischer Ambivalenz
Gipfel literarischer Ambivalenz Ganz ohne DDR-Mief
Ganz ohne DDR-Mief Kein Geschichterl
Kein Geschichterl Berichte aus dem literarischen Olymp
Berichte aus dem literarischen Olymp In meinem Ende ist mein Anbeginn
In meinem Ende ist mein Anbeginn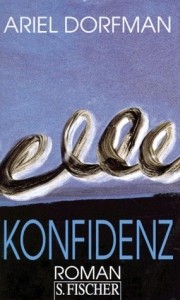 Weniger wäre mehr gewesen
Weniger wäre mehr gewesen Verlorene Zeit
Verlorene Zeit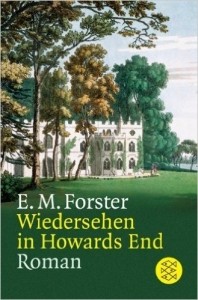 Tea Time
Tea Time De gustibus non est disputandum
De gustibus non est disputandum Die Notation des Herzens
Die Notation des Herzens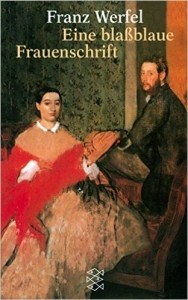 Ein Opportunist am Scheideweg
Ein Opportunist am Scheideweg Ein Roman mit Zugabe
Ein Roman mit Zugabe