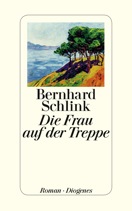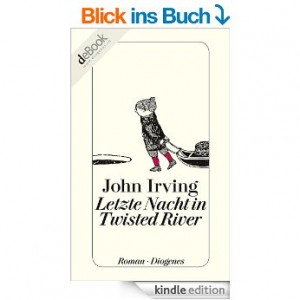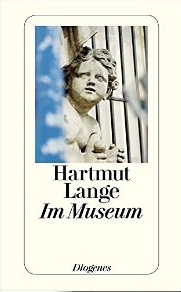 Einmal Geschehenes kann man nicht zurückholen, auch nicht, indem man Exponate aus vergangenen Zeiten im Museum präsentiert. Da ist das Kleidungsstück fein ausgestellt, doch der Mensch, der vor Jahrhunderten darin steckte, bleibt für immer verschwunden. Ist es denn verrückt, wenn in Erzählungen Gestalten aus vergangenen Epochen in einem Museum lebendig werden? „Die Literatur hat ihren eigenen Wahrheitsgrund“, meint Hartmut Lange und lässt in den sieben Kapiteln seines Bändchens „Im Museum. Unheimliche Begebenheiten“ Protagonisten aus den Tiefen der Geschichte, Museumspersonal und Besucher einander begegnen. Es ist wahrhaft mysteriös, was sich in Hallen, Gängen, Korridoren, auf Treppen und Emporen des Deutschen Historischen Museums in Berlin abspielt.
Einmal Geschehenes kann man nicht zurückholen, auch nicht, indem man Exponate aus vergangenen Zeiten im Museum präsentiert. Da ist das Kleidungsstück fein ausgestellt, doch der Mensch, der vor Jahrhunderten darin steckte, bleibt für immer verschwunden. Ist es denn verrückt, wenn in Erzählungen Gestalten aus vergangenen Epochen in einem Museum lebendig werden? „Die Literatur hat ihren eigenen Wahrheitsgrund“, meint Hartmut Lange und lässt in den sieben Kapiteln seines Bändchens „Im Museum. Unheimliche Begebenheiten“ Protagonisten aus den Tiefen der Geschichte, Museumspersonal und Besucher einander begegnen. Es ist wahrhaft mysteriös, was sich in Hallen, Gängen, Korridoren, auf Treppen und Emporen des Deutschen Historischen Museums in Berlin abspielt.
Wer hätte als Besucher einer Ausstellung nicht schon einmal darüber nachgedacht, was in jemandem vorgeht, dessen Aufgabe darin besteht, Exponate zu bewachen? Zum Beispiel die Frau, die Tag für Tag unauffällig ihre Arbeit neben der Statue Carls des Großen macht. In Langes Geschichte bekommt sie einen Namen und sitzt nach Feierabend auf ihrem Sofa. Wir sind dabei, wie die höchst zuverlässige Frau Bachmann auf der Suche nach der Ursache eines Luftzuges die abendliche Schließung des Gebäudes verpasst, die Nacht im Museum verbringt und spurlos verschwindet. Und da ist Aufseherkollege Klinger, zu DDR Zeiten Leutnant der Staatsicherheit. Als Aufpasser sieht er sich nun mit einem „Schuppen voller Plunder“ konfrontiert. Ihn zieht es in einen Geheimgang im Keller des Hauses, in den er einen arglosen Besucher locken und einen fiesen Plan verwirklichen will.
In nächtlicher Stille wäre das „Gluckern in den Heizkörpern“ und das „Knacken unter dem Fußboden“ ganz normal, wäre da nicht der Schatten eines Mannes mit Militärkappe, der zu Lebzeiten in seinem Rassenwahn Deutschland und Europa terrorisierte. Nacht für Nacht geistert er ruhelos durch die Ausstellungsräume. Die Darstellung eines anderen Despoten lässt ihm keine Ruhe. Da wird das Bildnis Napoleon Bonapartes kostbar mit Brokat und Lorbeerkranz präsentiert, er hingegen „wie ein Paria“ in den Keller verbannt.
Wenn ein Herr Polenz nach Feierabend in die von der Frau verlassene Wohnung kommt, einen Zettel vorfindet, und danach ohne besondere Absicht das Deutsche Historische Museum betritt, ahne ich schon Verwicklungen. Wie ist es möglich, dass weder die Drehtür zum Festungsgraben noch die zum Boulevard Unter den Linden ihn wieder herauslässt und er sein zu Hause im Flur abgestelltes Fagott und die Querflöte im notbeleuchteten Museumsfoyer entdeckt? Und es hat auch etwas Skurriles, wenn eine Frau aus dem 19. Jahrhundert ihrer kleinen Tochter erklärt, warum sie vor der ratternden Rolltreppe keine Angst haben muss und wenn ein junger Volontär mitten in der Nacht heimlich zuschaut, wie jene Mutter und ihr Kind auf den Fliesen im menschenleeren Schlüterhof sitzen und durch das Glasdach den Himmel anschauen.
Wie es sein kann, dass ein Foto von Rodins „Denker“ immer wieder Risse und Kratzer bekommt, fragt sich ein Mitglied des Fördervereins in der letzten Story im Buch. Von einem gewaltsam zu Tode gekommenen Mann wird er darüber aufgeklärt, was sein Schicksal mit Denken zu tun hat. Die Parole „liberté, égalité, fraternité“ hat ihm den Tod gebracht. „Und war es nicht tatsächlich so, dass sich das Töten durch die Perversion des Denkens bis in alle Ewigkeit fortsetzte?“, resümiert der Erzähler.
In den sieben Erzählungen „Im Museum“, die alle im Gebäude des Deutschen Historischen Museum in Berlin spielen, lässt der für seine herausragenden Novellen bekannte Autor Hartmut Lange Protagonisten aus der Gegenwart und aus verschiedenen Epochen einander begegnen und im Dialog miteinander auftreten. Am liebsten nachts bei Notbeleuchtung schickt er sie in den dunklen Korridor, vor die verschlossene Tür, die frisch verputzte Wand, ins Museumscafé, in den Schlüterhof und den “Gigantenhäuptern mit qualvoll aufgerissenen Mündern“ und lässt sie an der verflixten Drehtür verzweifeln. Dabei spielt er souverän mit verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven, schlüpft mal in die Rolle des allwissenden Erzählers mal in die des einen oder anderen Protagonisten. Angenehm, mit welcher Selbstverständlichkeit ihm das fern jeder besserwisserischen Psychoschau gelingt.
Beim wiederholten Lesen versuche ich mir zu erklären, mit welcher sprachlichen Raffinesse Hartmut Lange es schafft, diesen Sog zu erzeugen, der mich unwillkürlich am Text hält. Da ist der Widerspruch zwischen schnörkellosen, ja banal anmutenden Formulierungen und der gespannten Erwartung, welche Überraschung der Autor denn nun wieder für mich bereit hält. Und wie könnte ich nicht Abgründe wittern, wenn ein Kapitel so beginnt: „Ich gebe zu, ich mache mir unnötige Gedanken, und ich hatte unlängst die Gelegenheit, vor einem dunklen Korridor zu sitzen.“
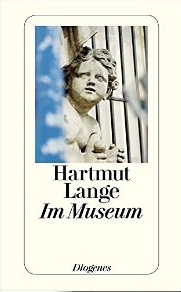



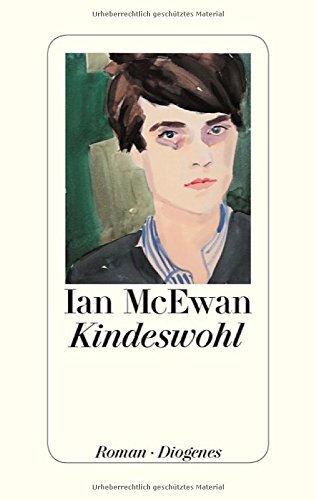
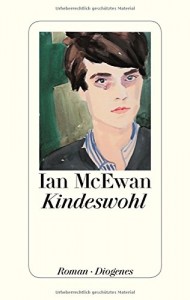 Inhalt: Familienrecht ist das Spezialgebiet der Richterin Fiona Maye am High Court in London: Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls. In ihrer eigenen Ehe ist sie seit über dreißig Jahren glücklich. Da unterbreitet ihr Mann ihr einen schockierenden Vorschlag. Und zugleich wird ihr ein dringlicher Gerichtsfall vorgelegt, in dem es um den Widerstreit zwischen Religion und Medizin und um Leben und Tod eines 17-jährigen Jungen geht.
Inhalt: Familienrecht ist das Spezialgebiet der Richterin Fiona Maye am High Court in London: Scheidungen, Sorgerecht, Fragen des Kindeswohls. In ihrer eigenen Ehe ist sie seit über dreißig Jahren glücklich. Da unterbreitet ihr Mann ihr einen schockierenden Vorschlag. Und zugleich wird ihr ein dringlicher Gerichtsfall vorgelegt, in dem es um den Widerstreit zwischen Religion und Medizin und um Leben und Tod eines 17-jährigen Jungen geht.