
No Limit. Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit
No Limit. Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit. “Die Neunziger enden am 11. September 2001. An ihrem Beginn fällt die Berliner Mauer, an ihrem Ende fallen zwei Türme in New York City.” Das Jahrzehnt, das so verheißungsvoll begonnen hatte (“Wind of Change”) endet mit einem Vatermord. Denn der Vater Osama Bin Ladens war genau der Bauunternehmer, der in Saudi-Arabien die Architektur Minoru Yamasakis umsetzte. Und in New York die Twin Towers.
Jahrzehnt der Widersprüche
Wem das jetzt schon zu konspirativ klingt, der hat die Neunziger nicht erlebt. Denn tatsächlich war es ein Jahrzehnt der Widersprüche. Nicht nur politisch, sondern auch kulturell-musikalisch. So steht 1993 gleichzeitig für “the year that grunge broke out”, andererseits auch für den weltweiten Durchbruch von Tekkno. Elektronische Musik war plötzlich gefragt, Raves wurden zum Treffpunkt der neuen Jugendkultur und die “Love Parade” in Berlin zählte bald mehr als 1,5 Millionen Besucher:innen. Das Jahrzehnt in dem jeder anders sein wollte und möglichst individualistisch daherkam, verkam zur Uniformierung und Kommerzialisierung der Jugendkultur, wie es bisher noch nie dagesessen war. Denn bald stiegen auch gewisse Sportmarken auf den neuen Jugendtrend des Abtanzens ein. Während Hakim Bei von “temporären autonomen Zonen” schwärmte, entstanden im Osten Deutschlands sog. national befreite Zonen, also das genaue Gegenteil von dem, was auf Tekknopartys (“Unity”) beschworen wurde. Dabei übertraf die Zahl der Aussiedler bei Weitem jene der Asylbewerber, wie Balzer betont. Selbst das deutsche Nachrichtenmagazin SPIEGEL unterlag der neuen Diskurshegemonie und titelte am 9.9.1991 “Flüchtlinge-Aussiedler-Asylanten: Ansturm der Armen”. Wenige Tage später ereigneten sich Hoyerswerda und Rostock, zwei Städte, die so gar nicht in das Bild der neuen Offenheit passten.
Airbag Generation und Two Socks
Aber Lichtermeere gegen Rechts gehörten ebenso zu den Neunzigern, wie die Piercings und Tätowierungen der “Modern Primitives”, die ihr Überleben in kleinen, selbstbezogenen Gemeinschaften erprobten. Selbstreferentialiät und Modifikation des eigenen Körpers führten zu solchen Auswüchsen wie dem vielzitierten Arschgeweih, das in den USA als Tramp Stamp den Feminismus in die Steinzeit zurückbombten. Dazu trugen auch Fernsehserien wie Baywatch bei, auch wenn diese stets unter der Prämisse der Selbstbestimmung der Frau liefen. Der letzte Sieg des Patriarchats? Dieser wurde auch in diversen Talkshows zelebriert, denn obwohl in den Neunzigern jeder ein Außenseiter und etwas Besonderes sein wollte, glichen sich die Drehbücher und wurden mit Laiendarstellern getastet. Nicht zuletzt gingen die Neunziger aber auch als Jahrzehnt des Big Brother und Matrix ein. Denn “1984” wurde mit der Erfindung der mobilen Kommunikation tatsächlich Realität: die Handys machten spätestens Ende des Jahrzehnts als kleine Sendeeinheiten Furore und der gläserne Mensch wurde alsbald so durchsichtig, dass im Grunde genommen jeder von uns als Klon nachproduzierbar wäre. Denn so viele Daten wie noch nie wurden über einen einzelnen Bürger:in im WWW gesammelt. Dabei hatte es mit Two Socks – der Katze Bill Clintons – so harmlos angefangen…
Ob-la-di ob-la-da
Wenn die Siebziger im Zeichen der Innovation standen, die Achtziger im Zeichen der Angst und Apokalypse, dann sind die Neunziger wohl die Aufhebung der beiden. Der Griff ins Archiv wird zum innovativen Kick, Hypertext über alles. Selbst der religiöse Fundamentalismus ist nur ein Widergänger der alten anti-westlichen, anti-aufklärerischen politischen Bewegungen des Nationalsozialismus und Faschismus: Klerikalfaschismus, so Walter Laqueur. Tristesse Royale ist dabei noch ein harmloser Titel. Die Globalisierung hat eben auch diesen Aspekt: “aus einer immer stärker vernetzten und hybrider werdenden Welt verschwindet jenes Eigene, in dem sich Sicherheit und Identität finden”. Darauf gibt es eben unterschiedliche Reaktionen, aber es ist wohl beides legitim, da real. Ob-la-di ob-la-da. Und vielleicht war das Jahrzehnt gerade wegen seiner Widersprüche das freieste, bisher…
No Limit. Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit
Jens Balzer, geboren 1969, ist Autor und Kolumnist, u.a. für die «Zeit», «Rolling Stone», den Deutschlandfunk und radioeins. Er war stellvertretender Feuilletonchef der «Berliner Zeitung» und kuratiert den Popsalon am Deutschen Theater. 2016 erschien sein vielgelobtes Buch «Pop», 2019 «Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er», über das der «Tagesspiegel» schrieb: «So lehrreich wie unterhaltsam … Am Ende ist man um nie geahnte Erkenntnisse reicher – und wünscht sich, dass sich der Autor bald das nächste Jahrzehnt vornehmen möge.»
Jens Balzer
No Limit. Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit
2023, Hardcover, 384 Seiten,
ISBN: 978-3-7371-0173-8
Rowohlt Verlag
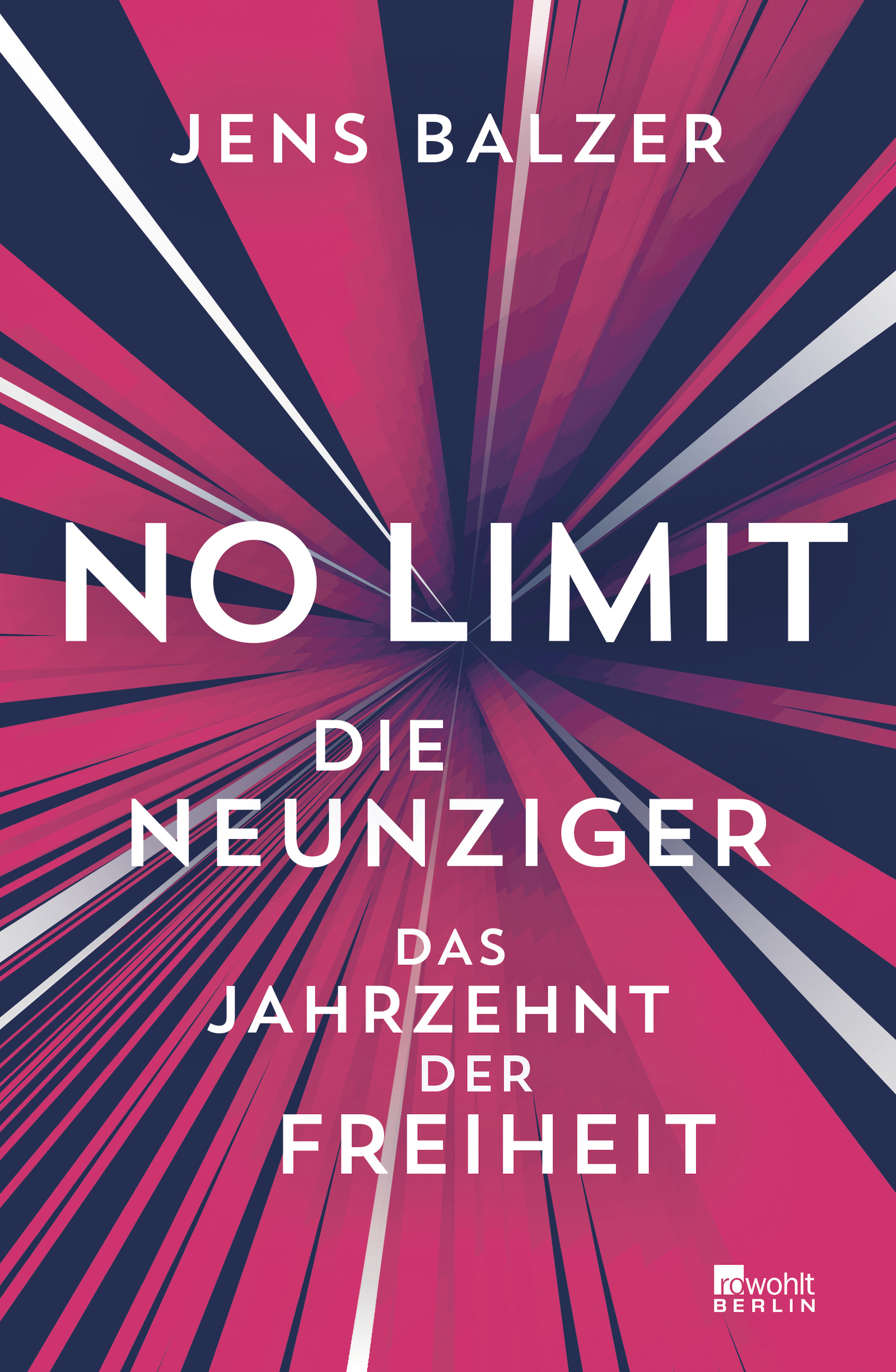
 Dieses kleine Büchlein von knapp 150 Seiten hat es in sich: Géza von Cziffra hielt sich von 1923 bis 1933 regelmäßig im Romanischen Café auf, traf Gott und die Welt und sammelte Anekdoten. Das Namensregister umfasst bald 300 Einträge und die Seitenzahlen sind aufgelistet, wann die Personen auftraten, oder auch nur zitiert wurden: Shakespeare und Goethe sind dabei. Es erschien 1981, als der Autor über achtzig war und die Geschichte über diese Zeit hinweggegangen war, unter dem Titel „Die Kuh im Kaffeehaus“. So kann er Vergleiche mit der damaligen Jetztzeit anstellen, als es schon Groupies und Hippies gab.
Dieses kleine Büchlein von knapp 150 Seiten hat es in sich: Géza von Cziffra hielt sich von 1923 bis 1933 regelmäßig im Romanischen Café auf, traf Gott und die Welt und sammelte Anekdoten. Das Namensregister umfasst bald 300 Einträge und die Seitenzahlen sind aufgelistet, wann die Personen auftraten, oder auch nur zitiert wurden: Shakespeare und Goethe sind dabei. Es erschien 1981, als der Autor über achtzig war und die Geschichte über diese Zeit hinweggegangen war, unter dem Titel „Die Kuh im Kaffeehaus“. So kann er Vergleiche mit der damaligen Jetztzeit anstellen, als es schon Groupies und Hippies gab.
