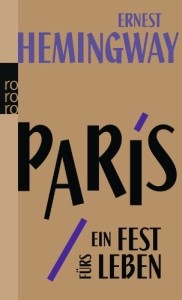 Ein Amerikaner in Paris
Ein Amerikaner in Paris
Er gehörte zur Gruppe der amerikanischen Schriftsteller im Paris der Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts, die wegen ihrer verlorenen Illusionen nach dem Ersten Weltkrieg und dem damit einhergehenden Verfall bürgerlicher Wertvorstellungen als «Lostgeneration» bezeichnet werden, ein von Gertrude Stein geprägter Begriff. Während seiner Jahre in dieser Stadt mit ihrem besonderen Flair, die seit jeher viele Künstler magisch anzieht, hatte Ernest Hemingway von 1921 bis 1926 einiges an Aufzeichnungen angefertigt, die dann jahrzehntelang unbeachtet im Keller des Hotels Ritz lagerten. Erst 1956 nahm er sich dieser Notizen wieder an und schrieb dann vier Jahre lang an «Paris – Ein Fest fürs Leben», seinem Erinnerungsbuch über diese Zeit, dessen Titel allein ja schon eine Hommage an die französische Hauptstadt ist. «Wenn es der Leser vorzieht, kann dieses Buch auch als ein Werk der Phantasie angesehen werden», schreibt der Autor in seinem Vorwort und zählt auf, was er alles weggelassen hat, man kennt Dergleichen aus diversen Autobiografien.
Er schuf damit eine informative und amüsante Anekdoten-Sammlung, als chronologischer Bericht ist das Buch über seine Pariser Jahre nämlich nicht aufgebaut, es berichtet vielmehr schlaglichtartig von den Anfängen seiner literarischen Vita und seinen bescheidenen Lebensverhältnissen in dieser Zeit. Wobei sein Leben ja, wie ich es empfinde, geradezu der Inbegriff dessen ist, was man als pralles Leben bezeichnet, jedenfalls das eines Abenteurers und archetypischen Machos, der sein Männlichkeitsimage gepflegt hat wie kein Zweiter. Die letzten beiden Winter verbrachte er, auf der Flucht aus seiner schlecht heizbaren Pariser Wohnung, im österreichischen Schruns, wo er «Fiesta» schrieb, der Roman, mit dem ihm 1927 der Durchbruch als Schriftsteller gelang.
Francophile Leser im Allgemeinen und Parisfans im Besonderen kommen mit seinem Paris-Buch voll auf ihre Kosten, Hemingway schildert die Stadt detailverliebt und präzise, man durchschreitet sie geradezu mit ihm zusammen, er benennt immer wieder genauestens die Straßen und Plätze seiner Streifzüge. Und meistens kennt er dann auch ein Restaurant oder Bistro in der Nähe, es wird jedenfalls gut gegessen und reichlich getrunken, wenn er, meist in Gesellschaft, irgendwo Platz nimmt. Zu den Menschen, die ihm begegneten, gehörten vor allem Gertrude Stein, in deren Salon er regelmäßig verkehrte, bis er sich schließlich mit ihr überwarf, ferner Ezra Pound, James Joyce, Scott Fitzgerald, Ford Madox Ford und andere Schriftsteller mehr, und auch mit einigen Malern waren er befreundet. Natürlich drehten sich die Gespräche oft um Literatur, was die Lektüre besonders interessant macht, so wenn er zum Beispiel mit dem Schriftsteller Evan Shipman über Dostojewski redet und fragt: «Wie kann ein Mann so schlecht schreiben, so unbeschreiblich schlecht, und einen so tief ergreifen»? Um schließlich auf die Übersetzerin zu kommen, die Tolstois «Krieg und Frieden» doch ganz vortrefflich übersetzt habe, an der könne es dann ja wohl nicht liegen.
Womit wir beim Stil sind, in dem Hemingway selbst schreibt, eine eher karg zu nennende, lapidare Sprache mit ebenso kurzen wie prägnanten Sätzen. Das wirkt manchmal nüchtern wie ein Zeitungsbericht, tiefer gehende Emotionen des Autors sind darin kaum erkennbar. Seine geradezu ökonomisch zu nennende Schreibweise war damals zwar en vogue in der englischsprachigen Künstlerkolonie von Paris, sie vermag hier aber keine wirklich stimmige Atmosphäre zu vermitteln, gibt allenfalls ein wenig vom Lokalkolorit jener Zeit wieder. Damit dürfte das Buch manch hochgespannte Erwartung potentieller Leser nicht erfüllen.
Fazit: lesenswert
Meine Website: http://ortaia.de
 Berichte aus dem literarischen Olymp
Berichte aus dem literarischen Olymp Kunst plus Haltung
Kunst plus Haltung In meinem Ende ist mein Anbeginn
In meinem Ende ist mein Anbeginn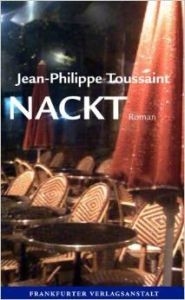 Mut zum Honigkleid
Mut zum Honigkleid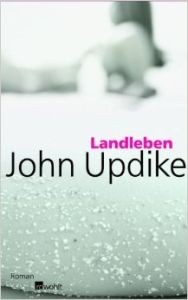 Ein inhomogener Mix
Ein inhomogener Mix Bonjour Tristesse
Bonjour Tristesse Wenn der Leser nicht zum Buch passt
Wenn der Leser nicht zum Buch passt Wir Glückpilze alle
Wir Glückpilze alle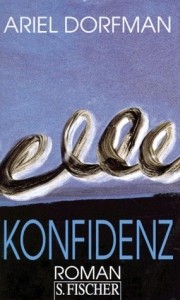 Weniger wäre mehr gewesen
Weniger wäre mehr gewesen Faszinierende Vita eines Politlyrikers
Faszinierende Vita eines Politlyrikers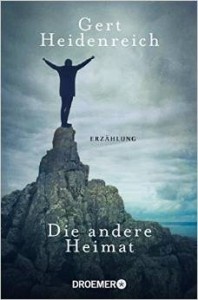 Besser lewe wie sterwe
Besser lewe wie sterwe Roman vs. Spielfilm
Roman vs. Spielfilm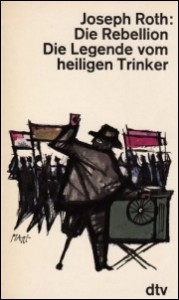 Wahrheit und Gerechtigkeit
Wahrheit und Gerechtigkeit Potenzschwäche
Potenzschwäche