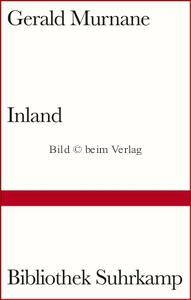 Unterschätzt
Unterschätzt
Das jüngst unter dem Titel «Inland» erstmals in deutscher Übersetzung veröffentlichte, vierte Werk des australischen Schriftstellers Gerald Murnane ist im Original 1988 erschienen. Es entzieht sich, wie von ihm selbst für alle seine Werke apostrophiert, den gängigen Gattungs-Bezeichnungen und ist am ehesten als ‹metaphysische Parabel› anzusehen, welche lehrhaft Fragen von Moral und Ethik aufwirft. Diese werden jedoch erst durch Anwendung auf Vorstellungen in ganz anderen Gedanken-Ebenen wirklich begreifbar. Ein populäres Beispiel dafür ist die Eselsbrücke, die man sich baut, um einen Sachverhalt bildhaft besser aus dem Gedächtnis abrufen zu können. Der nicht nur in Deutschland weitgehend unbekannte Schriftsteller hat stilistisch für sich einen ganz eigenen, unverwechselbaren Erzählstil entwickelt, der im Klappentext schlagwortartig als ‹murnanesk› bezeichnet wird und ihn zum Solitär unter den Autoren seines Landes macht.
Glaubt man einem Bericht im ‹New York Times Magazine›, bezeichnet sich dieser in äußerst bescheiden, geradezu prekären Verhältnissen lebende Schriftsteller als reich, weil er weiß, «dass die endlos scheinenden Landschaften meiner eigenen Gedanken und Empfindungen ein Paradies gewesen sein mussten, verglichen mit den eintönigen Gegenden, in denen andere ihr Selbst oder ihre Persönlichkeit oder was immer sie als ihre geistigen Territorien bezeichneten, angesiedelt hatten». Und auch die seinem aktuellen Buch als Motto vorangestellten Worte von Hemingway geben einen Hinweis auf die literarische Selbst-Verortung des Australiers: «Ich glaube, dass man im Grunde für zwei Leute schreibt: für sich selbst, um nach absoluter Vollkommenheit zu trachten … Dann schreibt man für Diejenige, die man liebt, ganz gleich ob sie lesen oder schreiben kann oder nicht und ob sie lebendig ist oder tot». Kein Wunder, das zu den wenigen ihm verliehenen Preisen der ‹Patrick White Award› gehört, mit dem bezeichnender Weise Autoren geehrt werden, «die einen bedeutenden, aber unterschätzten Beitrag» zur australischen Literatur geleistet haben.
Ein in der Bibliothek seines Herrenhauses in Ungarn sitzender, schriftstellerisch tätiger Ich-Erzähler beschreibt die unendlich scheinende Weite der Graslandschaft, die er von seinen Fenstern aus sieht. Eines der typischen Motive von Murnane, seine Ideal-Landschaft, wie sie sich auch in der amerikanischen Prärie wiederholt, auf die seine Lektorin am Calvin O. Dahlberg Institute of Prairie Studies von ihrem Fenster aus schaut. Sie hat bisher aber nicht eine Seite aus seiner Feder erhalten und erscheint dann selbst unversehens als Figur in einem anderen Buch. Realität und Fiktion verschwimmen hier in einem schwer durchschaubaren Ausmaß miteinander, buchstäblich alles bleibt in der Schwebe in diesem literarischen Kosmos, in dem Konkretes suspekt ist und die ungehemmte Imagination fröhliche Urständ feiert. Alles eine Frage der richtigen Sicht, heißt es dazu im Buch, ein Leser, «der meine Seiten aus seinen Augenwinkeln beobachten und der nicht die Reihen meiner Worte untersuchen würde, sondern die Formen des Papiers, die sich zwischen den Worten zeigten – solch ein Mann könnte schon das Bild einer Mädchen-Frau oder das Bild eines Graslandes oder die Geister solcher Bilder sehen». Die Grenzen zwischen trügerischer Außenwelt und grenzenlos imaginierter Innenwelt sind nicht klar erkennbar, man kann sie allenfalls vage ertasten.
Wo alles erfunden ist und man nicht mehr weiß, wer sich wen ausgedacht hat, da scheint auch das am Tisch sitzende, schreibende Ich schließlich nur noch davon zu träumen, das es schreibt. Schließlich rücken dann erzählerisch Kindheits-Erinnerungen in den Vordergrund, wobei man auch da nicht weiß, zu wem sie gehören, zum Schreiber oder zu seiner Figur. Als äußerst komplexes Werk der Postmoderne, das nur einen ziemlich kleinen Leserkreis ansprechen dürfte, demonstriert diese sinnliche Prosa eines unterschätzten Autors, was Literatur zu leisten vermag.
Fazit: erfreulich
Meine Website: http://ortaia.de
 Politisches Terra incognita
Politisches Terra incognita Kunst als Ersatzheimat
Kunst als Ersatzheimat Baltisches Epos
Baltisches Epos Zweitlektüre zu empfehlen
Zweitlektüre zu empfehlen So what?
So what? Die Mär der 68er-Generation
Die Mär der 68er-Generation Ist das Kunst oder kann das weg
Ist das Kunst oder kann das weg
 Fanal der Selbstbehauptung
Fanal der Selbstbehauptung Bilanz eines verbiesterten Dichterlebens
Bilanz eines verbiesterten Dichterlebens Einsames Nilpferd
Einsames Nilpferd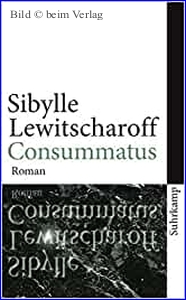 Nichts für tote Leser
Nichts für tote Leser Mega-Roman im Intervall
Mega-Roman im Intervall