 Durchs Raster gefallen
Durchs Raster gefallen
Als literarischer Senkrechtstarter erweist sich der kürzlich erschienene Debütroman «Streulicht», mit dem Deniz Ohde erstmals an das Licht einer breiteren Öffentlichkeit getreten ist. Prompt wurde er nämlich für den Preis der Frankfurter Buchmesse nominiert und landete schließlich sogar auf der Shortlist. Es handelt sich um einen klassischen Bildungsroman, dessen Besonderheit darin liegt, dass seine der Autorin in einigen Punkten autobiografisch ähnelnde Ich-Erzählerin durchs Raster gefallen ist. «Wenn’s nichts wird, kommst wieder heim» lautet denn auch resignativ der letzte Satz. Coming-of-Age also ganz ohne Fortune!
Die namenlose Protagonistin erzählt als Erwachsene anlässlich eines Besuchs an der Stätte ihrer Jugend ihre Lebensgeschichte. Sie wird als Kind einer türkischen Putzfrau und eines deutschen Fabrikarbeiters in Frankfurt am Main geboren, ganz in der Nähe des Industrieparks Hoechst. Ihre Aufstiegschancen aus den prekären Verhältnissen im bildungsfernen Elternhaus sind gering. Sie ist schüchtern bis hin zur Verstocktheit und wird zudem von diffusen Ängsten beherrscht. Obwohl sie Deutsche ist, wie ihre Mutter immer wieder betont, leidet sie unter dem Stigma, Tochter einer Türkin aus dem hintersten Anatolien zu sein, aus einem armseligen Dorf am Schwarzen Meer. Sie rasiert sich also die Monobraue, um nicht als Türkin zu gelten, und gibt immer nur ihren zweiten, den deutschen Vornamen an, wird aber trotzdem schon früh von den anderen Kindern gehänselt. «Frau A-?» fragt im Buch ein Chef die Heldin beim Empfang zu einem Bewerbungsgespräch, ihre Namenlosigkeit wird eisern durchgehalten im Roman. Ihr Vater ist lebenslang in der chemischen Fabrik als einfacher Arbeiter mit immer der gleichen, stupiden Tätigkeit beschäftigt. Ein äußerst eintöniges, trostloses Arbeitsleben also, das er mit viel Alkohol und stoischer Ruhe erträgt. Wie schon der Großvater ist er ein typischer Messi, der sich von nichts trennen kann, dessen Wohnung immer mehr vermüllt, deutliches Anzeichen für eine pathologische Entscheidungs-Schwäche.
Kein Wunder, dass die Tochter als unterprivilegiertes «Kellerkind» in dem Glauben, weniger wert zu sein als alle anderen, in der Schule häufig scheitert. Sie wird überall ausgegrenzt und hat außer Sophia und Mikka keine Freunde. Gleichwohl kämpft sie sich tapfer auf dem Umweg über die Abendschule bis zum Abitur durch, erreicht einen hervorragenden Notenschnitt und beginnt zu studieren. Auf der Uni lernt sie dann einen Kommilitonen kennen, der erste Freund der inzwischen über Zwanzigjährigen. Mit dem sie dann sogar im Bett landet, erst- und einmalig aber, muss vermutet werden. Mehr erfährt man nämlich nicht in dieser radikal sexfreien Geschichte. Sie ist und bleibt eine verklemmte junge Frau, deren Fremdheitsgefühl manifest zu sein scheint. Beim Erzählen aus ihrem Leben verliert sich die Protagonistin in endlosen Betrachtungen der trostlosen Umgebung und der chaotischen elterlichen Wohnung.
Diffus, wie es schon der Buchtitel andeutet, von der geraden Bahn abgelenkt also, ist nicht nur das Licht an dem vom ewigen Industrie-Smog geplagten Handlungsort, diffus ist auch die Erzählweise dieses Romans. Der Lebensweg seiner von äußeren Negativ-Zuweisungen geschädigten Protagonistin wird nämlich in allzu vielen sprunghaften Rückblenden erzählt. Wobei besonders die dauernden Wiederholungen immer der gleichen Szenarien und schmerzenden Gefühle den Leser schnell ermüden. Die von Hoffnungslosigkeit und Entmutigung gebeutelte, bindungslose Außenseiterin wirkt als Figur wenig überzeugend, was gleichermaßen für die Figurenrede gilt. Eine unterprivilegierte Herkunft ist auch das Thema von Nicolas Mathieu, dessen Roman «Wie später ihre Kinder» die daraus resultierende soziale Schieflage allerdings vehement anprangert. Was bei Deniz Ohde nur als hilflose Frage im Raum stehen bleibt: «Wie konnte dieses Kind durchs Raster fallen?», darauf gibt ihr französischer Kollege eine klare Antwort.
Fazit: miserabel
Meine Website: http://ortaia.de
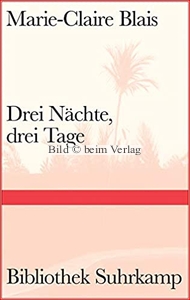 Literarische Nischenrolle
Literarische Nischenrolle Überdeterminiert
Überdeterminiert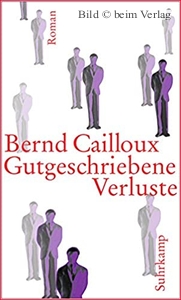 Selbstgefälliges Palaver
Selbstgefälliges Palaver Der Shigulimann
Der Shigulimann
 Als ich das Buch
Als ich das Buch 
 Nichts für «Lesefutterknechte»
Nichts für «Lesefutterknechte» Club der toten Dichter
Club der toten Dichter Literarische Abrissbirne
Literarische Abrissbirne
 Ihr könnt mich mal kreuzweise
Ihr könnt mich mal kreuzweise So lau wie stilles Wasser
So lau wie stilles Wasser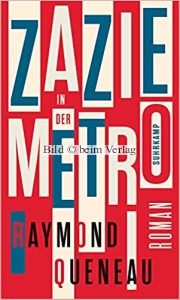 Ich bin älter geworden
Ich bin älter geworden Es ist, wie es ist
Es ist, wie es ist