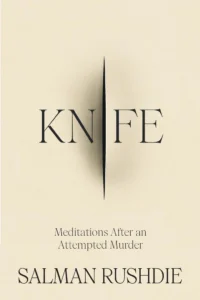 Salman Rushdie sollte im Rahmen eines Projektes für in ihren Ländern verfolgte Autoren eine Rede halten, darüber „wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen.“ Er sieht den Mann aus dem Publikum im Staat New York aufstehen und auf ihn losrennen—ein Sicherheitsdienst war nicht vorgesehen.
Salman Rushdie sollte im Rahmen eines Projektes für in ihren Ländern verfolgte Autoren eine Rede halten, darüber „wie wichtig es ist, sich für die Sicherheit von Schriftstellerinnen und Schriftstellern einzusetzen.“ Er sieht den Mann aus dem Publikum im Staat New York aufstehen und auf ihn losrennen—ein Sicherheitsdienst war nicht vorgesehen.
Seinen Angreifer nennt er im Buch A., in seinen Gedanken steht dies für „Arschloch“. Was trieb ihn an? Sein Buch, Die Satanischen Verse, hatte er nicht gelesen. Der A. sticht 27 Sekunden lang auf ihn ein—ihm gehen Gedankenfetzen durch den Kopf „der Kerl kann zuschlagen. (Später erfahre ich, das er Boxunterricht genommen hatte.)“ Er grübelt: Gab es nicht eine Vorwarnung, einen Albtraum vor der Abfahrt? Was hat das mit den Satanischen Versen zu tun? Dabei hat er doch danach so viele Bücher geschrieben; irgendwo rät er den Leser:innen ab, das Buch zu lesen, das ihm vor 35 Jahren die Fatwa gebracht hatte. Aber der erste Satz darin lautet doch: „um wiedergeboren zu werden, musst du zuerst sterben.“
In diesem Buch geht es um seine Entschiedenheit zu leben, und er schreibt, welche „Engel“ ihm zum Leben halfen.
Da steht an erster Stelle die Liebe von Eliza, seiner Frau. Eines meiner Lieblingskapitel ist die Beschreibung, wie er sich mit über siebzig verliebt hatte: wie ein Teenager. Sie wird seine Familie in den Staaten, wohin er wegen der Fatwa übergesiedelt war. Seine Söhne leben in London.
Dann kommt seine Zeit in Hamot Medical Center. Wie er sein Bewusstsein erlangt, wieder selbst atmen kann. “Eliza schaltet auf Superheldinnenmodus“ und fordert die Helfer:innen auf, ihr Tun zu erklären. Als er entlassen wird, sind die Beschäftigten stolz, auf ihn, und vielleicht auch auf sich, genießen dies, „es gibt nicht viele, die hier rausspazieren“…
Dann geht es in die Reha, er beschreibt jedes Organsystem, wie es wieder zum Funktionieren gebracht wurde. Die Helfer werden nach ihrem Fachgebiet genannt, Dr. U ist der Urologe. Wer sein Herz erreichte wird mit seinem Namen beschrieben. Er reflektiert die Abhängigkeit als Patient, welche Maßnahmen widersinnig scheinen, wann sie ihm schadeten. Auch hier schafft er Begriffe: „Schurkenmycin“ hatte ihn krank gemacht.
Geholfen haben die Genesungswünsche, die Grüße von Promis und den vielen anderen. Sie sind ihm Zeichen von Liebe. Manchmal streut er Erinnerungen an seine Kindheit in Bombay (nicht Mumbai!) ein. Die indische Regierung hatte keine Grüße geschickt…
Nach Monaten geht er ohne Pfleger ins Bad und sieht sich im Spiegel. Eliza hatte das bisher unterbunden. Erst erkennt er sich kaum, so geschunden sieht er aus. Dann redet er mit seinem Gegenüber, erschrocken über sein Aussehen, aber bereit, nun als dieser zu leben. Die Gedanken gehen zurück zu seinen Entscheidungen in seiner Jugend in Bombay. Damals hatte er sich entschlossen, den gewalttätigen Vater zu ohrfeigen, als er die Mutter schlug; der Vater hielt sich danach zurück. Diese Erfahrung unterstützte seine Entwicklung zu dem Menschen, den er werden wollte und wurde.
Ein weiterer gedachter Dialog findet mit A. statt, der sich unschuldig fühlt, nur das getan hat, was der Iman Yutubi ihn jahrelang gelehrt hatte. Das ist monologisch gestaltet und hätte A. wohl nicht erreicht. Rushdies Botschaft: denjenigen, die ihren Glauben als Leitfaden nehmen, fehlt Humor.
Schrittweise findet er zurück ins Leben, reist zu seiner Familie in London, allerdings mit Personenschutz. Er beschreibt, die ihm bekannten Promi, die auch Messerattacken erlitten hatten. Er öffnet seinen Twitteraccount wieder und kommentiert politische Entwicklungen.
Zu Fragen der Religion will er das zukünftig nicht mehr tun. Zum allerletzten Mal schreibt er seine Meinung noch einmal auf: Als Privatsache kann es gut sein. Bevor Menschen sich die Weltzusammenhänge erklären konnten, glaubten sie, eine Macht im Himmel hätte ihnen den Schlüssel zu deren Verständnis geschenkt. Inzwischen ist erforscht, dass sich die Schöpfung selbst geschaffen hat. Wir sind erwachsen geworden und müssen selbst Verantwortung übernehmen.
Mit vielen Beispielen aus Vergangenheit (Franz. Revolution und katholische Kirche, indische Unabhängigkeit und Teilung in hinduistische und muslimische Staaten) und Gegenwart (Islamismus, christliche Fundamentalisten, derzeitige indische Regierung) weist er auf, wie religiöse Überheblichkeit Frieden und Freiheit ver- und zerstören kann. Und das könnte ein Schlusswort sein: „Ich habe auch nichts gegen Religion, wenn sie diesen privaten Raum besetzt und nicht versucht, Wertvorstellungen anderer Menschen zu beeinflussen. Wenn die Religion aber politisch wird, gar zur Waffe, dann geht sie uns alle etwas an, da sie solch enormes Schadenspotenzial hat.“
Die direkte und bildreiche Sprache ist sehr gut übersetzt worden. Ein Lesevergnügen, das Nachdenken anregt.