 Polit-Seminar statt Liebes-Schnulze
Polit-Seminar statt Liebes-Schnulze
Der 2025 erschienene, zweite Roman von Nora Haddada weist mit seinem Titel wie auch im Klappentext auf eine Liebesgeschichte hin und weckt Leser-Erwartungen, die er letztendlich konterkariert mit einer brisanten politischen Thematik. Es geht um die seit der Gründung des Staates Israel als Folge des Genozids an den Juden andauernde, kriegerische Auseinandersetzung mit den Palästinensern. Die hat am 7. Oktober 2023 mit dem überraschenden Überfall der Terrororganisation Hamas auf das südliche israelische Grenzgebiet eine neue, fatale Brutalität erreicht. Andauernde Demonstrationen in den westlichen Ländern betreffen beide Konfliktparteien gleichermaßen, und auch im Roman vertreten die beiden Protagonisten der ‹Generation Y› diametral entgegen gesetzte Positionen, was ihre Beziehung schwer belastet.
Beim Urlaub in Marseille treffen die Französin Myriam und der deutsche Julian in der feuchtfröhlichen Runde einer Karaokebar aufeinander. Man unterhält sich angeregt über allerlei Themen, und schließlich kommen sie auf die Idee, gemeinsam auf der Bühne ein Duett zu singen, auch wenn das peinlich enden könnte, denn beide sind keine großen Sänger. Das gemeinsame Abenteuer und die anregenden Gespräche treiben Myriam und Julian zueinander, sie finden sich überaus sympathisch. Am nächsten Morgen muss Myriam dann feststellen, dass Julian ihre Wohnung schon verlassen hat, – ohne Abschied zu sagen. Sie kehrt nach Paris zurück, um ihr Studium abzuschließen, er versucht in Berlin, journalistisch tätig zu werden, was ihm durch Protektion eines Freundes auch bald gelingt. Und Julian legt dann als freier Journalist eine Blitzkarriere hin, seine Artikel sind begehrt und werden gut bezahlt. Nach Abschluss ihres Studiums vermittelt in Paris der Professor von Myriam seiner hochbegabten Studentin eine Dozentenstelle bei einer Kollegin in Berlin, die sie begeistert annimmt. Ein halbes Jahr, nachdem Julian sie in Marseille ohne Hinterlassen seiner Adresse grußlos verlassen hat, treffen sie nun im universitären Umfeld Berlins schon bald wieder aufeinander, – und finden zögernd auch wieder zueinander!
Myriams Seminar zum Thema «Einführung in die postkoloniale Theorie» findet großes Interesse vor allem im maghrebinisch-französischen Teil der Studentenschaft, weil es sich dabei auch um die wissenschaftliche Bewertung der genozidartigen militärischen Angriffe auf Gaza und die völkerrechtswidrige Blockade der Zugänge dorthin handelt. Julian hingegen rechtfertigt in seinen Zeitungsartikeln die brutale israelische Vorgehensweise und weist darauf hin, dass die palästinensische Bevölkerung, wie einst auch die Deutschen, ebenfalls schuldig ist durch die «apathische Hinnahme eines Regimes wie das der Hamas oder der Nationalsozialisten». Übrigens, nicht zuletzt darauf beruht ja die bis heute gültige, so genante «Staatsdoktrin» Deutschlands, was Israel anbelangt. Als ein Freund von Julian ihn darüber informiert, dass sein Verlag einen vernichtenden Artikel über Myriams vieldiskutierte Thesen veröffentlichen will, kommt Julian dem zuvor und schreibt seinerseits eine dort veröffentlichte, gemäßigte Kritik zu den palästinenser-freundlichen, wissenschaftlichen Theorien Myriams.
Der an sich ja banale Plot einer «Romanze» ist alles andere als ein Liebesroman, er ist vielmehr ein loses Handlungsgerüst für einen vielstimmigen, akademischen Diskurs zu den Voraussetzungen und Folgen des 7. Oktobers 2023. In einer unprätentiösen, stimmigen Diktion wird da im Freundeskreis hitzig debattiert, werden unverrückbare Standpunkte definiert, und das alles ganz ohne Liebelei, ohne Romantik jedenfalls. Die Anzahl der Küsse kann man an einer Hand abzählen, und Sex findet bei diesen ‹verkopften› Millenials allenfalls mal vage angedeutet und gut versteckt zwischen den Zeilen statt! Dafür aber ist dieser intellektuell elitäre Roman eine geradezu unerschöpfliche, bereichernde Fundgrube politischer Argumentationen zum Palästina-Konflikt, – die leider allesamt verdeutlichen, dass er wahrscheinlich unlösbar bleiben wird!
Fazit: erstklassig
Meine Website: https://ortaia-forum.de
 Eine Stimme für das Unsagbare
Eine Stimme für das Unsagbare Listige Subjekt/Objekt-Umkehr
Listige Subjekt/Objekt-Umkehr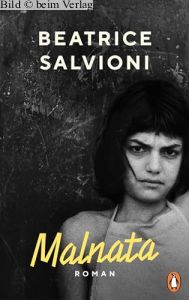 Deutschlandfunk trifft’s
Deutschlandfunk trifft’s Anschreiben gegen das Vergessen
Anschreiben gegen das Vergessen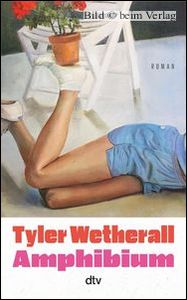 Adoleszenz eines toughen Mädchens
Adoleszenz eines toughen Mädchens Stilistischer Fehlgriff par excellence
Stilistischer Fehlgriff par excellence Und Wera zeigt Zähne
Und Wera zeigt Zähne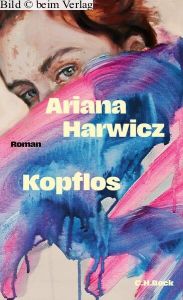 Radikale stilistische Unmittelbarkeit
Radikale stilistische Unmittelbarkeit Danebengelungen
Danebengelungen Mathematische Exkursionen bis hin zur KI
Mathematische Exkursionen bis hin zur KI Überzogen anmutender Plot
Überzogen anmutender Plot Spiegelbild eines Jahrhunderts
Spiegelbild eines Jahrhunderts Fanal einer Autistin
Fanal einer Autistin Literarisches Kosovo-Tribunal
Literarisches Kosovo-Tribunal